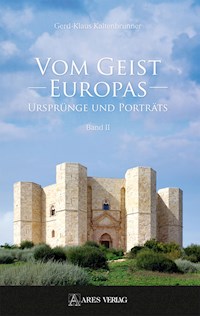
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Texte aus dem dreibändigen Werk "Vom Geist Europas" von Gerd-Klaus Kaltenbrunner über die geistigen Grundlagen Europas liegen nun in einer zweibändigen Neuausgabe vor. Jeder Band beinhaltet darüber hinaus einen zusätzlichen, bisher noch nicht veröffentlichten, Text! Band 2: Aus dem Inhalt: •Pythagoras •Sokrates •Cicero •Vergil •Ovid •Apollonios von Tyana •Boethius •Schota Rustaweli •Ramon Llull •Meister Eckhart •Himmelstürmende erdverbundene Mystik Spaniens •Jakob Böhme (NEU!) •Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen •Emanuel Swedenborg •Edmund Burke •Edward Gibbon •Friedrich W. J. Schelling •Clemens Brentano •Justinus Kerner •Carl Gustav Carus •Jean-Henri Fabre •Eduard von Hartmann •Alfred North Whitehead •Miguel de Unamuno •Pavel Florenskij •René Guénon •Lucian Blaga •Lettland als Raum der Poesie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd-Klaus Kaltenbrunner
VOM GEISTEUROPAS
URSPRÜNGE UND PORTRÄTS
Band II
herausgegebenvonMagdalena S. Gmehling
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Umschlagabb. Vorderseite: Castel del Monte, Apulien
(Berthold Werner / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; bearbeitet)
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Textnachweis: Es handelt sich bei den in diesem Buch abgedruckten Texten um ausgewählte und originalgetreu abgedruckte Essays aus Gerd-Klaus Kaltenbrunners dreibändigem Sammelwerk „Vom Geist Europas“ (Asendorf 1987, 1989, 1992). Beigegeben wurde Kaltenbrunners Porträt Jakob Böhmes aus dem ersten Band der vorangegangenen Trilogie „Europa. Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden“ (Heroldsberg bei Nürnberg 1981).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Ares Verlag GmbH
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.ares-verlag.com
ISBN 978-3-99081-010-1
eISBN 978-3-99081-056-9
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Ares Verlag, Graz 2019
Layout: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Inhalt
Pythagoras
Himmelsmusik und Harmonie der Seelen.Idee und Wirkung eines Ordens
Sokrates
Das schöne Wagnis, den Tod vomLeben her zu verstehen
Cicero
Staatsmann, Humanist und Repräsentantaltrömischer Religiosität
Vergil
Dichter des Ausharrens unter den Tränen der Dinge
Ovid
„Sogar Götter entstehn durch Gedichte …“
Apollonios von Tyana
Weisheitslehrer und Wundertäter in Wendezeit
Boethius
Der eingekerkerte Staatsmann imZwiegespräch mit Frau Philosophie
Schota Rustaweli
Um Georgien die Ehre zu geben
Ramon Llull
Troubadour Gottes aus Mallorca undPionier christlich-islamischer Bewegung
Meister Eckhart
Lehrer der Gelassenheit und der Entgötzung Gottes
Himmelstürmende erdverbundene Mystik Spaniens
„Man hat keinen Grund, Schwäche zu zeigen …“
Jakob Böhme
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
Barockes Welt-Buch„Der abenteuerliche Simplicissimus“
Emanuel Swedenborg
Ein Naturforscher, der mit Engeln diskutierte
Edmund Burke
„Ein revolutionäres Buch gegen die Revolution“
Edward Gibbon
Weltgeschichte Europas zwischen Ruinenoder Wann ist Rom wirklich untergegangen?
Friedrich W. J. Schelling
Klassiker romantischer Philosophie
Clemens Brentano
Drei Begegnungen
Justinus Kerner
Geisterseher, Melancholiker undHumorist aus Schwaben
Carl Gustav Carus
Seelenforscher und Ökologe inder Nachfolge Goethes
Jean-Henri Fabre
Der Homer der Insekten
Eduard von Hartmann
Der Philosoph des Unbewußten
Alfred North Whitehead
Mathematiker, Homo religiosusund Entzifferer des Weltprozesses
Miguel de Unamuno
Baskischer Denker der Hispanitätim Zeichen Don Quijotes
Pavel Florenskij
Ein russischer Leonardo da Vinciund Troubadour der Göttlichen Weisheit
René Guénon
Vermittler der Urtradition
Lucian Blaga
Seele Rumäniens und Vision des All-Lebens
Lettland als Raum der Poesie
„Was ewig ist, kann schweigen …“
Pythagoras
Himmelsmusik und Harmonie der Seelen Idee und Wirkung eines Ordens
Wetteifer aller Ichs, den Gedanken zu finden, derüber der Menschheit stehen bleibtals ihr Stern.
Nietzsche
Am Ursprung der griechischen — und damit der europäischen — Philosophie stehen keine Universitäten, Kongresse und Seminare, sondern Tempelweistümer, Theophanien und mystische Bruderschaften. Thales, dem die Ansicht zugeschrieben wird, daß der Urgrund der Dinge im Wasser bestehe, hat auch gesagt, „daß alles von Göttern voll” sei. Heraklit war der Sohn eines Hohenpriesters, dem das Vorrecht zustand, sich mit königlichem Purpur kleiden zu dürfen. Seine Schrift über das Wesen der Welt hinterlegte Heraklit im Tempel der Göttin Diana zu Ephesos. Empedokles wirkte als von den orphischen Mysterien beeinflußter Sühnepriester und Seelenwanderungsprophet. Parmenides aus Elea (heute Castellamare di Veglia) in Unteritalien schildert zu Beginn seines Lehrgedichts, wie er, von „Sonnenmädchen” geleitet, auf fliegendem Rossegespann aus der Welt des Dunkels in ein Lichtreich entrückt wurde, wo die ihn die Wahrheit lehrende Göttin wohnt. Pythagoras, von der Insel Samos stammend, ließ sich in ägyptische, babylonische, iranische und, wie sich von selbst versteht, auch in griechische Mysterien einweihen. Wie Buddha, Sokrates und Jesus keine Schriften hinterlassend, übereignete er seine Lehre treuhänderisch einem ordensähnlichen Geheimbund, dessen Zentrum die griechische Pflanzstadt Kroton an der östlichen Küste Süditaliens war. Von Pythagoras ließ sich vor allem auch Platon beeinflussen. Die platonische Akademie wie die meisten späteren Philosophenschulen der Antike waren mehr als bloße Wissensvermittlungsanstalten. Sie stellen fast durchweg kultische Verbände mit eigenen Altären, Opfern und Heiligtümern dar, um einen Gott, Heros oder vergöttlichten Meister gescharte Gemeinden mit esoterischer Disziplin, Liturgie und Kalendarium. Der Streit um den Kern der nur mündlich einer eingeweihten Elite von Adepten als Geheimwissen anvertrauten Lehre Platons bewegt noch immer die Philosophiehistoriker. Die grandiose Kosmologie, die Platon in seinem dialogischen Alterswerk „Timaios” entwirft, hat in unserm Jahrhundert fortgeschrittener Naturwissenschaft wieder die Bewunderung philosophierender Physiker erregt; die namhaftesten unter ihnen sind der Brite Alfred North Whitehead und der Deutsche Werner Heisenberg.
Den Hauptteil des erdachten oder, wie ich mit guten Gründen vermute, weitgehend auf einer wirklichen Unterredung beruhenden philosophischen Gesprächs bildet der Vortrag des als Gast in Athen weilenden Pythagoreers Timaios.
Er stammt aus der von Lokrern an der Ostküste Unteritaliens gegründeten Kolonie Lokroi (heute Locri), also aus „Großgriechenland”, Magna Graecia, der Megále Hellás. Es ist dies jenes Gebiet im Süden der Apenninenhalbinsel, das von Kyme (Cumae) bei Neapel und Poseidonia (Paestum) in Lukanien bis Tarent (Taranto), und von Tarent bis Rhegion (Reggio di Calabria) und Terina (San Eufemia) reicht und auch die Insel Sikelia (Sizilien) mit den Städten Akragas (Agrigent), Syrakusai (Siracusa), Katane (Catania), Tauromenion (Taormina) und Messene (Messina) umfaßt. Es war seit dem achten vorchristlichen Jahrhundert von Griechenland aus besiedelt und „kolonisiert” worden und wurde kulturgeschichtlich zum strategischen Brückenkopf hellenischen Geistes in Italien und damit zum Vermittler griechischer Mythologie, Kunst, Wissenschaft und Philosophie an die römische Welt.
In diesem jahrhundertelangen Prozeß kommt dem Pythagoreismus eine überragende Rolle zu. Ohne zu übertreiben, kann man sagen, daß am Ursprung italischer Philosophie und Naturforschung, einschließlich Mathematik und Medizin, der von Samos nach Kroton ausgewanderte Inselgrieche Pythagoras steht. Ihm folgen dann Xenophanes, Parmenides, Empedokles und eben auch der im gleichnamigen platonischen Dialog auftretende Philosoph Timaios, der den Athenern die pythagoreische Lehre vom Ursprung des Kosmos, von der Weltseele und Harmonie der Sphären vortrug. Es ist zwar heute üblich, diesen aus Lokroi stammenden Timaios für eine von Platon erfundene Figur zu halten, was ich für ungefähr ebenso sinnvoll und aufschlußreich halte wie die historisch-kritische Behauptung, daß der Sänger der Odyssee nicht Homer, der Verfasser des Johannesevangeliums nicht Johannes und der Schöpfer der Shakespeareschen Dramen nicht Shakespeare hieß. Meinetwegen mögen sie anders geheißen haben, was tut es schon zur Sache? Wenn es um Werke dieser Art geht, gilt ewig nicht die Nörgelei geistblinder Pedanten, sondern der mitternächtliche Jubel der liebeentzückten Julia:
Was ist ein Name? Was uns Rose heißt,
Wie es auch hieße, würde lieblich duften;
So Romeo, wenn er auch anders hieße,
Ihm bliebe doch der köstliche Gehalt,
Der einmal sein ist, auch ohne jenes Wort.
Mag nun der Überbringer pythagoreischer Kosmologie Timaios oder anders geheißen haben, was eine drittrangige Frage ist, so steht jedenfalls fest, daß der Platonismus neben dem sokratischen und morgenländischen Element auch einen mindestens ebenso schwerwiegenden Bestandteil von Pythagoreismus enthält. Dieses drittgenannte Ingrediens hat um so mehr Gewicht, als vieles, was man als den „Orientalismus” Platons bezeichnen kann, ihm über die Schule des Pythagoras zugekommen ist oder zumindest von Quellen abstammt, aus denen auch der Stammvater des Pythagoreismus geschöpft hat.
Pythagoras war der Sohn des auf der Insel Samos ansässigen Goldschmiedes und Kaufherrn Mnesarchos. Ob er auf Samos oder in Tyros geboren wurde, wohin seine Mutter den Vater auf einer Geschäftsreise begleitet hatte, ist strittig. Als sein Geburtsjahr kann man 570 annehmen; manche Berechnungen lassen ihn früher (um 580), andere später (um 560) geboren sein. Doch sei dem wie immer, die jonische Insel Samos, auf der Pythagoras aufwuchs und — abgesehen von ausgedehnten Reisen nach Babylon und Ägypten — bis in seine reifen Mannesjahre blieb, zeichnete sich damals bereits durch eine hohe, teilweise schon sehr verfeinerte Kultur aus. Samier hatten an der Kolonisation in Perinthos, Amorgos und Naukratis teilgenommen, und bereits um 660 war Kolaios von Samos als erster Grieche bis zum Atlantischen Ozean vorgestoßen. Für den Wohlstand der Stadt zeugen der Ausbau des großen, von einer doppelten Säulenreihe umgebenen Tempels zu Ehren der Hera, die auf der Insel dreihundert Jahre lang in geheimer Ehe mit Zeus gelebt haben soll, die Stadtmauern, Hafenmolen und die berühmte Wasserleitung, die in einem etwa tausend Meter langen Tunnel durch den Stadtberg geführt war. Das Heraion auf Samos, das bedeutendste Heiligtum der Gemahlin des Göttervaters neben dem zu Olympia, galt als eines der sieben Weltwunder. Es besaß zahlreiche Nebenbauten, Altäre, Hallen, Badehäuser und Hunderte von kostbaren Weihegeschenken, darunter vor allem große Bronzekessel und Standbilder aus Marmor. An den Hof des reichen und luxusliebenden Tyrannen Polykrates, der von 538 (seit 532 allein) bis 522 regierte und, gestützt auf Söldner und eine starke Flotte, auch über viele Inseln und Küstenstädte Kleinasiens herrschte, kamen neben dem berühmten Arzt Demokedes die Dichter Anakreon und Ibykos.
In dieser Welt also wuchs der reiche Kaufmannssohn Pythagoras auf, der sich schon früh für religiöse und kosmogonische Fragen interessiert zu haben scheint. Er soll nämlich, so wird berichtet, sich mit achtzehn Jahren zunächst zu seinem Onkel auf die Insel Lesbos begeben haben, um dort die Unterweisung durch den von der kleinen Insel Syros stammenden Pherekydes zu genießen, der eine noch stark mythische Weltentstehungslehre darlegte, die mehr an die der Orphiker als die des Hesiod erinnert. Pherekydes hat als erster die Ansicht vertreten, daß die menschliche Seele unsterblich sei und immer wieder auf die Erde zurückkehre, um sich erneut zu verkörpern. (Cicero: Tusculanische Gespräche I 38). Diese Lehre, die damals nur in Indien ausdrücklich und systematisch formuliert war, wurde für Pythagoras von bestimmendem Einfluß. Zwei Jahre später besuchte Pythagoras in Milet auch den greisen Philosophen Thales. Auf dessen Rat hin, heißt es bei Jamblichos, sei er nach Sidon in Phönikien und dann weiter nach Ägypten gesegelt:
„In Sidon begegnete er den Nachkommen des Philosophen und Propheten Mochos und den übrigen phönikischen Hierophanten. Er ließ sich in alle Mysterien einweihen, die in Byblos, Tyros und in vielen Teilen Syriens in besonderer Weise begangen wurden.”
Bereits damals war Pythagoras mit einer ganzen Reihe von kultischen Geheimbünden in enge Verbindung getreten; ja es gelang ihm sogar, in sie als Myste aufgenommen zu werden. Doch die phönikisch-syrische Esoterik genügte ihm nicht. Sie erschien ihm bloß als Ableger viel älterer und ehrwürdigerer Geheimlehren und Mysterien, die von mächtigen Kollegien eifersüchtig bewahrt und nur wenigen Auserwählten nach langen Prüfungen zugänglich gemacht wurden: der ägyptischen Priesterweisheit, wie sie in Heliopolis, Memphis und Theben blühte. Jamblichos berichtet, zweiundzwanzig Jahre lang habe Pythagoras in engstem Umgang mit der ägyptischen Priesterschaft in Theben verbracht. Unter strengsten Bedingungen zu ihren Kulten zugelassen, sei er Stufe für Stufe in immer tiefere Geheimnisse eingeweiht worden. Als im Jahre 526 der Perserkönig Kambyses das Land der Pharaonen eroberte, wurde er, wenn wir Jamblichos glauben dürfen, mit Tausenden der angesehensten Ägypter, darunter auch zahlreichen Priestern, als Gefangener nach Babylon abgeführt. Doch kaum war er dort angekommen, gelang es dem mysteriendurstigen Griechen abermals, zu den nicht nur die Götterverehrung, sondern auch Mathematik, Musik und andere Wissenschaften pflegenden Priestern des fremden Landes Zugang zu finden. Er verkehrte dort, wie Jamblichos ausdrücklich sagt, mit den „Magiern, die an ihm dasselbe Wohlgefallen fanden wie er an ihnen.”
Diese „Magier”, mit denen er in Babylon verkehrte, bildeten eine Art Erbkaste von Priestern, vergleichbar den indischen Brahmanen und den israelitischen Leviten. Wenngleich ihre Beziehungen zur Religion Zarathustras noch immer nicht ganz geklärt sind, so steht jedenfalls fest, daß sie viele zarathustrische Riten und Gebräuche übernommen hatten und schließlich als Jünger des iranischen Propheten galten. Wie Herodot berichtet, deuteten sie Träume, prophezeiten durch Opferung weißer Rosse und sangen während der gottesdienstlichen Feiern religiöse Hymnen. Das Christentum lehnt zwar die Magie als heidnische Zauberei oder sogar als Teufelsblendwerk ab, doch im Evangelium nach Matthäus (2, 1-12) huldigen gottesfürchtige und sternkundige „Magier” (Magoi) dem vor kurzem geborenen Jesusknaben. Die im deutschen Raum meist „Heilige drei Könige” oder auch „Weise aus dem Morgenlande” genannten Besucher aus dem Osten waren Nachkommen jener Magier, von denen Pythagoras mehr als ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt Unterricht und Einweihung erhalten hatte. Trotz der stark legendenhaften Züge des Besuchs der Magier in Bethlehem, wo über dem Hause, in dem sich Maria mit dem Kinde befand, der Stern aus dem Osten stehenblieb, ist es nicht unwahrscheinlich, daß um die Zeitenwende auch die persische Priesterkaste der Magier davon gehört hatte, wie sehnsüchtig im Judentum ein Messiaskönig erwartet wurde. Es ist sogar möglich, daß sie ihn mit dem zarathustrischen Helfer (sausbyant) im Kampf zwischen Licht und Finsternis gleichsetzten und deshalb einige ihrer Mitglieder in die Fremde aufbrachen, um diesem Heilbringer zu begegnen.
Doch wie immer es um den geschichtlichen Kern des Evangelienberichts bestellt sein mag, sicher ist zumindest eines: die volkstümlichen „Heiligen drei Könige”, die seit dem neunten Jahrhundert die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar tragen, waren „Magier”, also Träger uralten Geheimwissens und Abkömmlinge jener sternkundigen Priesterkaste, die den aus Ägypten nach Persien verschleppten Griechen Pythagoras zwölf Jahre lang unterwiesen hatte. In den romanischen Sprachen ist, anders als im Deutschen, die Erinnerung an ihr Magiertum deutlich aufbewahrt. Im Italienischen heißen sie Re Maghi, im Französischen Rois Mages, im Spanischen Reyes Magos. Magier gehörten neben Engeln, Hirten und Tieren zu den allerersten Verehrern des neugeborenen Christusknaben.
Pythagoras hat also weite Reisen unternommen und in Phönikien, insbesondere aber in Ägypten und Babylon (das seit 539 zum Persischen Reich gehörte), mit religiösen Geheimbünden, Kultgemeinden und Priesterkasten intensive Beziehungen unterhalten. Mögen auch die Zeitangaben bei Jamblichos — 22 Jahre in Ägypten und 12 Jahre in Babylon — unglaubwürdig sein, so sind die Aufenthalte des Samiers in den beiden Ländern bereits durch Nachrichten aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert gut bezeugt. Der Redner Isokrates erwähnt die Ägyptenfahrt des Pythagoras; und der Pythagoreer Aristoxenos, der sich später Aristoteles anschloß, berichtet, daß Pythagoras mit Zaratos, das heißt Zarathustra (Zoroastres) zusammengekommen ist (vgl. B. L. van der Waerden: Die Pythagoreer. Religiöse Bruderschaft und Schule der Wissenschaft. Zürich 1979). Herodot (Historien, II 123; IV 95) erwähnt, daß „einige Griechen” die altägyptischen Lehren vom Schicksal der Seele nach dem Tode übernommen hätten; daß er damit auch Pythagoras meint, kann aufgrund anderer Stellen seines eigenen Werkes (vgl. II 81) nicht bezweifelt werden.
Was aber hat Pythagoras in Ägypten und Babylon an Lehren und Kenntnissen empfangen? Jamblichos erwähnt Astronomie, Geometrie, Zahlenlehre und Musik, somit die vier typischen Wissenschaften der Pythagoreer. Doch mehr als die Unterweisung in Mathematik und Sternkunde, in welchen Disziplinen die Babylonier damals bereits weit fortgeschritten waren, betont Jamblichos das religiöse und mystagogische Element in den Studien des Meisters aus Samos. Er sagt, Pythagoras wurde in Ägypten „in alle Mysterien und Geheimkulte eingeweiht”; er genoß die „Sympathie der Priester und Propheten”; er durfte „in den allerheiligsten Gemächern” der Tempel weilen; er wurde von den Magiern genau unterrichtet „in allem, was heilig war”.
Dies sind aufschlußreiche Auskünfte, die zu der Vermutung berechtigen, daß sich Pythagoras — weit mehr als für naturwissenschaftliche Fragen — für die überlieferten Geheimlehren und das „heilige Wissen” priesterlicher Kasten und ähnlicher Kultverbände interessierte. Hier fand er so vieles, was schließlich in seine eigenen Lehren und in die Ordnung seines Bundes einging.
Zurückgekehrt nach Samos, wo der einst für so glücklich gepriesene Polykrates durch die Perser gestürzt und ans Kreuz geschlagen worden war (522 vor Christus), fühlte sich Pythagoras unter den völlig veränderten öffentlichen Verhältnissen seiner nunmehr unter iranischer Oberhoheit stehenden Inselheimat nicht mehr wohl. Wahrscheinlich litt er auch darunter, daß er mit seinen im Orient gewonnenen Lehren zu Hause nur wenig Anklang fand, als er, wie Jamblichos sagt, versuchte, „seine Unterweisung auf symbolischem Weg zu vollbringen, ganz wie er selbst in Ägypten ausgebildet worden war.” So verließ denn Pythagoras um 510 — nach anderen Berichten, darunter auch dem von Cicero (De re publica 2, 28), allerdings schon um 530, also noch unter dem Tyrannen Polykrates — wieder und diesmal endgültig sein Vaterland und fuhr über Kreta und Griechenland, wo er neben anderen Orten auch das Apollonheiligtum zu Delphi und Sparta besuchte, nach Unteritalien, wo es eine Reihe blühender Griechenstädte gab. Pythagoras war damals also entweder schon fast sechzig oder erst etwa vierzig Jahre alt, als er in der achaiischen Kolonie Kroton landete und sich dort niederließ. Kroton, das mächtigste Gemeinwesen der Magna Graecia, wurde zur Schicksalsstadt des ausgewanderten Inselgriechen. Erst hier fand er völlig den ihm wesensgemäßen Weg. Hier gelangte er dazu, all das, was er auf seinen Reisen an Lehren empfangen hatte, geistig wie politisch fruchtbar zu machen und selber vom Adepten morgenländischer Priesterweisheit zum Stifter eines eigenen staatsübergreifenden religiös-ethischen Ordens zu werden.
Als Pythagoras in Großgriechenland ankam, befanden sich zahlreiche der süditalischen Griechenstädte miteinander in Kriegszustand. Um 540 hatten die Stadtstaaten Kroton, Sybaris und Metapontion als Verbündete die kleine Stadt Siris besiegt und völlig zerstört. Anschließend griff Kroton die mit Siris verbündet gewesene Stadt Lokri an. Trotz der militärischen Übermacht der Krotoniaten gewannen die Lokrer die Schlacht. Die Niedergeschlagenheit der Besiegten war allgemein; man führte den Mißerfolg des Kriegszuges auf Zuchtlosigkeit, Verweichlichung und schlechte Führung zurück.
In dieser Situation ging Pythagoras in Süditalien an Land. Nach einem kurzen Aufenthalt in Sybaris am Golf von Tarent ließ er sich in dem südlicher gelegenen Kroton nieder. Er hielt dort, wie Jamblichos berichtet, vier große Reden, mit denen er sich zuerst an die jungen Männer, dann an den Senat, schließlich an die Knaben und zuletzt an die Frauen der Stadt wandte.
Die jungen Männer ermahnte er zur Ehrfurcht vor dem Alter, indem er darlegte, daß auch im „Kosmos” dem Früheren höherer Rang zukomme als dem Späteren. Kosmos bedeutete damals allgemein „Schmuck”, „Ordnung”. Pythagoras scheint der erste Grieche gewesen zu sein, der mit diesem Wort das Weltall bezeichnete: das Universum als eine harmonie-erfüllte Ordnung, als ein von göttlicher Schönheit strahlendes Schmuckstück oder Juwel. Es ist bemerkenswert, daß er bereits in seiner allerersten Rede auf italischem Boden nicht nur das Weltall einen Kosmos nannte, sondern auch seine ethischen Gebote mit einer kosmologischen Begründung versah, indem er Sittlichkeit sozusagen als angewandte Astronomie lehrte: so wie im Kosmos das Frühere höher geehrt werde als das Nachfolgende, so wie der Aufgang würdevoller sei als der Untergang, die Morgenröte höher als der Abend, der Ursprung heiliger als das Ende, so sollen auch die später Geborenen zu den früher Geborenen ehrerbietig sein. Pythagoreismus ist, halten wir dies schon jetzt fest, eine das Weltall bedenkende und als normatives Vorbild menschlicher Wohlordnung anerkennende Philosophie oder „Kosmosophie”. Auch ein zweiter allgemeinpythagoreischer Grundgedanke klingt in der ersten Rede, die der Samiote im Gymnasion von Kroton hielt, schon rätselhaft an:
„Ihr schuldet den Eltern so großen Dank, wie ein Verstorbener dem abstatten möchte, der ihn ins Leben zurückbringen könnte.”
Der geheimnisvolle, wie raunend gesagte Ausspruch wird nur dann verständlich, wenn wir ihn als eine Anspielung auf die Seelenwanderungslehre der Pythagoreer auffassen: alle, die jetzt leben, waren schon einmal gestorben und sind insofern durch ihre Eltern wieder mit dem Leben versehen worden.
Daß Pythagoras jedoch nicht bloß als einzig der ekstatischen Schau des Kosmos und der Meditation des vor- und nachgeburtlichen Seelenschicksals lebender Esoteriker spricht, sondern von allem Anfang an die Statur eines Politikers, ja Staatsmannes aufweist, zeigt ein Satz aus der Rede an die Jünglinge, der gewiß über die privaten Beziehungen hinaus auch auf die öffentlichen Verhältnisse der Stadt zielte:
„Begegnet einander im wechselseitigen Verkehr am besten so, daß ihr den Freunden nicht zu Feinden und den Feinden so schnell wie möglich zu Freunden werdet.”
Dies war die erste Rede des Pythagoras in Kroton. Sie hatte die jungen Männer so stark beeindruckt, daß sie ihren Vätern davon begeistert erzählten. Daraufhin lud der „Rat der Tausend” — der Senat — den fremden „Weisheitsfreund“, wie er sich selbst im Gegensatz zu den „Sieben Weisen” der älteren Zeit nannte, ins Rathaus zu einer weiteren Ansprache ein. Pythagoras folgte der Einladung, den führenden Männern des Staates nützliche Ratschläge zu unterbreiten. Jamblichos berichtet darüber:
„Er riet ihnen zunächst, einen Musentempel zu errichten, um die Eintracht unter ihnen zu erhalten. Denn diese Göttinnen haben allesamt denselben Namen, man kennt sie in der Überlieferung nur als Gemeinschaft, sie freuen sich am meisten über gemeinsame Ehrungen, und überhaupt ist der Chor der Musen immer ein und derselbe. Außerdem umfaßt er Einklang, Harmonie, rhythmische Ordnung und alles, was Eintracht schafft. Auch erstreckt sich die Macht der Musen nicht nur auf die schönsten Gegenstände der Betrachtung, sondern auch auf die Symphonie und Harmonie des Seienden.”
Wieder ein Rätselwort, das den Kosmosophen Pythagoras verrät, der vom musisch-musikalischen Zusammenklang des Weltalls überzeugt ist: eine Anspielung auf die berühmt gewordene, durch die gesamte europäische Geistes- und Seelengeschichte fruchtbar nachwirkende, noch in den Werken Giordano Brunos, Johannes Keplers, Gottfried Wilhelm Leibniz’, Goethes, Hölderlins und Gustav Theodor Fechners widerhallende Lehre von der Harmonie des Kosmos und der Musik der Sphären, die nur begnadeten Eingeweihten vernehmlich ist. Dieser Gedanke wird bereits von Aristoteles dem Pythagoras zugeschrieben.
In seiner Rede vor dem Senat erläutert der aus der Ferne gekommene Philosoph seine Idee von der „Symphonie und Harmonie des Seienden” nicht näher. Ihre in alle Einzelheiten gehende Darlegung behielt er einem Kreis von ihm ergebenen Esoterikern vor. Sie war geistiges Krongut seines geheimen Bundes. Er erörtert desgleichen auch mit keinem Wort die mathematischen Beweise für diese Lehre von der Harmonie der Sphären, die im Denken der Pythagoreer eine so bedeutende Rolle spielte. Pythagoras begnügt sich mit einem allgemeinen Hinweis auf den kosmischen Ursprung jeglicher Ordnung und Harmonie, die, wie er ausdrücklich sagt, durch den Chor der Musen gestiftet und verbürgt werden. Ihnen sollen deshalb auch die Bürger einen Tempel weihen. Politik wird von Pythagoras im Kult der Musen begründet. Er rät den Krotoniaten, „einen Musentempel zu errichten, um die Eintracht zu erhalten”, denn der Chor der Musen, wie er hinzufügt, umfaßt „Einklang, Harmonie, rhythmische Ordnung und alles, was Eintracht schafft.” Der Oberhoheit der Musen unterliegen nicht nur „die schönsten Gegenstände der Betrachtung”, etwa die vom Geist des Dichters oder Philosophen geschauten und zur Sprache gebrachten Dinge, sondern auch „die Symphonie und Harmonie des Seienden”. Diese Worte des Pythagoras spielen deutlich auf seine in höchstem Maße „musische” Kosmologie an. So wie die irdische Musik eine Nachahmung der himmlischen Sphärenharmonie ist, so soll die Politik der Menschen nach den Gesetzen des von den Musen vollendeten Kosmos sich ausrichten.
Politik ist bei Pythagoras kosmisch fundiert. Der Kult der die Harmonie des Weltalls zum Tönen bringenden Zeus-Töchter soll auch der Polis, der Stadt als menschlichem Mikrokosmos, zur Eintracht verhelfen. Der Kosmos als wohlgeordnetes Gebilde erscheint als Urbild wohlgeordneter Staatlichkeit, und die mimetische Übereinstimmung beider Bereiche wird durch die Musen gewährleistet. In diesem Sinne steht Pythagoras, der auch eine Art von Musagetes ist, als mit Orpheus verwandte Gestalt vor uns. Orpheus, für alle Zeiten die Symbolfigur der friedenstiftenden Macht des Gesanges, war Sohn einer Muse; als seine Mutter wird Kalliope genannt, die vornehmste der neun Musen (Hesiod: Theogonie 79), als sein Vater Apollon. Wie Pindar (Pythische Oden 1,10) von den Musen sagt, ihre Macht sei so groß, daß bei ihrem Ertönen sogar der gewaltsame Kriegsgott Ares die Waffen fallen läßt, um in friedlichen Schlummer zu versinken, so wird von Orpheus berichtet, daß sein Lied die Zwietracht der Menschen wie die Wildheit der Tiere besänftigt habe und seinen bezwingenden Melodien selbst Bäume, Flüsse und Felsen sich einträchtig fügten. Der mythische Orpheus ist gleichsam die männlich-irdische Entsprechung der den Kosmos rühmenden, ihn erst recht eigentlich „kosmisierenden” Musen. Der geschichtliche Pythagoras hingegen erscheint uns als ein politischer Orpheus, als Musaget staatlich-bürgerlicher Harmonie, der das Wort Pindars ernst nahm: „Blind sind der Menschen Gedanken, wenn einer ohne die Musen mit Verstandeskünsten allein den Weg sucht.”
Der den Kult der Musen als Bürgschaft politischer Harmonie empfehlende Pythagoras setzt seine Rede an die Stadtväter von Kroton mit der Ermahnung fort:
„Fasset das Vaterland als ein Pfand auf, das ihr gemeinsam von der Mehrheit der Bürger empfangen habt. Verwaltet es daher so, daß eure Vertrauenswürdigkeit auf eure Erben übergeht. Dies wird gewiß dann eintreten, wenn ihr euch allen Bürgern gleichstellt und nur in der Gerechtigkeit etwas vor ihnen voraushabt.”
Er begründet abermals diese Forderung nach Gerechtigkeit mit einem Fingerzeig auf den Mythos:
„Denn im Wissen darum, daß jeder Ort der Gerechtigkeit bedarf, erzählen sich die Menschen den Mythos, Themis — die Göttin des Gesetzes — habe dieselbe Stellung neben Zeus wie Dike — die Göttin des Rechts — neben Pluton, dem Gott des Reichtums und Herrscher über die Unterwelt, und wie das Gesetz in den Staaten, damit derjenige, der nicht in Gerechtigkeit seinen Pflichten nachkommt, sich zugleich als Frevler am ganzen Kosmos erweise.”
Abermals fällt an bedeutsamer Stelle das Herzwort pythagoreischer Philosophie: „Kosmos”. Wiederum begründet der Samiote ein staatsbürgerliches Gebot mit Hinweis auf die Gesetze der Weltordnung. Wie im Olympos die Göttin Themis, wie im Hades die Göttin Dike und wie im ganzen Kosmos die Musen herrschen, so sollen Gerechtigkeit und Gesetz im Staat die Könige sein. Wer sich dagegen vergeht, ist nicht nur ein politischer Übeltäter und Schädling, sondern ein „Frevler am ganzen Kosmos”, ein Aufrührer gegen die Ordnung des Weltalls.
Das von Pythagoras kosmomythisch unterbaute Regierungsideal ist weder die Demokratie noch die Tyrannis, sondern eine aristokratische Republik. Pythagoreertum ist von allem Anfang an kämpferischer Elitismus, Bekenntnis zur Aristokratie im wörtlichen Sinne einer „Herrschaft der Besten”. Weder die Masse noch ein despotischer einzelner sollen regieren, sondern eine qualifizierte Elite von solchen, die, obgleich sonst allen Bürgern gleichgestellt, „nur in der Gerechtigkeit etwas vor ihnen voraushaben.” Diesem Staatsideal war der Orden verpflichtet, den Pythagoras gründete. Der Orden, der seine Lehren nicht jedem zugänglich machte, verstand sich als aristokratischer Geheimbund der Musischen, Wissenden und Gerechten.
Wie an die Jünglinge wendet sich Pythagoras auch an den Senat mit sittlichen Imperativen. Hat er den Jugendlichen Ehrfurcht vor dem Alter und Freundessinn gepredigt, so gebietet er den Erwachsenen eine strengere Ehemoral. Die Männer sollten ihre Kebsweiber entlassen:
„Sehet auch ernstlich darauf, daß ihr selbst nur eure eigene Frau kennt und daß die Frau nicht mit anderen das Geschlecht verfälsche… Beherzigt, daß ihr eure Frau wie eine Schutzflehende unter Trankopfern vom Herd aufgehoben und so im Angesicht der Götter ins Haus geführt habt.”
Auch mit dieser zweiten Rede fand der eben erst in Kroton Angekommene Beifall und Nachfolge, wie wir Jamblichos entnehmen können. Die Ratsherren entließen ihre Nebenfrauen, beschlossen die Errichtung eines Musenheiligtums und luden Pythagoras ein, im Tempel des Apollon zu den Knaben und in dem der Hera zu den Frauen zu sprechen.
Zu den noch unmündigen Knaben sagte Pythagoras unter anderem:
„Trachtet ernstlich nach der Bildung (paideia), die von eurem Lebensalter (pais, das Kind) ihren Namen hat. Wer als Knabe gut ist, dem fällt es leicht, sein Leben lang ein edler Mensch zu bleiben. Wer aber in der Kindheit nicht wohlgeraten ist, dem wird es später sauer, es zu werden und zu bleiben. Ja es ist vielmehr unmöglich, von einem schlechten Ausgangspunkt aus gut zum Ziele zu laufen.”
Abermals kommt Pythagoras, der ja in einem Tempel redet, auf die Götter und ihren Kult zu sprechen. Er erinnert daran, wie die Gottheiten vor allem den Kindern hold gesinnt seien. Ein Kind genieße das Vorrecht, jederzeit jeden Tempel betreten zu können. Es würde ja auch immer vorausgeschickt, wenn es darauf ankomme, von den Göttern außergewöhnlichen Beistand frommsinnig zu erflehen. Solcher Gnade müßten sie sich würdig erzeigen. Dies aber vermögen sie am besten dadurch, daß sie den Eltern ehrfürchtig folgen.
Den Frauen, die sich auf Geheiß des Senats im Heiligtum der Hera versammelt hatten, legte Pythagoras ebenfalls dar, wie sie die Götter am geziemendsten ehren können. Er beschwor sie mit eindringlichem Ernst, die lautere Gesinnung am höchsten zu schätzen und nur Opfergaben darzubringen, die sie mit eigener Hand und auf unblutige Weise zubereitet hätten. Wie Zarathustra, den er besucht hatte, und wie Empedokles, der später einer seiner Jünger wurde, empfand Pythagoras einen tiefen Abscheu vor der Befleckung menschlicher Hände und den Göttern geweihter Altäre durch Schlachtopfer:
„Was ihr der Gottheit spenden wollt, das bereitet eigenhändig und bringt es ohne Hilfe von Sklaven an die Opferstätte: Kuchen, Backwerk, Waben und Weihrauchkörner. Mit Mord und Totschlag ehret das Göttliche nicht.”
Es ist offenkundig, daß die pythagoreische Ächtung blutiger Opfer als kannibalischer Bräuche mit der Lehre von der Seelenwanderung zusammenhängt, mit der Idee einer Mensch und Tier umfassenden Gemeinschaft des Lebendigen, durch die dasselbe Blut kreist und die deshalb zu schonen sei.
Hoch dachte Pythagoras, der Apolliniker, von dem religiösen Genius des weiblichen Geschlechts. Die Frauen hielt er für das recht eigentlich zu wahrer Frömmigkeit befähigte, für das von Natur aus zu Götterverehrung bestimmte und selber göttlicher Verehrung würdige Geschlecht. Die vier weiblichen Lebensalter, so lehrte er, seien nicht umsonst nach vier Göttinnen benannt und ihnen zugeordnet:
„Der, den man den Allerweisesten nennt, der die Stimme der Menschen geschaffen und die Namen erfunden hat — war es nun ein Gott, ein Dämon oder ein göttlicher Mensch —, hat in der Erkenntnis, daß das Geschlecht der Frauen am tiefsten zur Frömmigkeit veranlagt ist, jeder Altersstufe den Namen einer Göttin gegeben: die Unverheiratete nannte er Kore, die Verheiratete Nymphe, die Mutter Meter, und die Großmutter in dorischer Mundart Maia …”
Kore, Nymphe, Meter, Maia — alle vier sind Namen göttlicher Wesen: Kore ist die jungfräuliche Tochter der Erdgöttin Demeter; Nymphen sind jene bräutlichen Gottheiten, die, nach Homer (Ilias 20, 4 ff.), „die schönen Haine bewohnen, die Quellen der Flüsse und die blumigen Triften”; Meter ist ein Ehrentitel der aus dem kleinasiatischen Bergland stammenden Magna Mater Kybele; und Maia, unter die Plejaden eingereiht, heißt die Mutter des Götterboten Hermes. Diese Gestalten ahmt, von Stufe zu Stufe fortschreitend, ein erfülltes Frauenleben nach; ja Pythagoras geht sogar so weit, das gesamte weibliche Leben für einen Götterdienst, ein hohepriesterliches Walten anzusehen.
Ähnlich wie in seinen drei vorangegangenen Reden äußert sich Pythagoras vor den versammelten Frauen schließlich zu ganz konkreten Fragen. Hierher gehören nicht nur die schon erwähnten Worte gegen blutige Opfer, in denen bereits der Vegetarismus seines Ordens anklingt, sondern auch seine Verurteilung von Luxus, Mißtrauen und Streit und seine vergeistigte Deutung des kultischen Reinheitsgebots. In manchen Tempeln galt die Vorschrift, daß sie nur von jenen betreten werden durften, die unmittelbar vorher einige Tage lang geschlechtlich enthaltsam gelebt hatten; zumindest sollte vor dem Opfer eine rituelle Reinigung die durch den Beischlaf erfolgte „Befleckung” bannen. Pythagoras hingegen bestritt die Gültigkeit dieser Übung. Aus den Armen des ihr angetrauten Mannes könne die Frau jederzeit noch am selben Tage vor die Altäre treten. Dies sei ihr göttliches Recht. Einer eigenen Sühnung bedürfe es nicht, denn sie sei rein, weil sie doch etwas getan habe, das sogar den Göttern heilig sei. Nur wenn sie ehebrecherisch verkehrt habe, dürfe sie den Tempel niemals betreten.
Pythagoras ist der einzige antike Denker, der nicht nur Mädchen und Frauen philosophisch unterwies, sondern auch zum „Guru” einer weiblichen Ordensgemeinschaft wurde, die gleichberechtigt neben dem pythagoreischen Männerbund wirkte. Jamblichos erwähnt insgesamt siebzehn Pythagoreerinnen namentlich. Bemerkenswert ist, daß etwa ein Drittel der von ihm genannten Frauen aus Sparta stammte oder mit Spartanern verheiratet war. Sparta war aber die einzige griechische Polis, in der die Frauen als dem Manne ebenbürtige Wesen galten. Die bedeutendste Pythagoreerin hieß Theano. Spätere Zeiten, die keinen Sinn für die Eigenart philosophisch angeleiteten bündischen Lebens mehr hatten, erfabelten eine sentimentale Liebesgeschichte, die sich zwischen dem alternden Pythagoras und der jugendlichen Krotoniatin Theano abgespielt habe. Bald wird sie als Schülerin, bald als Gemahlin oder auch als Tochter des Philosophen ausgegeben. Unter ihrem Namen wurden später neben Gedichten und Briefen auch Abhandlungen „Über die Frömmigkeit”, „Über die Tugend” und „Über Pythagoras” in Umlauf gebracht. Sie galt als Bewahrerin und Fortführerin pythagoreischer Lebensform und Geistesart. Clemens von Alexandrien, der um 200 nach Christus lebende Kirchenvater, erwähnt sie in seinen „Teppichen” (1, 16, 80) ehrfürchtig als „die erste Frau, die philosophiert und Gedichte geschaffen habe.” Er hebt auch hervor (ebd. 4, 7, 44), daß Theano von einem Fortleben der Seele nach dem leiblichen Tod überzeugt gewesen sei, indem er ihren Ausspruch zustimmend zitiert: „Es wäre ja das Leben ein wahrer Festschmaus für die Schlechten, die, nachdem sie gefrevelt haben, einfach sterben könnten; aber die Seele ist eben unsterblich.” Bewundernd stellt Clemens die Pythagoreerin Theano in eine Reihe mit vorbildlichen biblischen und griechischen Frauengestalten wie Judith, Esther und Susanna, Atalante, Makaria und Sappho. Sie beweise, so betont der Kirchenvater ausdrücklich, daß das weibliche Geschlecht in gleicher Weise wie das männliche der Vollkommenheit teilhaftig sein könne (ebd. 4, 19, 121).
Mit den vier Reden, in denen keimhaft und anspielungsweise seine Kosmosophie und Ethik enthalten sind, gewann Pythagoras die Sympathien der Bürgerschaft der griechischen Pflanzstadt Kroton. Alsbald scharte sich um den Eingewanderten, der weiterhin vor größeren und kleineren Gruppen Vorträge hielt, eine beträchtliche Gemeinde von Männern, Frauen und Epheben, der sich Einwohner anderer italischer Griechenstädte anschlossen.
Es konnte nicht ausbleiben, daß die Aktivitäten der Pythagoreer, insbesondere ihre betont aristokratischen Ambitionen, von Außenstehenden und politischen Gegnern mit Argwohn und schließlich erbitterter Feindseligkeit beobachtet wurden. Die enge Verbindung von Pythagoreertum und Adelspartei brachte den Orden in ernstliche Schwierigkeiten, als sich allenthalben sowohl demokratische als auch tyrannische Gegenbewegungen formierten. Die antipythagoreische Fronde führten teilweise Männer an, denen es nicht gelungen war, in den engsten Kreis des Bundes aufgenommen zu werden.
Im Jahre 490 stellte sich ein begüterter Mann an die Spitze des Aufbegehrens gegen die pythagoreische Aristokratie. Vor einem Haus, in dem sich Anhänger des Philosophen zu einer Feier versammelt hatten, rottete sich eine wütende Menge zusammen, die das Anwesen stürmte und anzündete. Sämtliche Festgäste, bis auf zwei, fanden den Flammentod. Dem greisen Pythagoras gelang es, mit seiner Familie nach Tarent zu fliehen. Dort lebte er einige Jahre unbehelligt. Große Teile der Mitglieder seines Bundes zerstreuten sich in Gebiete der Magna Graecia, wo ihnen die Herrschaft des Adels noch gesichert erschien. Hier suchten sie die Grundsätze des Bundes zu verwirklichen. Doch alsbald kam es auch dort zu ähnlichen Reaktionen wie in Kroton. Die Pythagoreer wurden allgemein verfolgt. Man bezichtigte sie fälschlicherweise, nach der Tyrannis zu streben, und stellte mit verhetzenden Schlagworten ihre esoterische Lehre als „eine Verschwörung gegen die Massen” dar (Jamblichos 260). Viele von ihnen flohen nach Hellas und möglicherweise auch in entferntere Länder. Denn manche Spuren pythagoreischen Denkens lassen sich später bei den Kelten, den Skythen in Südrußland und bei den im Gebiet des heutigen Staates Rumänien siedelnden Dakern nachweisen. Einer der ersten Schüler des Pythagoras, der Sklave Zalmoxis (oder Zamolxis), ging nach seiner Freilassung zu den mit den Dakern verwandten Geten und arrivierte dort zum Propheten, Gesetzgeber und höchsten Gott.
Als später in Tarent bürgerkriegsgleiche Wirren ausbrachen, mußte der greise Pythagoras nochmals ins Exil gehen. Der Philosoph fand seinen letzten Zufluchtsort in Metapontion, einer ehemaligen sybaritischen Pflanzstadt am tarentinischen Meerbusen. Aber auch dort kam es zu grausamen Ausschreitungen. Wieder massakrierte ein wütender Pöbel Pythagoreer, die sich in einem Hause versammelt hatten; nur wenige entkamen der Lynchjustiz, unter ihnen Pythagoras, der bald darauf starb. Nach Timaios von Tauromenion wurde Pythagoras neunundneunzig Jahre alt. Andere — meist spätere — Autoren geben ihm eine Lebensdauer von 75, 80, 82, 90, 104 oder sogar 117 Jahren. Sein Tod in Metapontion, wo er auch begraben sein soll, entbehrt nicht einer tiefen Symbolik. Dieser zutiefst apollinische Philosoph vollendete sein langes Leben in eben der Stadt, in der sich zwei große, noch zur Zeit seines Wirkens erbaute Apollontempel befanden; doch das Haus, das er zuletzt bewohnt hatte, widmeten die Metapontiner der Erd- und Muttergöttin Demeter, die vor allem von den Pythagoreerinnen verehrt wurde. Jamblichos sagt in seiner von mir schon wiederholt herangezogenen Pythagoras-Vita, die ich als ein evangeliengleiches Buch betrachte:
„Die Metapontiner behielten Pythagoras, auch als er nicht mehr unter den Lebenden weilte, im Gedächtnis, weihten sein Haus zum Heiligtum der Demeter und machten aus dem Gäßchen, an dem es stand, ein Musenheiligtum.”
Pythagoras war, wenn wir nicht allzu genau rechnen, ein Zeitgenosse Zarathustras, Konfuzius’, Buddhas, der Propheten Altisraels und des halblegendären römischen Priester-Königs Numa. Diese Gleichzeitigkeit hat nicht erst Karl Jaspers als „Achsenzeit” erkannt. Schon hundert Jahre vor ihm sprach der heute leider fast vergessene Münchner Geschichtsphilosoph Ernst von Lasaulx von dem „merkwürdigen Zusammentreffen” so herausragender Gestalten in einer Epoche tiefgreifender religiös-ethischer Wandlungen sowohl in Asien als im Mittelmeerraum.
Pythagoras gehört zu den Stiftern europäischer Geistigkeit. Der aristokratische Bundes-Gedanke, die kosmosophische Esoterik und der harmonikale Grundzug seiner Lehre haben ebenso wie die Seelenwanderungs- und Zyklentheorie und die ausgesprochene Frauenfreundlichkeit seines Ordens mächtig durch die Jahrtausende gewirkt. Diese Wirkungsgeschichte ist ein Thema für sich, das ich demnächst in einem eigenen Buch, an dem ich seit 1986 arbeite, ausführlich entwickeln werde. Sie gehört zu den erregendsten Abenteuern in der Welt der Ideen und beweist, daß Pythagoras zu den unveralteten, weil zu stets neuen Verwandlungen und Wiedergeburten drängenden Großmächten Europas zählt. Seine spirituelle Autorität wird alle Ideologien unseres Zeitalters überdauern. Sein Sternbild ist immer noch im Steigen begriffen. Ich vertraue in diesem Punkt auf das gelassene Bekenntnis des alten Goethe, der, auf seine Weise, zur Bruderschaft der Pythagoreer gehörte:
„Gewinnt auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrigbleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine andere Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Überzeugungen fragt, oder wo diese sich bei verbreitetem allgemeinen Licht auch wieder hervorwagen dürfen.”
(1987)
Sokrates
Das schöne Wagnis, den Tod vom Leben her zu verstehen
Sokrates allein, der uns glauben lassen könnte,daß der Mensch gottähnlich sei, predigtePhilosophie; alle anderen predigten nur ihrebeschränkten Systeme. Er lehrte die Menschen,daß Philosophie in jedem gesunden Kopfe,in jedem reinen Herzen wohne, und daßsie die Quelle einer allgemeinen undunzerstörbaren Glückseligkeit sei.
Frans Hemsterhuis (1721 - 1790)
Von dem geistreichen Amerikaner Emerson stammen die Worte: „Aus Platon kommen alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen werden.” Der britische Logiker, Mathematiker und Kosmologe Whitehead stimmte in diesen Hymnus ein, als er augenzwinkernd die gesamte europäische Philosophie eine Abfolge von Fußnoten zu den Platonischen Dialogen nannte. Dies gilt auch für Systeme, Bewegungen und Schulen, die in allgemeinen nicht zum „Platonismus” gerechnet werden. Ohne Platon keine Augustinus, kein Eckhart, kein Erasmus, kein Galilei, kein Rousseau, kein Kant, kein Schiller, kein Schopenhauer, kein Solowjow, kein Kardinal Newman, kein Heisenberg und auch kein Sigmund Freud. Der Sokrates-Schüler Platon war und ist Quelle, Vorbild und Archetyp auch dort, wo Wege gebahnt werden, die aus dem Bereich griechischer Metaphysik hinausführen sollen. Gibt es im Werk des Anti-Platonikers Nietzsche einen wesentlichen Gedanken, für den sich bei Platon keine Entsprechung aufweisen ließe? Sogar für den „Übermenschen”, den „Willen zur Macht” und die „Ewige Wiederkehr” lassen sich Pendants in den Dialogen des Griechen leicht finden. Vielleicht kann man sogar die Titelgestalt von „Also sprach Zarathustra” als einen trunkenen Sokrates mit antiplatonischer Maske begreifen. Wieviel bewußter, wieviel verschwiegener Platonismus steckt doch im antipositivistischen Affekt der „Frankfurter Schule”, vor allem in den Lehren Herbert Marcuses, oder auch — am andern Ende des geistespolitischen Spektrums — im Ganzheitsdenken Othmar Spanns!
Jeder von uns hat schon von Platon gehört, wohl auch irgendeinmal von „platonischer Liebe” geredet, häufiger freilich von irgendwelchen „Ideen” — damit einen der Grundbegriffe des Philosophen gedankenlos im Munde führend. Nachdenklichere ahnen höchstwahrscheinlich auch, daß sich hinter dem Namen Platon ein riesiger Erdteil verbirgt, ja ein ganzer Kosmos von Einsichten, Eingebungen und Grundsätzen, und daß es sich wohl lohnte, ihn zu erkunden und aus seinen Schätzen zu schöpfen. Haben nicht sogar noch in allerjüngster Gegenwart Georg Picht, Carl Friedrich von Weizsäcker, Günter Rohrmoser und der leider viel zu wenig als eigenständiger Sozialphilosoph gewürdigte Österreicher Ernst Karl Winter eindringlichst daran erinnert, daß hier, trotz jahrtausendelangen Abbaus, unerhörte Vorräte lagern, die planmäßig zu erschließen uns weiterbringen würde?
Platon zu lesen, gibt es somit manche Gründe. Ein letzter sei noch genannt, weil er die Brücke zu dem Band bildet, dessen Anschaffung und Lektüre hier empfohlen werden soll: Es gibt, vertrauenswürdigen Berichten zufolge, nach wie vor Männer und Frauen unter uns, die auf die Frage, mit welchem Autor man die letzten Stunden am besten bestehen könne, als einzigen Platon nennen. Welches seiner Werke aber könnte dafür angemessener sein als der Dialog „Phaidon”, in dem auch der sterbende Schriftsteller Charles Sealsfield geblättert hat? „Lest den ‚Phaidon’!” sagte noch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein Philosoph zu den Seinen, als er das Zeitliche segnete; und ein anderer zu sich selbst: „Ja, mit Sokrates muß es gehen.”
„Phaidon” — das Werk ist benannt nach einem der Lieblingsschüler des Sokrates. Er war zugegen, als der Meister im Jahre 399 vor Beginn der christlichen Zeitrechnung gelassen den Giftbecher leerte. Es war an einem frühen Abend; der Sonnenuntergang nahte zwar bereits, doch lag noch Licht auf den Bergen. Vorher aber hatte sich Sokrates gründlich gebadet, um „den Frauen keine Umstände zu machen, die Leiche zu waschen”. Als ihn der Vollstreckungsbeamte daran erinnerte, daß nun die Stunde des Abschieds gekommen sei, weinte er — nicht aber der Todeskandidat. Welcher Scharfrichter oder Kerkermeister kann zartfühlender sein als dieser namenlose Mann, der zum Verurteilten sagte: „Ich habe dich kennengelernt als den edelsten, sanftmütigsten und besten Menschen von allen, die jemals hierher gekommen sind, und auch jetzt weiß ich sicher, daß du mir nicht zürnst — denn du kennst die Schuldigen.”
Wenn man dies im „Phaidon” liest, denkt man unwillkürlich an die Hinrichtung eines anderen Unschuldigen, von der es im Lukas-Evangelium heißt: „Als der Hauptmann dies gesehen hatte, pries er Gott und sagte: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!” Dem Leser bleibe es überlassen, weitere Parallelen zu entdecken zwischen dem letzten Freundesgespräch des Sokrates, das Platons „Phaidon” überliefert, und den Abschiedsreden Jesu, wie sie die Johannes-Passion festhält. Es gibt deren mehrere, nur eine einzige Ähnlichkeit sei noch kurz erwähnt: das Unverständnis der Jünger, der griechischen wie der galiläischen. Mit einem Unterton bitterer Ironie sagt Sokrates, er hoffe, für seine ihm lauschenden Freunde überzeugender gewesen zu sein, als bei seiner Verteidigung für die ihm feindlichen Richter. Am Ende muß er illusionslos erkennen, daß trotz menschlicher Nähe und geistiger Anteilnahme nicht einmal der engste Kreis ihm vorbehaltlos zu folgen vermag. Damit vergleiche man das wehmütige Wort beim letzten Abendmahl: „So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?”
Diese Andeutungen mögen genügen, um den Rang des Platonischen Dialogs „Phaidon” zu kennzeichnen. Keineswegs soll der Sohn der Phainarete mit dem Sohn Marias, der seinem „Daimonion” getreulich folgende Sokrates mit dem menschgewordenen Gotteswort gleichgestellt werden. Nicht nur theologische Gründe verbieten ein derartiges Unterfangen, sondern schon ein von allen dogmatischen Rücksichten unbeeinflußter biographisch-physiognomischer Takt. Sokrates wurde nicht gefoltert und nicht gekreuzigt. Während der ans Marterholz genagelte Jesus seine Verlassenheit hinausschrie, behielt Sokrates bis zuletzt seine philosophische Ruhe und empfahl mit hintergründiger Heiterkeit, dem heilkundigen Gott Asklepios einen Hahn zu opfern. Üblicherweise tat man dies zum Dank für eine Genesung. Nietzsche unterstellte, daß der sterbende Sokrates damit angedeutet habe, das Leben als solches sei eine Krankheit, der Tod aber die gründlichste Kur. Das ist jedoch falsch. Nietzsches polemische Behauptung läßt sich gerade durch eine aufmerksame Lektüre des „Phaidon” (und der meisterlichen Einführung von Barbara Zehnpfennig zur jüngsten Ausgabe) entkräften.
Keiner Gleichsetzung von Sokrates und Jesus soll hiermit das Wort geredet sein, sondern bloß einer — wie der Fachausdruck lautet—„typologischen” Vergleichung. Diese aber hat ein langes und ehrwürdiges Herkommen. Sie reicht von dem frühchristlichen Apologeten und Märtyrer Justinus, der vor seiner Bekehrung Platoniker gewesen war, bis zu dem protestantischen „Magus in Norden”, Johann Georg Hamann aus Königsberg, dem Verfasser „Sokratischer Denkwürdigkeiten”, und dem rheinländischen Katholiken Ernst von Lasaulx, der als Sproß vom Stamme Schellings, Görres’ und Baaders in Würzburg und München lehrte. Sogar den erst 1974 verstorbenen kulturkonservativen Außenseiter Gerhard Nebel muß man diesem Chor zurechnen. Sie alle stimmen darin mit Theodor Haecker überein, daß es ein „adventistisches Heidentum” gab, zu dem neben Cicero, Seneca und Vergil auch Heraklit, Pythagoras und insbesondere Sokrates gehören. Mit Hamann sind sie davon überzeugt, „daß wir die Wolke dieser Zeugen nicht verachten sollen, daß sie der Himmel zu seinen Boten und Dolmetschern salbte, und zu eben dem Beruf unter ihrem Geschlecht einweihte, den die Propheten unter den Juden hatten.”
Man kann oft hören, daß Griechentum und Christentum, Jerusalem und Athen, attische Philosophie und biblischer Prophetismus zu den bleibenden Grundlagen europäischer Kultur gehören. Wenn diese fast zum geflügelten Wort gewordene Aussage keine unverbindliche Floskel sein soll, dann müßte wenigstens eine geistige Elite sich dazu aufraffen, neben dem „Gastmahl” und der „Politeia” auch Platons „Phaidon” zu lesen.
Der „Phaidon” findet sich selbstverständlich in allen deutschen Platon-Ausgaben. Deren berühmteste ist immer noch die Schleiermacher’sche. Die Patina, die seit längerem darüber liegt, verleiht ihr zwar einen gewissen nostalgischen Reiz, erschwert aber streckenweise das Verständnis des ursprünglichen Sinns. Moderner ist die Edition von Otto Apelt aus den zwanziger Jahren, die der Felix Meiner Verlag in anerkennenswerter Weise vor kurzem als wohlfeilen Reprint neu auf den Markt gebracht hat. Am wenigsten kostet wohl die kartonierte Einzelausgabe des Reclam Verlags.
Die allerjüngste Edition aber sei den anspruchsvolleren Platon-Lesern und Sokrates-Neugierigen ans Herz gelegt. Sie sei hier am meisten empfohlen — nicht weil sie der neueste Versuch einer „Phaidon”-Übertragung ist, sondern aufgrund ihrer qualitativen Vorzüge. Erstens enthält sie sowohl den griechischen Urtext als auch den deutschen Wortlaut. Zweitens zeichnet sich die Übersetzung — bis auf zwei oder drei Ausdrücke, bei denen man vielleicht eine andere Formulierung bevorzugen könnte — ebenso durch treffsichere Genauigkeit wie durch ansprechende Eleganz aus. Drittens ist hervorzuheben, daß die Übersetzerin Barbara Zehnpfennig eine mehr als dreißig Seiten umfassende Einleitung geschrieben hat, die mit energischen Strichen einige weitverbreitete Sokrates-Bilder gründlich berichtigt. Viertens hat sie dem Text weitere dreißig Seiten mit Anmerkungen beigefügt, die den Leser nicht nur über biographische und geistesgeschichtliche Details, mythologische Anspielungen und Dichterzitate gediegen unterrichten, sondern auch die philosophischen Grundaussagen des Dialogs sorgfältig freilegen. Und fünftens ließ sie sich’s nicht nehmen, den Band mit umfangreicher Bibliographie und gründlichem Register der Eigennamen wie Begriffe (griechisch und deutsch!) zu versehen. Dies sei ausdrücklich hervorgehoben, weil inzwischen sogar namhafte Verlage solche für wissenschaftliche Arbeit unerläßlichen Dienstleistungen entweder schludrig oder überhaupt nicht erbringen. Alles in allem kann man ohne Überteibung sagen, daß die jüngste Ausgabe des Meiner Verlags preiswert ist und es dem Käufer leichtmacht.
Das Lesen kann und will sie ihm natürlich nicht ersparen. Warum aber soll man Platon und ausgerechnet den „Phaidon” lesen, der ja, anders als das „Symposion”, so etwas wie eine philosophische Henkersmahlzeit darstellt? Um diese Frage zu beantworten, könnte ich auf das zu Beginn Gesagte zurückgreifen und mich auf viele autoritative Eideshelfer stützen. Whitehead und Emerson bilden ja nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges europäischer Platon-Begeisterung. Ich könnte von „Phaidon” als einem der großen Bücher der Weltliteratur sprechen, ihm kanonischen Rang bescheinigen, ihn als philosophischen Evergreen erweisen. Aber dies wäre nichts Neues, das hat man vielleicht schon zu oft getan. Der Deutsche, der Mitteleuorpäer des Jahres 1991 zeigt wenig Gewogenheit, abendländisch-kulturkonservativ tönenden Empfehlungen zu trauen. Der fernsehende, zeitunglesende und mit gräßlichen Tagesnachrichten gemästete Normalverbraucher, der, wie bekannt, das Gros unserer kritischen Intellektuellen stellt, wittert nichts als drohende Langeweile, wenn ihm jemand die Lektüre Platons oder auch Franz von Baaders zumutet. Deshalb sei nicht viel Zeit und Raum damit verschwendet, um zu beweisen, warum man eine fast zweieinhalb Jahrtausende alte Schrift mit Gewinn lesen kann. Was will es einem abgestumpftem Geschlecht schon besagen, daß die heiligen drei Könige durch einen Stern, der heilige Paulus durch einen Blitz, der heilige Augustinus aber durch ein Buch berufen wurde, durch den wunderbaren Weckruf: „Tolle, lege”, „Nimm und lies!” Warum noch lesen, außer um sich zu „informieren” oder um etwas zu „erleben” oder um „gebildet” zu scheinen?
Aber gibt es nicht noch ein ganz anderes, wenngleich seltenes, ein im wahrsten Sinne des Wortes „erlesenstes” Lesen? Die allermeisten Bücher lesen wir, wie gesagt, um uns zu unterrichten oder um uns zu unterhalten. Einige Titel aber sind rarer als Inkunabeln aus der Offizin des Aldus Manutius, weniger verbreitet sogar als Papyrusrollen aus Nag Hammadi oder Pergamente der Merowingerzeit. Es sind dies Bücher, die mit den andern eigentlich nur den Namen gemeinsam haben. Umgekehrt als die üblichen Bücher lesen nicht wir sie, sondern sie lesen uns. Es sind königliche oder, wie man in der vorchristlichen Antike anstandslos gesagt hätte, göttliche Bücher, die nicht nur von uns gelesen werden, sondern die in uns lesen und uns überhaupt erst zu Lesern anspruchsvollster Art werden lassen. Es ergeht uns in der Begegnung mit Büchern dieser kostbarsten Art ähnlich wie dem Dichter vor dem archaischen Standbild des Apollon: „… denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.” Man fühlt die einsetzende Verwandlung bisweilen sofort, meistens jedoch erst im Laufe der Lektüre. Möglicherweise ist es anfänglich bloß ein diagonales Lesen, dann wird es ein Schmökern, hin und wieder regt sich sogar halb belustigter, halb entrüsteter Widerwille: War Sokrates womöglich doch ein Verrückter? Wie kann ein reifer Mann seine letzte Stunde damit vergeuden, daß er begriffsstutzigen Jüngern Argumente für die Unsterblichkeit der Seele unterbreitet? Was soll die Darlegung der Ideenlehre und der Anamnesistheorie angesichts des Schierlingsbechers? Es sind dies naheliegende Einwände, und ich gestehe, daß sich auch mir solche spöttischen Fragen aufgedrängt haben.
Aber dann kommt alles ganz anders. Man versinkt und wird zugleich getragen. Man kommt sich selbst abhanden, entgleitet der eigenen Gewöhnlichkeit, schämt sich der vorlaut geäußerten Beanstandungen, wird demütig und ineins erhoben, beschwingt und leicht wie selten zuvor. Eben habe ich noch zu lesen geglaubt; mich hier und da über das Protokoll eines antiken Abschiedsgesprächs sogar lustig gemacht; mir desgleichen manches wiederholt, was seit Nietzsches Tagen kleinlich, herablassend, empört oder denunziatorisch dem alten Platon angekreidet worden ist. Schließlich hat der aufgeklärte Leser schon in jungen Tagen etliche Lektionen von Karl R. Popper, Ernst Topitsch und einigen andern Entlarvern der „philosophia perennis” erhalten. Das stimmt, und ich gebe auch heute noch zu, daß manches davon durchaus bedenkenswert ist. Insbesondere das, was der leider nur Verfassungsjuristen, Staatsrechtlern und Rechtstheoretikern bekannte Hans Kelsen (1881 - 1973) dem Platon am Zeuge geflickt hat, ist nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Dies alles sei zugegeben und auch an dieser Stelle mit Bedacht festgehalten. Aber im Vergleich zu den Augenblicken der Verwandlung, die dem hingerissenen „Phaidon”-Leser widerfuhr, hat solche Kritik plötzlich weniger Gewicht als früher. Eingangs bewunderte er vor allem die dialektische Wendigkeit des unermüdlichen Debatters Sokrates, der seine halb pythagoreisch, halb materialistisch infizierten Gesprächsteilnehmer wahrlich „unter-redet”, mit seinen logisch-axiomatischen Netzen und feingesponnenen Unterscheidungen niederringt Alsbald hörte diese Art von Bewunderung zwar nicht auf, doch wurde sie übertroffen von einem tiefer greifenden Erstaunen, jenem Erstaunen, das Sokrates selbst in einem anderen Dialog als Ursprung des Philosophierens bezeichnet hat.
Staunend begann der die „Phaidon”-Übersetzung von Barbara Zehnpfennig Lesende aufzuhorchen und zu horchen und nochmals zu horchen. Er lauschte dem Sokrates, während abendliches Sonnenlicht auf den Bergen rings um Athen lag. Luther soll gesagt haben, er würde auch dann noch ein Bäumchen pflanzen, wenn in der nächsten Stunde die Welt unterginge. Nun, Sokrates hatte einmal freimütig bekannt (horribile dictu!), daß ihm Bäume nicht sehr viel zu sagen hätten. Er pflanzte stattdessen Gedankenkeime in die Intelligenz Athens, vor allem aber jätete er kräftig das Unkraut der Gedankenlosigkeit aus. Bildung bestand für ihn nicht darin, möglichst viel zu wissen. Bildung heißt zuallererst: zu wissen, wovon man selber spricht und was man ständig stillschweigend voraussetzt, ohne es bewiesen zu haben, vielleicht auch ohne es jemals zu können.
Wunderbar sind die im Zusammenhang damit dargelegten Gedanken über die geistverderbende „Misologie” — was im Griechischen sowohl Rede- und Wortfeindschaft als auch Sinn- und Vernunftfeindschaft bedeutet. Wer dieser Geisteskrankheit, die jede sachbezogene Erörterung von vornherein verhindert, soweit wie möglich entgehen will, muß sich an Sokrates’ von ihm selbst bis zum letzten Atemzug vorgelebte Lebensregel halten: Bevor du den „logoi” — den Worten und Sinngehalten — Widersprüche unterstellst, suche diese in dir; wenn dir etwas unverständlich erscheint, dann sage nicht voreilig, daß es absurd sei, sondern gib vorerst einmal deinem eigenen Unverstand die Schuld. Wer dies einmal sich zu Herzen genommen hat, wird kaum behaupten wollen, daß das — von wenigen Schriften abgesehen — bei Platon durchgängig von Sokrates geübte Verfahren dialogischer Wahrheitssuche bloß ein artistischer Kniff sei. Sokratische Dialogik erscheint dann nicht als etwas Äußerliches, Zufälliges und Formales, sondern als Wesenszug der Philosophie dieses seltsamen Mannes, der — ähnlich wie Buddha, Pythagoras und Jesus — nur mündlich gelehrt, aber kein einziges Buch geschrieben hat. Das dialogische Vorgehen, in dem ein Menschlich-Allgemeines sich bis zu hellster Weißglut läutert, bringt Hölderlins schöner Vers auf die kürzeste Formel: „Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander.” Sokrates, der, wie Christus und Dionysos, bei Hölderlin immer wieder anwesend ist, manchmal namentlich ungenannt, aber bildkräftig beschworen:
Die ewigen Götter sind
Voll Lebens allzeit; bis in den Tod
Kann aber ein Mensch auch
Im Gedächtnis doch das Beste behalten,
Und dann erlebt er das Höchste.
Nur hat ein jeder sein Maß.
Denn schwer ist zu tragen
Das Unglück, aber schwerer das Glück.
Ein Weiser aber vermocht es
Vom Mittag bis in die Mitternacht,
Und bis der Morgen erglänzte,
Beim Gastmahl helle zu bleiben.
Diesem Sokrates horchte ich zu, wie einer Stimme, die zu mir spricht Mit einem Male verstand ich, was das skandalöse Wort bedeuten könne, daß die rechten Philosophen „nichts anderes betreiben als zu sterben.” Ich ahnte, was Sokrates wohl meint, wenn er, mythische Bilder aufgreifend, von den Läuterungsverfahren in der Unterwelt und von den „reinen Wohnungen” der Seligen spricht. Und unversehens kam mir wieder der Titel eines Buches von Herbert Keßler in den Sinn, das er dem in Bammental bei Heidelberg lebenden Betriebswirtschaftslehrer und Ordnungstheoretiker Walter Thoms in sokratischer Verbundenheit gewidmet hat: „Das schöne Wagnis” … Von diesem spricht nämlich der das irdische Leben halb feierlich, halb ironisch verabschiedende Sokrates. Nachdem er von Tempeln erzählt hat, in denen statt der Götterbilder wirkliche Gottheiten gegenwärtig, und von „schöneren Wohnungen”, die nach dem Tode den wahren Philosophen zugedacht seien, fügt er hinzu: „Schon um dessentwillen muß man alles tun, um an Trefflichkeit und Vernunft im Leben Anteil zu haben. Denn schön ist der Preis und die Hoffnung groß. Allerdings fest zu behaupten, daß sich das so verhält, wie ich es vorgetragen habe, gehört sich nicht für einen vernünftigen Menschen. Daß es jedoch diese oder eine ähnliche Bewandtnis haben muß mit unseren Seelen und ihren Wohnungen, da doch die Seele offenbar todlos ist, das scheint sich mir zu gehören und wert zu wagen, daß man glaube, es verhalte sich so — denn schön ist das Wagnis; und man muß sich damit wie mit Beschwörungen selbst heilen …”
Es ist auch ein schönes Wagnis, den uralten und immer wieder neuen, durch kundige Übersetzung erfrischend verjüngten, aber nirgendwo billig aktualisierten „Phaidon” zu lesen. Einer von dem hellenistischen Dichter Kallimachos festgehaltenen Legende zufolge hat sich einer der allerersten Leser dieses Platonischen Dialogs das Leben genommen, indem er ausrief: „Sonne, leb wohl!” Nun, er hat offenbar des Sokrates eigene Warnung überlesen, daß man nicht davonlaufen solle, da wir Menschen nicht uns selbst gehören, sondern den Göttern. Gewiß, Philosophie ist Sterbenlernen, Einübung in die ars moriendi, wie Sokrates mehrmals herausfordernd erklärt, wobei man ihn sich freilich nicht griesgrämig, sondern lächelnd vorstellen muß. Philosophie ist Sterbenlernen, das richtige Leben aber eines der Philosophie. Das bedeutet aber keineswegs Vorbereitung auf den Selbstmord als zerebraler Dauerauftrag. Es bedeutet auch nicht „Sein zum Tode” im Stil Martin Heideggers oder Weltflucht nach Art einer gnostizistisch verdrehten Asketik. Eher darf man dabei schon an „Euthanasie” im ursprünglichen und schuldlosen Wortverstand denken: an leichten Tod, der dankbar, gelassen oder auch neugierig empfangen wird, nachdem für den Grabstein zwei Inschriften erdacht worden sind — für die Vorderseite: „Einmal und nie wieder!”, für die Rückseite: „Nun geht’s erst richtig los!” Sowenig das apollinische Gebot „Erkenne dich selbst!” eine Aufforderung zu hypochondrischem auf der Lauer Liegen vor der Höhle des eigenen Befindens enthält, sowenig ist platonisch vermittelte Sokratik morbide Verliebtheit in den Tod. Sie ist, wie keinem genauen Leser entgehen kann, weniger eine abgesonderte Lehre mit genau festgesetzten Inhalten, denn eine kritische Methode, bereits angebotene Erklärungsversuche durch vernünftige Unterredung zu prüfen, zu ordnen und zu begründen. Und Philosophie als Einübung ins Sterben ist dann bloß eine drastische Formel für das, was die unaufgebbare Voraussetzung geistiger Kultur ist. Sie ist der Inbegriff eines von triebhaftem Zwang losgelösten, zur zuchtvollen Beherrschung (nicht Ausrottung) der unteren Mächte fähigen Lebens. Sie ist tätige Kontemplation, asketische Humanität, Aufbruch ins Wesentliche oder, wie man noch zu Goethes Zeit zu sagen wagte, die Bestimmung des Menschen, sofern er sich nicht damit begnügen will (und er kann es eigentlich gar nicht), bloß eine zoologische Spezies zu sein.
Sokrates, wie ihn Platons „Phaidon” zeichnet, verkörpert zum ersten Male in der uns bekannten Geschichte ein Menschentum, das einerseits vom heiligen Ernst unablässiger Wahrheitssuche, andrerseits von einer bis zuletzt sieghaften Heiterkeit erfüllt ist — wobei diese als zarteste und zugleich unbezwingbare Blüte philosophischer Anstrengung erscheint. Freudigen Ausdruck findet in ihr die lebensgeprüfte Erfahrung dessen, der jenseits der Angst steht, weil er einer gründenden Wahrheit gewiß ist, die, auch wenn das Schlimmste geschieht, von keiner Bosheit und Lüge getrübt zu werden vermag. Der in dieser Wahrheit gründende Märtyrer darf sagen: „Morior, ergo sum”, „Ich sterbe, also bin ich” — denn das, was sterben kann, ist gar nicht das im Gleichnis des „Ich” gemeinte Eine, Unversehrbare und Ewige. Was absterbend vergeht, ist nicht „Ich” und bin ich nicht. Tod bedeutet nicht Untergang, sondern Freilegung des ideenhaften Prinzips in uns. Wer den „Phaidon” aufmerksam liest, wird sich davon überzeugen können, daß Philosophieren in sokratisch-platonischem Stil, entgegen modernistischen Vorurteilen, nicht das geringste mit Weltverachtung, Leibfeindschaft und Todesdienst zu tun hat. Es nimmt allerdings, unabhängig von konfessioneller Bindung, das biblische Wort sehr ernst, das Luther so übersetzt hat: „Und was nutz hette der Mensch / ob er die gantze Welt gewünne / Und verlüre sich selbs / oder beschediget sich selbs?” (Lukas 9, 25) Solche Übereinstimmung gibt zu denken, wie bereits im vorangehenden angedeutet. Auch wenn es eine neuere Theologie nicht wahrhaben will, halte ich daran fest, daß Christentum und Platonismus, ungeachtet der verschiedenen Ebenen, nicht bloß durch einen absonderlichen Zufall jahrhundertelang Verbündete waren. Dies gilt keineswegs nur für die von griechisch-byzantinischem Geisteserbe durchsäuerte Welt der Ostkirche, sondern auch für den römisch-germanisch-keltisch geprägten „Westen”. Das beweisen Augustinus, Boethius, Johannes Scotus Eriugena, Anselm von Canterbury (der aus Aosta stammt), Pico della Mirandola, Leibniz, Novalis, Friedrich Schlegel, Maine de Biran, Othmar Spann, Amadeo Silva-Tarouca, Louis Lavelle, Michele Federico Sciacca und viele andere.





























