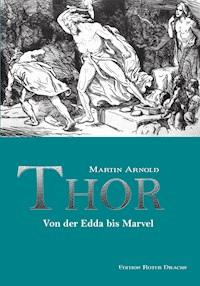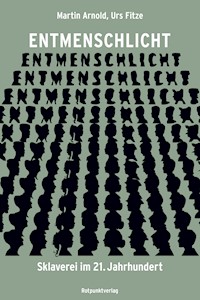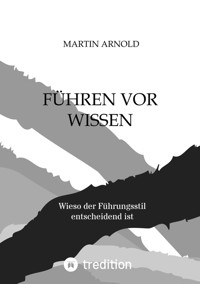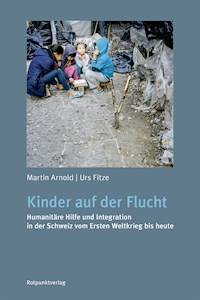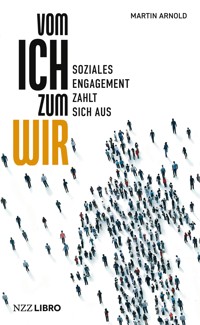
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Schweiz kommen mehr Stunden Freiwilligenarbeit zusammen als Stunden bezahlter Arbeit – ein ungeheures gesellschaftliches Potenzial. Eine Vielzahl von Menschen engagiert sich in Umweltschutz, Flüchtlingshilfe, Repaircafés, Selbsthilfe- und Sportgruppen, im Gesundheitsbereich. Um den Wert dieser Arbeit, aber auch um aktuelle Fragen geht es in diesem Buch. Was verändert sich in diesem Bereich? Verringert sich die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren? Was muss man tun, damit Freiwilligenarbeit attraktiv bleibt? Gibt es Geschlechterunterschiede, und, wenn ja, warum ist das so? In Zeiten des Klimawandels und grosser gesellschaftlicher Unsicherheiten, aber auch der künstlichen Intelligenz, die die Arbeitswelt verändert, steht der Freiwilligenarbeit eine interessante Zukunft bevor. Martin Arnold hat ein vielseitiges und gut lesbares Buch zu einem wichtigen Thema geschrieben. In lebendigen Darstellungen, zahlreichen Beispielen, Porträts und Interviews informiert es nicht nur über Hintergrund und Geschichte der Freiwilligenarbeit, sondern zeigt auch deren gesellschaftliche und emotionale Bedeutung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Freiwilliges Engagement macht mehr Menschen glücklich
Teil I: Hintergründe der Freiwilligenarbeit
Gemeinnutz: Engagement für «das grösste Glück der grössten Zahl»
Ein Blick in die Geschichte der Freiwilligenarbeit: Geld und Brot gegen gutes Gewissen
Teil II: Facetten der Freiwilligenarbeit heute
«Ich will Freude an der Bewegung vermitteln»: Engagiert im Behindertensport
Dorfchroniken: Geschichten erzählen als uralte Form der Freiwilligenarbeit
Brüder und Schwestern im Blute: Unterwegs im Blutspendezentrum
Kann Leben retten so einfach sein?
Erinnerungen an ein intaktes Dorfleben: Erhalt der Infrastruktur in Randregionen als Freiwilligenarbeit
Exkurs: Frauenemanzipation und gemeinnütziges Engagement
«Die Menschen wollen etwas bei sich verändern»: Selbsthilfegruppen als Arbeit an sich selbst
Eine Werkstatt für alle: Sharing als Wegweiser aus der Ressourcenknappheit
«Das ist genau das Richtige»: Tutorinnen und Tutoren für die alten Menschen im abgelegenen Tal
«Man lernt, den Blick vom Bauchnabel wegzulenken»: Der Service Citoyen als Bürgerdienst für alle?
Nervensache: Einsatz mit dem Care-Team
Engagement gegen Ungerechtigkeit: Junge Menschen engagieren sich für Geflüchtete
Zeitvorsorge: Jetzt spenden, später Zeit erhalten
Freiwillig als Panda unterwegs: Gespräch mit Linda Müller, verantwortlich für die Freiwilligenarbeit des WWF in beiden Appenzell, St. Gallen und Thurgau
Raus aus der Bubble: Eine lebendige Demokratie braucht Milizarbeit
«Wir wollen überzeugen, selbst wenn wir wütend sind»: Die Letzte Generation
«In kurzer Zeit sind 100 Artikel zu Burgen entstanden»: Wikipedia, die generische Wissensmaschine
«Mich fasziniert der intellektuelle Austausch»: Frauen dringend gesucht
«Freiwilliges Engagement ist wie dunkle Schokolade essen. Es macht glücklich»: Gespräch mit Cornelia Hürzeler vom Migros-Kulturprozent
Teil III: Freiwilligenarbeit und die Kraft der Emotionen
Emotionale Aspekte der Freiwilligenarbeit
Stolz, Scham und Schuld
Dankbarkeit
Sinnhaftigkeit und Streben nach Glück
Schlussbetrachtungen
Über das Buch
Martin Arnold
Vom Ich zum Wir
Soziales Engagement zahlt sich aus
NZZ Libro
Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Finanziert wurde das Buch durch:
Lotteriefonds St. Gallen; Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich;
Aargauische Gemeinnützige Gesellschaft, Wohlen; Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft, Appenzell; Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich, Zürich;
Steinegg-Stiftung, Herisau; Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau;
Grütli-Stiftung, Zürich; Dätwyler Stiftung, Altdorf; Temperatio Stiftung, Kilchberg;
Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger, Vaduz;
Verein für Gemeinwohl und Gemeinsinn, St. Gallen/Basel.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Covergestaltung: Eveline Arnold, Zürich
Lektorat: Anna Ertel, Göttingen
Korrektorat: Thomas Lüttenberg, München
Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz: 3w+p, Rimpar
Druck: Hubert & Co., Göttingen
Printed in Germany
Herstellerinformation: Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro, Grellingerstrasse 21, CH-4052 Basel, [email protected]
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, [email protected]
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor.
Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
ISBN Print 978-3-03980-004-9
ISBN E-Book 978-3-03980-005-6
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Vorwort
Freiwilliges Engagement macht mehr Menschen glücklich
Kann ein Staat, eine Gesellschaft erfolgreich sein, wenn das Gemeinwohl darin keine Rolle mehr spielt? Die meisten Leserinnen und Leser werden dies verneinen. Und doch wirken Begriffe wie Solidarität und Gemeinnutz heute wie aus der Zeit gefallen. Auf der anderen Seite engagieren sich auch gegenwärtig viele Menschen in Familie und Nachbarschaft, in Vereinen oder auch spontan in Projekten. Solidarisches Handeln bedeutet genau das: etwas tun, und zwar nicht aus Eigennutz, sondern im Dienst des Gemeinwohls.
Das vorliegende Buch möchte zeigen, dass uneigennütziges Tun populär ist. Und vor allem, dass Gemeinnutz ein gewaltiges Wachstumspotenzial hat. Bevor ich jedoch die «Aktie Gemeinnutz» dringend zum Kauf empfehle, möchte ich das Geschäftsmodell verständlich machen. Was ist Gemeinnutz respektive Gemeinwohl? Das Gemeinwohl ist das Gesamtinteresse einer Gesellschaft – im Unterschied zu Individual- oder Gruppeninteressen. Gemeinnütziges Handeln fördert das Gemeinwohl, und das bedeutet auch, dass die verschiedenen Interessen ausbalanciert werden müssen.
Bis vor wenigen Jahrhunderten waren die Menschen sich selbst und der freiwilligen Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen überlassen. Dann begannen Zünfte und Gilden, ihren hilfsbedürftigen Mitgliedern zu helfen, und schliesslich initiierten die ersten Ärzte, Geistlichen und Lehrer Vereinigungen mit dem Ziel, Hilfsbedürftigen zur Seite zu stehen. Es bahnte sich eine neue Form der Aufklärung an: eine Kultur des Hinschauens und des Tätigwerdens angesichts des wachsenden Elends, das die beginnende industrielle Produktion und die Landflucht verursachten. Dass Solidarität seither institutionalisiert ist, bedeutet jedoch nicht, dass der einzelne Mensch aus seiner Mitverantwortung entlassen wäre.
Die sich im 19. Jahrhundert weiterentwickelnde Hilfstätigkeit führte zur Gründung von Versicherungen, professionellen Feuerwehren, Rettungsteams und vielem mehr. Hilfe wurde zunehmend organisiert, systematisiert und mit einem monetären Gegenwert versehen, sie entwickelte sich so zu einem Teil des wirtschaftlichen Lebens. Früher bedeutete eine zerstörerische Lawine aus Schnee oder Schlamm, eine Feuersbrunst oder eine Überschwemmung vor allem eines: die Vernichtung der Existenz – so wie wir es heute noch bei Naturkatastrophen in der Dritten Welt erleben. Gewiss: Die Unversehrtheit an Leib und Leben kann uns auch heute niemand garantieren. Aber es gibt die Zusicherung von Staat und Gesellschaft, im Fall einer Katastrophe sofort zu helfen, wodurch die materielle Grundlage des Lebens weiter besteht. Genau dazu braucht es institutionalisierte Hilfe. Es braucht Helferinnen und Helfer, die am Tag nach der Katastrophe nicht bereits wieder abziehen, und es braucht eine Zukunftsperspektive für die Betroffenen. Diese organisierte Hilfskaskade betrachten viele als selbstverständlich. Wir zahlen Steuern und halten dies für eine Art Ablasshandel mit dem Staat. Er kümmert sich um alles – wir nur um unser Vergnügen. Die Not wird nur dann ein Thema, wenn ihr Anblick uns stört.
Dieses Buch beschäftigt sich auch mit der Frage, ob die organisierte Solidarität die private Hilfsbereitschaft erlahmen lässt, und es plädiert für eine Wechselbeziehung zwischen den beiden. Niemand kann sagen, dass ihn die Not der anderen nichts angehe, es werde schon geholfen, von welcher Seite auch immer. «Das Erste, was wir aus der Katastrophe gelernt haben, ist, dass die ersten drei bis fünf Tage allein mit Nachbarschaftshilfe überstanden werden müssen. Der Staat kann gar nichts machen. Er kann nicht einmal zu den Quellen der grössten Not vordringen.» Der Mann, von dem diese Sätze stammen, arbeitete als Führer im Hanshin-Awaji-Erdbeben-Gedenkmuseum der japanischen Hafenstadt Kobe. Dort bebte 1995 mit einer Stärke von 7,3 Magnituden die Erde. 4.500 Menschen verloren ihr Leben, 61.000 Gebäude wurden völlig zerstört. Warum war (staatliche) Hilfe in dieser Situation unmöglich? «Die Feuerwehrmänner kamen nicht zu ihren Stützpunkten, Menschen verloren die Orientierung, weil sich die Geografie der Stadt in Sekunden völlig veränderte, gegen den Strom von aus der Stadt Flüchtenden konnte man nicht ankämpfen», erinnert sich der Mann, der das Beben überlebt hat. Er erinnert sich aber auch an ein weiteres grosses Problem. «Es kamen in zwei Tagen über eine Million freiwillige Helferinnen und Helfer. Wir konnten nicht so viele einsetzen. Sie waren ja nicht ausgebildet und wurden zur zusätzlichen Last, weil wir sie ernähren mussten.» Nützlich sind Freiwillige nur dann, wenn sie auch benötigt werden bzw. sinnvoll eingesetzt werden können. Zentral war und ist in solchen Situationen hingegen die unmittelbare Nachbarschaftshilfe. Das war auch bei dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2023 nicht anders. Diese Erfahrung zeigt: Der Staat kann nicht alle Probleme lösen.
Eine weitere Erkenntnis ist, nebenbei bemerkt, die, dass in Katastrophensituationen die unterschiedlichen Charaktere der Menschen deutlicher als sonst in Erscheinung treten. Da gibt es Menschen, die kaum mehr schlafen und stattdessen helfen, wo sie nur können. Es gibt aber auch Menschen, die solche Situationen ausnutzen. Als ich am 23. Juni 2001 in der südperuanischen Metropole Arequipa in ein noch stärkeres Erdbeben als jenes in Kobe geriet, war das Chaos unbeschreiblich, aber auch die Hilfsbereitschaft – sowie die Schlitzohrigkeit beispielsweise der Taxifahrer, deren Tarife sich innerhalb einer Minute verzehnfachten. Zwar haben die meisten Menschen zuerst die Sicherheit der eigenen Familie im Sinn, doch schon der zweite Blick gilt oft den Nachbarn und der näheren Umgebung. Es zeigt sich hier bei vielen eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft, die sich entfalten möchte – genauso wie bei anderen eben die eigene kriminelle Energie zum Tragen kommt. So glasklar erkennbar werden die verschiedenen Charaktere wie gesagt nur in Ausnahmesituationen.
Weil das Gemeinwohl für einen modernen Staat so wichtig ist, hat sich die Professionalisierung der Hilfeleistungen verstärkt. Dazu gehören notwendig Organisationsstrukturen und ein gewisses Mass an Verwaltung. Dadurch ist auch die Distanz jedes Einzelnen zum aktiven Einsatz für das Gemeinwohl grösser geworden. Unsere Kleinkinder sind in Krippen, unsere Kinder in Schulen, die Kranken und Verunfallten in Spitälern und die Alten in Altersheimen untergebracht. Um die Armen kümmert sich die Sozialhilfe, Brände löscht die Feuerwehr, aus der Seenot rettet uns die Seepolizei, die Verteidigung übernimmt die Armee, Diebstahl verfolgt die Polizei, um den Verlust kümmert sich die Versicherung, und wenn wir uns verantwortungslos bei schlechtem Wetter im Gebirge verirren, rettet uns die Rega.
Was uns beschäftigt, ist allenfalls die Frage, wie sogenannte Schmarotzer von dieser für uns selbstverständlich gewordenen Hilfe ferngehalten werden können. Doch wer ein soziales System ausnutzen will oder sich pausenlos über jene Gedanken macht, die es ausnutzen könnten, hat das Wesen der Solidarität aus den Augen verloren. Solidarität verlangt, sich in andere einzufühlen, um den Betroffenen mit der richtigen Hilfe die Möglichkeit zu geben, sich selbst und später wiederum anderen zu helfen. Die professionelle, institutionalisierte Hilfe hat die Einsatzgebiete der früheren, komplett idealistischen Freiwilligenhilfe übernommen, ohne Letztere dadurch infrage zu stellen. Für Menschen, die sich engagieren, haben sich immer wieder neue Handlungsfelder aufgetan. Es gibt unendlich viele Gründe, die für einen persönlichen Einsatz zum Wohl anderer sprechen, und es gibt nichts, was dagegen spricht. Warum müssen wir uns trotzdem Gedanken darüber machen, wie wir es anstellen, dass freiwilliges Engagement eine kontinuierlich sprudelnde, niemals versiegende Quelle bleibt? Wie kann es gelingen, Menschen, die nie damit in Berührung gekommen sind, von der persönlichen Bereicherung durch freiwillig geleistete Arbeit zu überzeugen?
Dieses Buch möchte nicht nur den längst verwischten Spuren der Ursprünge der Freiwilligenarbeit nachgehen, sondern anhand zahlreicher Beispiele vor allem die heutige Situation beleuchten und versuchen, daraus Perspektiven für die weitere Entwicklung abzuleiten. Denn eines ist sicher: Auch die zukünftige Gesellschaft wird ohne das Engagement Freiwilliger nicht auskommen. Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind so gross wie noch nie. Die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg haben uns ein trügerisches Gefühl der Sicherheit und der Lösbarkeit aller Probleme sowie der Organisierbarkeit aller Massnahmen zur Linderung von Not vermittelt. Aber wir stehen auf dünnem Eis. Das haben viele Menschen in den letzten Jahren begriffen. Das vorliegende Buch beschreibt solidarisches Handeln im professionellen, aber auch im privaten Rahmen. Niemand weist den Nachbarn fort, wenn dessen Haus weggeschwemmt oder Opfer einer Feuersbrunst geworden ist. Doch Solidarität fängt schon an, wenn es darum geht, einer alten Frau im Bus Platz zu machen. Nebenbei bemerkt: Viele Jugendliche tun dies – entgegen ihrem Ruf. In einem Artikel konstatierte die deutsche Wochenzeitung Die Zeit gar eine Rückkehr der Spenden- und Hilfsbereitschaft und vermutete dahinter «die Sehnsucht, einen Humanismus praktizieren zu können»1. In diese Richtung weisen auch sozialpsychologische Untersuchungen. In Spielsituationen, in denen die Teilnehmenden verdeckt einen Geldbetrag in einen Gemeinschaftstopf werfen können, woraufhin der Betrag verdoppelt wird, oder aber als Trittbrettfahrer das Geld behalten können, um am Ende zusätzlich vom Gemeinschaftstopf zu profitieren, entscheidet sich die Mehrheit für die solidarische Variante. Die Soziologie spricht hier von einem experimentellen Dilemmaspiel.2
Der Neuenburger Philosoph Denis de Rougemont meint sinngemäss, dass die Wiederherstellung einer gemeinschaftsfördernden gesellschaftlichen Umwelt notwendig sei, um Menschen von der Einsamkeit zu befreien. Darauf, dass der Mensch in erster Linie ein soziales Wesen ist, spielt auch der Schweizer Publizist und Philosoph Ludwig Hasler an, wenn er sagt: «Man kann in einem Theaterensemble seine Rolle nur gut spielen, wenn auch die anderen ihre gut spielen können.»3 Das ist kein billiger Aufruf zu engagierter Nächstenliebe, sondern eine Erinnerung daran, dass jeder Mensch am Anfang seines Lebens Solidarität erfahren hat, sonst hätte er als Säugling nicht überlebt. Jeder Mensch wird gefüttert, gewickelt und getröstet. Die Eltern stellten dies nie in Rechnung. Vielleicht ist diese Erkenntnis, dass es ohne Solidarität einfach nicht geht, ein Grund dafür, dass soziales Engagement und tatkräftige Hilfe trotz Individualisierung, Konsumexzessen und Social Media immer noch verbreitet sind (Vielleicht ist das Phänomen Social Media nur eine Ablenkung, die, wie Psychopharmaka, hilft, über lange Zeit ein falsches Leben erträglich zu machen. Erst der Verzicht öffnet dann den Blick dafür, was besser gemacht werden kann).
Freiwilliges Engagement lässt sich differenzieren: Es gibt die freiwillige Arbeit für die Allgemeinheit, die der ausübenden Person höchstens indirekt als Beitrag zu einer stabilen Gesellschaft nützt. Auch in dieser selbstlosen Variante des Engagements steckt jedoch mitunter Eigennutz: Jemand engagiert sich vielleicht, weil die helfende Tätigkeit eine Kompetenzerweiterung verspricht. Der freiwillige Einsatz kann zur Beziehungspflege genutzt werden und karrierefördernd sein oder er erweitert schlicht den Horizont. Diese und weitere Motive sind völlig legitim: Niemand sollte sich zum alleinigen Nutzen anderer aufopfern. Neben dieser Form der Freiwilligenarbeit gibt es auch das nicht immer oder nicht im vollen Umfang freiwillige Engagement für andere – beispielsweise im Kreis der Familie. Wenn die erwachsene Tochter eine Betreuung für ihr Baby braucht oder die Schwiegermutter Pflege, beugen sich die Hilfeleistenden meist den familiären Erwartungen oder setzen sich selbst unter Druck, dieses oder jenes zu leisten. Unbezahltes Engagement contre cœur führt auf Dauer jedoch zum unguten Gefühl, ausgenutzt zu werden. Dagegen sollten sich Betroffene wehren. Es gibt aber auch eigennützige Gratisarbeit, die sich direkt auszahlt: Wenn ich Fussball spielen will und es über Nacht überraschend geschneit hat, greife ich eben zur Schaufel – und anschliessend können alle spielen. Das ist der direkte Lohn.
Zu unterscheiden sind darüber hinaus Freiwilligenarbeit und Ehrenamt. Ein Ehrenamt ist zwar Freiwilligenarbeit, aber die Freiwilligen werden in ihr Amt, beispielsweise den Vorstand eines Vereins, gewählt. Ein Ehrenamt ist meist mit mehr Prestige verbunden. Solche Freiwilligen engagieren sich oft jahrzehntelang in einer Organisation. Sie sind unverzichtbar für ein funktionierendes Vereinswesen in einem Land. Genauso wichtig sind aber die spontan Engagierten, die sich beispielsweise bei Naturschutzeinsätzen engagieren oder Geflüchteten Deutschunterricht geben. Kurzzeitige Einsätze sind für junge Leute oft der Einstieg in ein regelmässigeres Engagement. Dieser Bereich, zu dem auch Crowdfunding-Projekte zählen, zeichnet sich durch eine hohe Innovationskraft aus. Crowdfunding-Plattformen bilden eine bunte Mischung von Eigennutz und Gemeinnutz, oft lässt sich beides auch nicht genau voneinander trennen.
Schliesslich gibt es innerhalb des Freiwilligensektors, also bei Non-Profit-Organisationen wie Caritas, WWF, Pro Natura, dem Roten Kreuz, der Berghilfe, aber auch bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) und anderen Organisationen, auch die bezahlte Mitarbeit. Es kann als Kompliment für die geleistete Arbeit betrachtet werden, wenn eine Organisation, an deren Ursprung das freiwillige Engagement von Idealisten stand, wächst und deshalb auch eine professionelle Führung braucht. Das heisst aber umgekehrt nicht, dass nicht auch freiwillig Engagierte einen professionellen Beitrag für ihre Organisationen leisten. Sie werden sogar immer professioneller, und die damit einhergehenden steigenden Ansprüche vieler Organisationen generieren ein Problem, das auch in diesem Buch behandelt wird. Denn die helfenden Tätigkeiten der Hunderttausenden von Freiwilligen im Land geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind, wie jeder Arbeitsalltag, eingebettet in ein Korsett von Gesetzen und Verordnungen.
In der Literatur werden verschiedene Begriffe für Freiwilligenarbeit oder freiwilliges Engagement verwendet. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass diese Dienste freiwillig und autonom sind, selbst oder institutionell organisiert, aber nicht dem eigenen Nutzen dienen. Freiwilligenarbeit ist meist öffentlich sichtbar, wirksam und nachhaltig, steht aber nicht unter staatlicher Kontrolle. Ausgenommen ist die Care-Arbeit in der Familie oder der Nachbarschaft, die deutliche mehr von Frauen geleistet wird und weniger sichtbar ist. Die Freiwilligenarbeit dient durchaus der Wertschöpfung, folgt aber nicht der klassischen ökonomischen Logik. Sie ist modern, weil sie den Weg in eine zukünftige Sorgeökonomie weist. Sie ist zwar unbezahlt, liesse sich aber monetarisieren. Oftmals werden nur Spesen entschädigt.
Dieses Buch möchte einen grundsätzlichen Blick auf freiwilliges Engagement werfen und aufzeigen, wie es mit neuer Kraft erfüllt werden kann und wohin es sich entwickeln könnte. Denn der Klimawandel und die damit verbundenen sozialen Verwerfungen werden den Bedarf an freiwilligem Engagement noch ansteigen lassen. Engagement lohnt sich: Wer es eingeht, spürt, dass er das Richtige tut. Doch ein Missverständnis muss an dieser Stelle unbedingt ausgeräumt werden: Care-Arbeit – beziehungsweise freiwillige Arbeit oder Engagement oder wie immer man unbezahlte Arbeit für andere bezeichnen möchte – darf niemals Behörden, Institutionen und Regierungen als Alibi dienen, sich selbst aus der Fürsorgeverantwortung gegenüber den Bürgern davonzustehlen. Denn das wäre ein verheerender Rückschritt in der Geschichte und würde dem Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) recht geben, der angesichts der seinerzeit aufblühenden gemeinnützigen Tätigkeit vieler Gesellschaften sagte: «Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade.»
Für die Unterstützung bei der Realisierung des Buches möchte ich folgenden Stiftungen und Institutionen danken: Lotteriefonds St. Gallen; Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Zürich; Aargauische Gemeinnützige Gesellschaft, Wohlen; Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft, Appenzell; Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich, Zürich; Steinegg-Stiftung, Herisau; Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau; Grütli-Stiftung, Zürich; Dätwyler Stiftung, Altdorf; Temperatio Stiftung, Kilchberg; Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger, Vaduz; Verein für Gemeinwohl und Gemeinsinn, St. Gallen/Basel.
Endnoten
1Artikel «Die Sehnsucht nach dem Humanen» von Iris Radisch, veröffentlicht in der Wochenzeitung «Die Zeit» am 5. 12. 2013.
2Hintergrundinformationen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Tragik_der_Allmende (abgerufen am 27. 9. 2024).
3Ludwig Hasler, Vortrag Kirche St. Laurenzen, St. Gallen, 20. 10. 2020. «Wie die Krise den Gemeinsinn stärken kann».
Teil I:
Gemeinnutz: Engagement für «das grösste Glück der grössten Zahl»
Wieso ein Buch über den Gemeinsinn? Wieso Freiwilligenarbeit ins Zentrum rücken? Wer will, hilft, wer keine Lust hat, lässt es bleiben. So einfach ist das. Menschen helfen einander, seitdem es Menschen gibt – ohne Geld und Gegenleistung, einfach, weil jemand Hilfe braucht. Weil Menschen von Grund auf gut sind. Diese Hilfsbereitschaft wird heute teilweise überdeckt, irregeleitet, entwertet oder monetarisiert. Oft aber ist sie noch da: kristallklar und zukunftsweisend.
Der Gemeinsinn ist ein Bestandteil jenes Kitts, der die Gesellschaft zusammenhält. Die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren, nimmt tendenziell leicht ab – vor allem aber verändert sich die Vorstellung, die wir von Freiwilligenarbeit haben, wie Umfragen und Studien zeigen. Ist Solidarität, die dem Gemeinwohl dient, «uncool»? Beim Engagement für eine Sache geht es um mehr als nur Spass. Es geht um Grundsätzliches: Kann, wie eingangs gefragt, eine Gesellschaft erfolgreich sein, wenn das Gemeinwohl keine Rolle mehr spielt? Bei der Antwort auf diese Frage lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Denn freiwilliges Engagement ist weiterhin populär, auch bei jungen Menschen. Vorausgesetzt, sie können die Zeit dafür aufbringen und finden das richtige Thema.
In der Schweiz engagieren sich 35 Prozent der Frauen und rund 40 Prozent der Männer, wobei die Frauen diese Differenz mit Haus- und Care-Arbeit mehr als kompensieren. Das Engagement ist etwas höher in der Deutschschweizer Wohnbevölkerung, bei Menschen über 60, in ländlichen Gebieten und in Haushalten mit höherem Einkommen. Die durchschnittlich investierte Zeit beträgt mehr als drei Stunden pro Woche.4 Freiwilliges Engagement ist auch bei der ausländischen Bevölkerung durchaus beliebt. Populär sind Sportvereine und der soziale Bereich. Dabei engagiert sich die ausländische Wohnbevölkerung weniger im formellen (8,3 Prozent) als im informellen Bereich (17,5 Prozent).5 Formelle Freiwilligenarbeit ist streng genommen eine Sonderform, weil sie mit Honoraren, Sitzungsgeldern oder pauschalen Vergütungen entschädigt wird – im Gegensatz zur informellen Freiwilligenarbeit, für die kein Geld fliesst. Wie bei der Schweizer Bevölkerung ist es bei der ausländischen Bevölkerung die Generation der über 60-Jährigen, die in ihrer Freizeit häufiger für das Gemeinwohl arbeitet als die jüngeren Generationen. Wobei junge Ausländerinnen und Ausländer proportional weniger engagiert sind als ihre Schweizer Altersgenossen. Interessant ist bei dieser Teilanalyse des Schweizerischen Freiwilligen-Monitors von 20206 der Wunschbereich, in dem sich die befragten Ausländerinnen und Ausländer gerne betätigen würden. Fast die Hälfte würde gerne im Bereich Umwelt- und Tierschutz helfen. Wie sie dazu gebracht werden können, ist Teil der Ansprachestrategie, mit der sich Hilfsorganisationen intensiv beschäftigen.
Ein Engagement für das Gemeinwohl bringt Stabilität und Struktur, vermittelt aber auch das Gefühl, nicht tatenlos zuzusehen, wie im 21. Jahrhundert viele Gewissheiten verloren gehen. Grenzen wurden und werden verschoben, beileibe nicht nur geografische: Grenzen unseres Wirtschaftens, unseres Zusammenseins, der Traditionen und der Glaubensgrundsätze sind genauso betroffen. Vielleicht treten wir in ein Zeitalter ein, in dem zwischenmenschliche Zuwendung neben dem Glauben an welche Kraft auch immer einen besonders wichtigen Orientierungspunkt bildet. Das lässt sich auch im Hinblick auf die Coronapandemie feststellen. Während der ausserordentlichen Lage verringerte sich das Engagement zuerst massiv. Die vulnerable Gruppe der über 60-Jährigen lebte in Isolation, obwohl dies normalerweise die Gruppe mit dem höchsten Anteil an freiwilligem Engagement ist. Allerdings war der Rückgang des freiwilligen Engagements auch bei den Jungen markant, weil Pfadfinder oder Sportvereine ihren Betrieb vorübergehend einstellten. Dafür nahm die Betreuung und Hilfe bei der Pflege und Versorgung von Seniorinnen und Nachbarn deutlich zu. Es waren vor allem Frauen und Personen mit höheren Bildungsabschlüssen, die sich hier stärker engagierten. Trotz der massiven Lebensveränderungen hat die Gesellschaft die neuen Bedürfnisse in dieser Situation schnell antizipiert: Die informelle Nachbarschaftshilfe funktionierte, und wo der Bedarf gross war, war es auch das Engagement.
Menschen sind bereit, etwas zu tun. Dies ist zumindest die Schlussfolgerung der Autoren Markus Lamprecht und Hanspeter Stamm, die im Auftrag des Migros-Kulturprozents die Auswirkungen von Covid-19 auf die Freiwilligenarbeit untersuchten.7 Der Freiwilligen-Monitor 2020 spiegelt weder die Auswirkungen der Coronapandemie noch des Ukrainekriegs noch der jüngsten Klimakapriolen; dennoch ist er aufschlussreich. Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren sind Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation. Über 60 Prozent machen dort aktiv mit. Die meisten Mitglieder zählen die Sportclubs, gefolgt von Spiel-, Hobby- und Freizeitvereinen sowie Kirchen oder kirchennahen Organisationen. Während die Gesamtbeteiligung in diesem Bereich relativ stabil oder nur leicht rückläufig ist, verändert sich die Verteilung: Die Freiwilligkeit nimmt bei Sport und Interessenverbänden ab, im Hobby-, Spiel- und Freizeitbereich sowie im sozialen und karitativen Bereich nimmt sie hingegen zu. Die geburtenstarken Jahrgänge sind nun in jenem Alter, in dem auch das Freiwilligenengagement besonders hoch ist, sodass dies auch erklären könnte, warum insgesamt kein Rückgang der Freiwilligenarbeit zu verzeichnen ist. Laut Analyse des Freiwilligen-Monitors ist das Potenzial in dieser Gruppe mittlerweile ausgeschöpft.
Männer bevorzugen die formelle Freiwilligenarbeit, die wie erwähnt oft entschädigt wird. Hingegen wird informelle Freiwilligenarbeit, insbesondere Care-Arbeit (etwa Betreuung, Hütedienste und Pflege), für die kein Geld fliesst, häufiger von Frauen geleistet. Diese Arbeit ist gesellschaftlich weniger sichtbar, und nach klassischer Interpretation gilt Care-Arbeit – obwohl vollkommen unbezahlt – nicht als Freiwilligenarbeit im eigentlichen Sinne. Sie ist aber notwendig. Deshalb wird immer häufiger mit Modellen experimentiert, die eine Bezahlung dieser Arbeit vorsehen. Denn was Frauen zu Hause, in der Familie, Verwandtschaft und Nachbarschaft leisten, entlastet das ganze Sozialwesen enorm. 72 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren leisten pro Jahr mindestens einmal eine solche Hilfe.