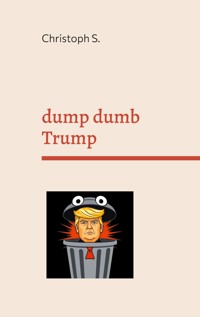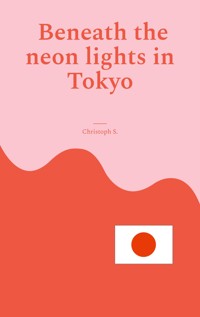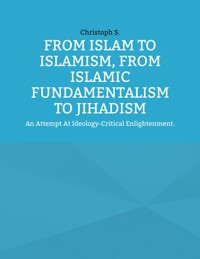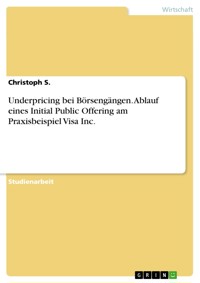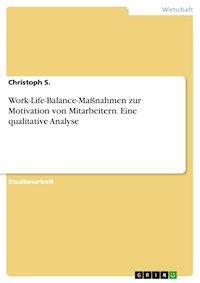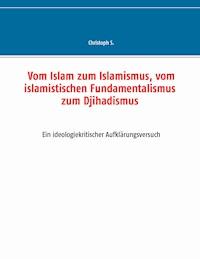
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Arbeit verfolgt das Anliegen, mittels einer ideologiekritischen Analyse des islamischen Fundamentalismus vor Schlimmerem zu warnen. Das Argument "Das konnte doch niemand wissen", welches in Wirklichkeit "Das wollte niemand wissen" lauten müsste, beginnt heute wieder dem Wunschdenken eines "von Natur aus toleranten und friedfertigen Islam" Vorschub zu leisten. Falls kein Ausgleich zwischen westlichem und koranischem Denken erzielt werden kann, muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Aus der philosophischen Position des Realismus (wertneutral als Sammelbegriff für viele philosophische Strömungen verstanden), die von der Existenz und zumindest partiellen Erkennbarkeit einer außersubjektiv existierenden Außenwelt ausgeht, soll das "supra-naturalistische Wertsystem" des Islam kritisch reflektiert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist meiner Familie gewidmet.
Nach dem Weltjugendtag [...] zogen angetrunkene junge Muslime am Kölner Dom vorbei und riefen: In vierzig Jahren gehört der uns. (Aus dem Interview des Weihbischofs Heiner Koch in der RP vom 30.08.2006, 1 „Christen müssen frecher werden“ A4).
Dr. Christoph S.
Vom Islam zum Islamismus, vom islamischen Fundamentalismus zum Djihadismus - ein ideologiekritischer Aufklärungsversuch.
Geschrieben 2007, veröffentlicht 2017.
1 Rheinische Post: http://www.rp-online.de/politik/deutschland/christen-muessen-frecher-werden-aid-1.2315368
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Hauptteil
Der Islam
Darstellung des eigenen ideologiefunktionellen Standpunktes aus Sicht der Kulturanthropologie im Vergleich zum islamischen Menschenbild
2.1 Kulturanthropologische Prämissen
2.2 Das Menschenbild des Islam
Vom Islam zum Islamismus
3.1 Der Beginn beider Religionen (Christentum & Islam)
3.2 Der dreifache Universalitätsanspruch des Islam
Die Wertproblematik
4.1 Nietzsches doppelte Verneinung der Wahrheit
4.2 Monod – ein Vertreter des strikten Dualismus von deskriptiver Wissenschaft und normativen Gegenstandsbezügen
4.3 Lenk – der Konstruktivismus und der Wert-Wahrheitsdualismus
4.4 Birnbacher - der „naturalistische Fehlschluss“
Ideologiekriterien, die den Islamismus als defizitäre Ideologie charakterisieren
5.1 Erkenntnisdefizit
5.2 Erkenntnismonopole
5.3 Dichotomisches Deutungsschema
5.4 Dämonisierung des Feindbildes, Glorifizieren der eigenen Rolle
5.5 Leerformeln
5.6 Ambivalenz
5.7 Asymmetrie
5.8 Selektive Wahrnehmung
Islamischer Fundamentalismus
6.1 Geschichte des Islamismus
6.2 Fundamentalismus – ein Phänomen der Moderne?
6.3 Fundamentalistische Prämissen in Ontologie und Erkenntnistheorie
6.4 Islamismus und Wissenschaft
6.5 Islamismus und Demokratie
Vom Islamismus zum Djihadismus
Schluss
8.1 Zusammenfassung
8.2 Ausblick
Anhang: Der Islamismus im Spiegel von ausgewählter Literatur
A.1 Akbuluth: Der Islam und seine Bedeutung für die Weltpolitik – eine Fehl- und Falschinterpretation
A.2 Kellerhals: Der Islam. – eine aneignende Interpretation
A.3
Elyas:
Islam – Religion des Friedens:
BKA (Hg.):
Islamistischer Terrorismus -
eine verharmlosende Interpretation
A.4 Khoury
: Der Islam und die westliche Welt
– eine religionsphilosophisch-theologische Interpretation
A.5 Domenico Losurdo:
Was ist Fundamentalismus
? – eine objektivistische Interpretation
Literaturverzeichnis
Vorwort
Bertrand Russell vertritt in seiner Philosophiegeschichte “Philosophie des Abendlandes – Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung“ eine neue Auffassung über die Geschichte der Philosophie, deren programmatische Intentionen er schon im Untertitel unterstreicht. Danach ist die Philosophie und ihre Geschichte keine zeitenthobene und von der menschlichen Sozietät abgelöste Selbstbespiegelung des menschlichen Geistes; sondern „Philosophen sind sowohl Ergebnisse als auch Ursachen: Ergebnisse ihrer sozialen Umstände, der Politik und der Institutionen ihrer Zeit; Ursachen (wenn sie Glück haben) der Überzeugungen, die der Politik und den Institutionen späterer Zeitalter die Form geben“ (Köln 2002). Dieser Generalthese folgt die Analyse. Sie wird im Hauptteil durch unstrittige Hinweise auf die Goldene Zeit der islamischen Philosophie argumentativ bestätigt. Im Schlussteil wird eine Prognose gewagt, wie sich eine Auseinandersetzung des Islam mit seiner eigenen und derjenigen der Neuzeit soziokulturell auswirken kann.
Das vorige Jahrhundert war in Europa durch drei Großideologien geprägt: Imperialismus, Nationalsozialismus und Kommunismus. Imperialismus und Nationalsozialismus haben sich in zwei Weltkriegen unter ungeheurem Verlust an Menschen und Material ausgetobt; der Kommunismus, der vor allem in den Gulags der Sowjetunion reiche Ernte an Menschenleben gehalten hat und in China unter Mao etwa 70 Millionen Menschen ermorden ließ, hat sich an seinen eigenen Widersprüchen, artikuliert durch Präsident Gorbatschow, selbst beerdigt. Was alle drei Ideologien2 einigt, ist ihr strukturell ähnliches Wertsystem, das dem Menschen nur eine instrumentelle Existenz zugesteht, mit dem diese Ideologien ihr Machtspiel treiben konnten.
Doch das Aufatmen auf der Welt wird zusehends schwächer, weil das ideologische Vakuum, entstanden durch den weitgehend unblutigen Untergang des Sowjetimperiums, sich schon wieder zu füllen beginnt. Die Religion „Islam“ gerät mehr und mehr unter den politischen Einfluss der Herrschaftsidee des Islamismus, einer fundamentalistischen Befreiungsideologie3 mit missionarischem Eifer und Eiferern, die ihre Weltanschauung einer wörtlichen Auslegung des Korans entnehmen und einen muslimischen Gottesstaat mit globalem Umfang planen, deren Feindbild, der Westen, immer mehr dämonisiert wird, so dass das christliche Abendland gemäß dieser Schilderung immer mehr einem Sodom und Gomorra gleicht, dessen Auslöschung ein gottwohlgefälliges Werk ist.
Ebenso wie die schon genannten Großideologien ihre Feindbilder entwickelt haben, der Imperialismus den gnadenlosen Konkurrenten, der Nationalsozialismus die ‚minderwertigen Rassen’, vor allem das internationale Judentum, der Kommunismus den ‚Klassenfeind’, die zur problemloseren Vernichtung vorher dämonisiert und ‚verteufelt‘ wurden, so präsentiert heute der Islamismus sein Feindbild des ‚kreuzzüglerischen Westens‘ mit den USA und Israel als Protagonisten.
Auch hier ist auffällig, dass der Andere (wir) nacheinander die Rolle des Mitbürgers, dann des Gegners, dann des Feindes, dann des teuflischen Abgesandten der Hölle, zum Schluss dann des Untieres, Unmenschen und Unwesens (Inkarnationen des Bösen) durchlaufen, so dass es jedem guten Bürger als Angehöriger einer wahrhaft gottgefälligen Weltanschauung Pflicht sein muss, den ‚Anderen’ (uns) schließlich als ‚Menschenmüll’ zu ‚entsorgen’. Der terroristische Flügel des Islamismus, ungerührt von den mahnenden Stimmen einiger religiöser Führer des Islam, hat sich diesem ‚Entsorgungsprogramm’ verschrieben. Es ist der Zynismus der Macht, der hier wie bei den anderen genannten Ideologien die Existenz des Menschen auf ein reibungsloses Funktionieren reduziert und höchstens als Mittel gelten lässt.
Der menschenverachtende Islamismus, der jetzt in der Reihe „Faschismus“, „Kommunismus“ und „Nationalsozialismus“ im Gleichschritt mitmarschiert, ist ein Angriff auf alle zivilisierten Nationen, was mich dazu führt, diese terroristische Ideologie argumentativ zu entlarven und dadurch zu bekämpfen, nicht zuletzt aus der leidvollen Erfahrung mit dem Kommunismus. „Veränderung durch Aufklärung“ – so möchte ich mein in diesem Buch niedergelegtes Programm plakativ zusammenfassen. Die argumentative Entlarvung des Islamismus als negative Karikatur einer missbrauchten Erlösungsreligion (ich sehe vor mir ständig die beiden zusammenstürzenden Tower des World Trade Centers in New York) lässt mich emotional nicht kalt, so dass ich meinen Standpunkt bei normativen Bewertungen engagiert und sprachlich unmissverständlich vertreten werde; für die Sachdarstellung gilt das Objektivitätspostulat. Der Leser kann immer zwischen normativer Subjektivität und deskriptiver Objektivität unterscheiden.
Dass vieles in Zukunft für eine militärische Konfrontation des Westens mit dem Islamismus spricht, ist Meinung von Huntington (1996)4. In seinem umstrittenen Buch “Kampf der Kulturen“ vertritt er die These: ‚Es gibt zwei Weltkulturen (besser Zivilisationen), die des Islam und die des Westens. Beide erheben einen universalen Machtanspruch.’ Die Muslime glauben, dass sie das Recht und damit die Macht haben, ihre Kultur mit physischem Nachdruck auf der ganzen Welt zu verbreiten; die Europäer sind von der Überlegenheit ihrer rationalen Zivilisation überzeugt und wollen trotz schwindender Macht eine westliche Weltzivilisation aufrechterhalten. Letztere hoffen, dass durch die Globalisierung der menschlichen Belange eine die Einzelkultur transzendierende Weltkultur entsteht. Im Grunde bedeutet der alleinige Machtanspruch eine Neuauflage der Bipolarität zwischen sowjetischem Kommunismus und amerikanischen Kapitalismus als Kampf zwischen Islamismus und freiem Westen.
Die Klärung der strittigen Begriffe „Zivilisation“ und „Kultur“ möchte ich hier mit dem Begriff „System“ umgehen. Der Einwand, dass es ein einheitliches islamisches System nicht gibt, sondern nur viele islamischen Staaten mit eigenen Interessen, die niemals eine Einheit bilden können, ist historisch und tatsächlich gut zu belegen, aber auch die Gegenthese5, weil der Karikaturenstreit gezeigt hat, dass in religiösen Fragen die Muslime ein einheitliches Bewusstsein besitzen und weil der Islamismus sich anschickt, länderübergreifend das gemeinsame Fundament des politischen Islam zu werden. Es gibt auch die Utopie eines gemeinsamen Gottesstaates, die unter Mohammed, den vier „rechtgeleiteten Kalifen“, den „Omaijaden“ und der „Hohen Pforte“ alle oder viele Muslime in einem historisch existenten Reich vereinigt hat und also wieder Realität werden kann, wenn sie ernsthaft angestrebt wird, weil sich die Glaubensbasis nicht geändert hat. Auch der Panarabismus ist trotz seiner Niederlage im Sechs-Tage-Krieg politisch noch immer eine Option.
Die deutsche Innen- und Außenpolitik hat diese drohende weltweite Konfrontation zweier Systeme lange ignoriert, dann verniedlicht, dann ungeschickt angegangen. Unkontrolliert konnten sich jahrzehntelang Muslime in Deutschland ansiedeln. Wer in dieser unbegrenzten Einwanderung ein kommendes Problem sah, wurde als Rassist verunglimpft, Neonazi beschimpft, Deutschtümler ironisiert, Rechtsradikaler indiziert. Auf der Multi-Kulti-Spielwiese sollte sich eine integrative Gesellschaft bilden. Das gelang den europäischen Migranten; denn es hat mit Italienern, Spaniern, Griechen, Portugiesen, Jugoslawen (als Sammelbegriff) keine politischen Spannungen gegeben.
Doch die Muslime blieben wegen ihres ganz anderen Wertsystems, das sie mit nach Westeuropa brachten, unter sich, engagierten sich gesellschaftlich wenig und waren Fremde, die auch die deutsche Sprache6 oft nur gebrochen beherrschten. Das war auch nicht so schlimm, denn inzwischen hatte sich eine muslimische Parallelgesellschaft, optisch sichtbar im Entstehen von Ghettos, gebildet, in der sich, verstärkt mittels der Medien in der Türkei, eine durch einen militanten türkischen Nationalismus7 beeinflusste muslimische Gesellschaftsstruktur bildete, in der Türkisch die Umgangssprache ist. Ein sich aus dem deutschen Staatswesen ausgliedernder Staat im Staate beginnt, sich allmählich zu etablieren. Das „Diaspora-Syndrom“, mangelhafte Bildungsqualifikation, der häufig propagandistische Einfluss der türkischen Medien, deren Schüren von Vorurteilen alte Verhaltensmuster des Denkens und Verhaltens vieler nicht nur türkischer Muslime bestimmen, die trostlose Situation auf dem Arbeitsmarkt, aber besonders das mit der Wirklichkeit nicht korrespondierende Überlegenheitsgefühl als Privilegierte Gottes sorgen zusätzlich für Abschottung vor der deutschen Gesellschaft und auch Ablehnung dieser Kultur. Trotz der vielen verfassungskonform lebenden Türken und Muslime in Deutschland bleibt der Vorbehalt, dass hier eine Entwicklung abläuft, deren Richtung kaum zu erkennen und zu steuern ist. Geringer Einsatz für deutsche Belange und Betonung der eigenen Andersartigkeit sorgt für schwindende Akzeptanz bei der deutschen Bevölkerung. Wir erleben den Weltislam und den militanten Islamismus in der verschlüsselten Form seismischer Ausschläge in unserer Kultur, die schwer interpretierbar und deshalb nicht ganz geheuer zu sein scheinen.
2 Die hier deutlich werdende Einbettung dieses Begriffes in einen negativen Kontext begnügt sich vorläufig in seiner Verwendung, eine defizitäre Gesellschaftstheorie mit inkorporiertem rigidem Praxisbezug zu sein.
3 Auch dieser Begriff soll zunächst phänomenologisch als Sammelbegriff der Erscheinungsformen dienen, die sich vor allem durch Gebrauch der Medien unter diesem schillernden Begriff im Alltag zusammenfassen lassen. Dabei wird unterstellt, dass der Begriff „Islam“ zunächst deutlich von dem Phänomen „Islamismus“ zu trennen ist: ersterer bedeutet „Leben nach der heiligen Schrift des Koran“, letzterer „Leben nach seiner von Ideologen instrumentalisierten und deformierten Botschaft“.
4 Es wird „amerikanisch“ zitiert, also Autor, Erscheinungsjahr seiner Produktion und Seitenzahlen in dem Text durch eine Klammer markiert. Beziehen sich nacheinander mehrere Zitate auf die gleiche Publikation, erscheinen sie nur als eingeklammerte Seitenangabe.
5 Hier wird die partikulare von der globalen Betrachtungsweise unterscheiden. Indem ein Problem in viele Teilprobleme zerlegt wird, kommt man der Wirklichkeit sehr nahe, verliert aber die Sicht auf die verursachenden Hintergründe, so dass eine Beurteilung des Ganzen nicht mehr möglich ist. Indem ein Problem in globale Zusammenhänge eingeordnet wird, entfernt man sich von der konkreten Wirklichkeit der Einzeldaten, gewinnt aber allgemeine strukturelle Einsichten, die dafür nur eine generelle Prognose zulassen. Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung und können sich gegenseitig ergänzen. Diese Arbeit orientiert sich mehr an der globalisierenden Methode, die nicht jede Einzelheit berücksichtigen kann, so dass ein vereinfachtes Bild entsteht. Doch das bis zum Erbrechen wiederholte Argument, dass es den Islam als solchen gar nicht gäbe, so dass jeder Einzelfall zu untersuchen sei, dient nur der rhetorischen Bestätigung von allen möglichen Theorien, damit faktisch existierende gemeinsame Ziele des Islam geleugnet werden können. Eine Generalisierung der Untersuchungsergebnisse mit Einräumung einer großen Hypothetizität wird angestrebt. Es wird ebenfalls ohne Einschränkung zugestanden, dass das Christentum auch historische Phasen des Fundamentalismus durchlaufen, aber aus eigener Kraft überwunden hat.
6 In der ehemaligen DDR mussten alle Schüler Russisch lernen; doch wegen des geringen Prestiges der russischen Kultur, die vom 2. Weltkrieg herrührte, beherrschte diese Sprache kaum jemand. Aufgrund des hohen Prestiges der englischen und französischen Sprache fallen die dort lebenden Muslime nicht durch mangelnde Beherrschung der Landessprache auf. Ich führe die defizitären Sprachkenntnisse vieler türkischer Immigranten auf ein ähnliches Phänomen zurück, die mangelnde Autorität und das geringe Prestiges des deutschen Staates, wodurch eine emotionale Sprachbarriere entsteht.
7 Die nationalistisch agierende Türkei, die die europäische Praxis schlicht ignoriert, sei hier angeführt. Etwa fünfzigtausend in Deutschland lebende Türken haben trotz Verbotes des ‚Doppelpasses’ nachträglich wieder die türkische Staatsbürgerschaft angenommen, obwohl sie wussten, dass bei Bekanntwerden automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erlischt. Der türkische Staat, der hier Handreichung geleistet hat, weigert sich, die Namen bekanntzugeben, so dass wir bei keiner Wahl mehr ausschließen können, dass nichtdeutsche Staatbürger verfassungswidrig wählen, also Wahlbetrug begehen.
Nach den Hartz-Gesetzen müssen Bürger, die staatliche Unterstützung beantragen, die finanziellen Verhältnisse offenlegen. Nun haben viele Türken, die nach Hartz Unterstützung beantragt haben, Vermögen in der Türkei. Doch der türkische Staat weigert sich, den deutschen Behörden Amtshilfe zu leisten, so dass viele Türken finanziell besser gestellt sind als Deutsche.
Einleitung
Das Thema der Arbeit legt nahe, als ob ein bruchloser Weg vom Islam über den Islamismus zum terroristischen Konzept des „Djihad“8 führt, dass also mit einer gewissen Folgerichtigkeit der Islam als Ausgangspunkt einer Entwicklung anzusehen ist, die indirekt zur Basis des djihadistischen Terrorismus9 wird. Dem Islam selbst wird ein hohes Ideologisierungspotential unterstellt, das in der Gegenwart permanent aktiviert wird. Die drei Begriffe beschreiben, so hier die Vermutung, also nicht drei diskrete Zustände, sondern einen stufenlosen Übergang, der eine eindeutige Zuordnung erschwert. Im Laufe der Untersuchung muss sich zeigen, ob dieser Generalverdacht gerechtfertigt ist, falsch ist oder modifiziert und differenziert werden muss. Dass Religionen, sofern sie die einzig maßgebende Wahrheit zu verkünden glaubten, in besonderem Maße Ursache oder Mitursache von weltanschaulichen Konflikten bildeten und bilden, also fundamentalismusanfällig sind, wird als starke Prämisse vorausgesetzt. Der Dreißigjährige Krieg ist ein solches Beispiel, in dem im Namen Gottes und der christlichen Religionen religiöse Motive und weltliches wie geistliches Machtstreben zu einer weitgehenden Entvölkerung des Deutschen Reiches geführt haben. Die öffentliche Verbrennung des Pantheisten Giordano Bruno durch die Inquisition und die durch diese Institution erfolgte Maßregelung des Galileo Galilei beweisen einen unduldsamen Fundamentalismus des damaligen Katholizismus.
Der analytischen Aufarbeitung des Fundamentalismusproblems dient das Hermeneutikmodell von Tepe. Er unterscheidet in seinem Stufenmodell der literarischen Textinterpretation zwei Ebenen, die kognitive und reflexive. Die kognitive Stufe ist durch einen objektiv und damit historisch resistenten Textsinn geprägt; die reflexive Ebene stellt die Frage, warum der Text so ist, wie er ist, also nach dem Grund des Textkonzeption (Tepe 2001, 118-124).
Der Autor möchte dieses Modell auch auf die Interpretation von kulturellen Erscheinungen anwenden und diesem Stufenmodell noch eine dritte und letzte hinzufügen. Das, was sich in einer Kultur als Realstes präsentiert, ist ihre Oberfläche mit dem freien Spiel von Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst, Individualität, Trends, Werten. Dieses agile Beziehungsgemenge scheint auf den ersten Blick regellos, zufällig und ziellos, also chaotisch zu sein. Doch mit der Prämisse, dass jeder Wirkung eine Ursache vorausgeht, lässt sich die Frage stellen: Warum sind die Erscheinungen so, wie sie sind?
Die Analyse der Objektebene fördert damit die Kräfte zu Tage, durch die die widersprüchlich beschaffenen Oberflächen verursacht sind: sich widersprechende oder verstärkende Wertsysteme, Überzeugungen, Theorien. Bei literarischen Texten ist dieses das den Autor prägende Kunstprogramm und sein Wertsystem, die als ursächlicher Hintergrund die Textstruktur bestimmen, so dass sich die künstlerischen und weltbildbedingten Autorintentionen im Text spiegeln. Aber die Interessen der politischen Akteure sind noch weiter hinterfragbar. Der Regressus endet dort, wo Annahmen, Theorien, Wertsysteme durch keine Begründung wiederum begründet werden können. Diese gründenden Prämissen werden in ihrer umfänglichsten Ausformung von Philosophie, Religion und Mythos bereitgestellt und bestimmen direkt die Tiefenstruktur einer Kultur und damit indirekt ihre vielseitige Wirklichkeit.
Kultur und Geschichte können gemäß dieser Drei-Schichten-Theorie analysiert werden. Das Thema fordert also gemäß dieser Theorie ein stufenweises Vorgehen. Gesetzt ist der Islam als Religion mit seinem nicht mehr hinterfragbaren Wertsystem, das die ontologischen Prämissen des theologischen und profanen Überbaues liefert, erst einmal wertneutral „Islamismus“ genannt, der wiederum die theoretische Begründung für den verwirrenden Wirklichkeitsausschnitt „Djihad“ bereitstellt.
Vergleichen wir die Tiefenstrukturen der westlichen mit der islamischen Welt, dann stellt sich heraus, dass ein tiefer, scheinbar unüberbrückbarer ontologischer Unterschied zwischen westlicher und islamischer Welt besteht. Der Islam geht von einer Welt aus, die von Allah geschaffen und deshalb nur durch ihn vermittelt, erkennbar ist. Der Koran als sola scriptura beschreibt objektiv, für alle Zeiten verbindlich, absolut wahr, was es mit dieser Welt und der Rolle des Menschen auf sich hat. Die Staatsform, die sich daraus ergibt, nennt Prenner (2005, 128) „Nomokratie“, eine primäre Herrschaft des Wortes Gottes, aus der die Wirklichkeit analytisch folgt. Man kann sich diesen Schöpfungsakt wie einen illokutiven Sprechakt vorstellen, der zugleich zur sprachlichen Information die entsprechende Handlung vollzieht, etwa: ‚Ich taufe dich [...]’
Indem der Muslim den Koran rezipiert, lernt er Gottes Absicht, aber auch die Beschaffenheit seiner Welt kennen. Der Koran ist also der Vermittler objektiven Wissens, dem sich der Muslim anzupassen hat: ein direkter Weg zum Wissen von Gott und der Welt ist nicht möglich. Wahrheit heißt damit „Angleichung des Denkens und Handeln an die Aussagen des Koran“, weil er semantisch als Gotteswort und daher faktisch objektiv gültig ist. Das oberste Gebot des Islam verbirgt sich in dem Begriff „Ergebung in Gottes Willen“, was so viel wie monarchischer und theologischer Absolutismus Allahs bedeutet, dem gegenüber der Mensch nur ein wesenlose Schatten ist. Der Islam definiert sich und seine Welt von Gott, dem allmächtigen Herrscher, her.
Der Westen vertritt die Ontologie der Subjektivität gemäß dem Wahlspruch des Protagoras „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“. Der Zweifel an der objektiven Welt des Mittelalters, die als Spiegelung der göttlichen verstanden wird, kommt in Descartes zu seiner methodischen Ausprägung. Es ist zunächst alles bezweifelbar, sogar die Existenz der eigenen Person. Doch wenn man sich das Nichtsein der eigenen Person vorstellt, dann muss es einen Vorstellenden geben, der sein Nichtsein vorstellt, das Ich, das Selbstbewusstsein, welches allem Einzelwissen schon vorhergeht. Also geht der universelle Zweifel fehl, weil zweifeln können immer schon Wissen voraussetzt. Die Skepsis führt also nicht zur Wissensabstinenz, sondern zu unbezweifelbarem Wissen. Descartes Methode ist es also, durch Zweifeln zu zweifelsfreiem Wissen zu gelangen. Die menschliche Vernunft, so sein Schluss, ist der Ort von unbedingtem Wissen, während die Objektwelt jederzeit dem Skeptizismus wegen ihrer Kontingenz Nahrung geben kann. Der Subjektivismus bestimmt also durch Negation des Zweifels zugleich das unbezweifelbare denkende und seiende Subjekt, nicht mehr eine als absolute Objektivität gedachte Vorstellung der Existenz Gottes. Die Vorstellungskraft, die Vernunft, die Ratio sind Bedingung dafür, dass sowohl das Ich sich selbst als auch der Welt gewiss sein kann.
Die Neuzeit vertritt damit ein anthropozentrisches Weltbild, während der Islam ein theozentrisches Grundkonzept verfolgt. Für ihn ist Gott und seine Schöpfung das absolut Reale, an die sich die menschlichen Seins- und Erkenntnisfunktionen angleichen müssen. Beide sind diametral entgegengesetzt und machen den fundamentalen Unterschied zwischen beiden Welten aus. Grundpositionen, hier das Verhältnis zwischen religiösem Objektivismus des Islam und säkularem Subjektivismus des Westens, bestimmen die Probleme der heutigen Welt. Damit ergibt sich die Zielstellung dieser Arbeit: Aus der philosophischen Position des Realismus (wertneutral als Sammelbegriff für viele philosophische Strömungen verstanden), die von der Existenz und zumindest partiellen Erkennbarkeit einer außersubjektiv existierenden Außenwelt ausgeht, soll das „supra-naturalistische Wertsystem“10 (Tepe 1988, 11) des Islam kritisch reflektiert werden.
Zunächst einmal gibt es zwei Richtungen der ideologiekritischen Analyse, die erkenntnistheoretische und die gesellschaftskritische: Ideologie11, jetzt in einem umfänglichen Sinne neutral bis positiv gebraucht, verändert gemäß der Theorie des „standortgebundenen Denkens“ der Kultursoziologie (Mannheim 1984) einmal das philosophische und profane Denken und Wahrnehmen von Wirklichkeit, zum anderen aber auch das Wahrnehmen und Gestalten von politisch-gesellschaftlicher Realität. Erstere fragt nach der anthropologisch allen Menschen zugeschriebenen Fähigkeiten der Aufnahme und Verarbeitung von Daten, nach der Denkfähigkeit: nach ihren Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen und kritisiert Versuche, auf Grund irgendwelchen Verfolgens von Interessen, Vorurteilen oder Indoktrinationen Einfluss auf die Erkenntniskriterien und damit auf das Erkenntnisvermögen zu nehmen. Die andere kritisiert gesellschaftliche Entwürfe, die vorgeben, eine Gesellschaft nach wahren, d.h. allgemeingültigen und verbindlichen Werten ausrichten zu können.
Birnbacher (1996) ist in dem Aufsatz “Schopenhauer als Ideologiekritiker“ nach einer ähnlichen Methode der Ideologiekritik vorgegangen. Ein ideologischer Komplex wird zunächst einer theoretischen Kritik an der Falschheit der Aussagen unterworfen, dann der Grund dieser „Wahrheitsverzerrung“ (51) ermittelt: kritisch zu wertende politische Funktionen und moralische Intentionen der neuen Heilslehren, die den Sachverhalt ihren Zielen gemäß verbogen haben und schließlich das Verhalten der Akteure entlarvt, die eine Ideologie produziert haben oder ihr blind folgen.
Diese Ideologiekritik ist auf theoretischer Ebene schon geleistet worden. Ich nenne hier nur Lieber, Tepe, Salamun. Ideologiebildung erfolgt nach wissenschaftlich erforschbaren Gesetzen, deren Kriterien wissenschaftlich-deskriptiv dokumentierbar sind. Hier stütze ich mich auf Salamun (2005), der auf die schon erarbeiteten Kriterien einer Ideologie- und Totalitarismuskritik hinweist, die bei der Analyse des Fundamentalismus ihre „Erklärungsansätze und Interpretationshypothesen“ (9) fruchtbar einbringen können. Überraschend ergibt sich, dass sich alle fundamentalistischen Bewegungen strukturell sehr ähnlich entwickeln, so dass ihnen vermutlich ein gleiches, überhistorisches Strukturmodell zu Grunde gelegt werden kann. Die einzelnen fundamentalistischen Weltanschauungen sind dann nur Individuationen einer überhistorischen Struktur, so dass das Ziel der Arbeit unter Zugrundelegung dieser allgemeinen Strukturmerkmale eine Bestimmung der individuellen Merkmale des islamischen Fundamentalismus12 sein muss. Doch mit solchen deskriptiven Darstellungen – wir denken an Imperialismus, Nationalsozialismus und Kommunismus – ist es nicht getan. Wenn man ein schlimmes Unheil prognostizieren kann, lässt es sich schon, besser: nur in seinem Anfangsstadium wirksam bekämpfen.
Salamun vergisst aber, außer auf den wissenschaftlichen Wert auch auf den pragmatischen Aspekt solcher Analysen hinzuweisen. Hier vertritt der Autor ein Aufklärungspathos, das rhetorisch verschärfende Formulierungen nicht scheut und sich dennoch auf gute Gründe stützt, denn es gilt der Grundsatz „principiis obsta“ (wehret den Anfängen); wenn sich erst einmal eine Ideologie im negativen Sinne etabliert hat, gewinnt sie eine Eigendynamik, die durch Kritik kaum noch zu bremsen ist, weil sie ihre Kritiker solange ‚entsorgt’, bis es keine mehr gibt. Die durch Ideologie im defizitären Sinne, Ideologie(-), verursachte Veränderung des theoretischen Erkennens und praktischen gesellschaftlichen Handelns müssen durch eine ideologiekritische Analyse bloßgelegt werden. Dieses Entlarven ideologisch defizitärer Strukturen – ein weiteres Ziel dieser Arbeit – verfolgt aber auch keinen Selbstzweck, sondern die Strategie, eine Verhaltensänderung des Lesers herbeizuführen. Nach der logischen Beziehung „wenn p, dann q“ ergibt sich, wenn ich q nicht will, das Setzen von Nicht-p; d.h. Entstehen, Blütezeit und Verfall einer Ideologie laufen zwar nach voraussehbaren historischen Phasen ab, sind aber vom Menschen beeinflussbar.
Wenn die Zielsetzung einer fundamentalistischen Ideologie als falsch oder menschenverachtend bloßgestellt ist, müssen die Mittel gesucht werden, die eine andere Zwecksetzung im Sinne einer Humanisierung fördern. Diese Arbeit verfolgt daher das Anliegen, mittels einer ideologiekritischen Analyse des islamischen Fundamentalismus das Stolpern der Welt in einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das Argument „Das konnte doch niemand wissen“, welches in Wirklichkeit „Das wollte niemand wissen“ lauten müsste, das den Ausbruch des Ersten und Zweiten Weltkrieges wie die Schreckensherrschaft des Kommunismus irrationalisiert hat, beginnt heute wieder, als „von Natur aus toleranter und friedfertiger Islam“ der Gedankenlosigkeit, aber auch dem Wunschdenken Vorschub zu leisten. Falls kein Ausgleich zwischen westlichem und koranischem Denken erzielt werden kann, muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden!
Theoretische Grundlage dieser Arbeit bildet die Ideologietheorie Tepes, die er u.a. in zwei Untersuchungen13 zusammengefasst hat. Da die beiden anderen Weltreligionen strukturell und funktionell mit dem Islam im Zusammenhang stehen, werden sie aus redaktionellen Gründen weitgehend von dieser Untersuchung ausgeschlossen, wobei historisch ähnliche Verhältnisse eingeräumt werden. Das Christentum, in seiner Vergangenheit durch verschiedene Fundamentalismen geprägt, hat sich in einer schmerzlichen Phase der Aufklärung und Textkritik von seiner Fundamentalismusanfälligkeit gereinigt.
Doch mit aller Vehemenz wehrt sich der Islam gegen eine historischkritische Analyse14 des Korans. Daran anschließend wird der Islamismus einer kritischen Sicht unterzogen, ebenso der Djihadismus, woraus sich Konsequenzen für das eigene politische Denken und Handeln ziehen lassen.
8 Der Begriff Djihad wird hier hauptsächlich in der Bedeutung „heiliger Krieg“ verwendet. Als Grund dafür lässt sich angeben: „Leider haben unsere muslimischen Freunde ihn jetzt auch übernommen und ein falsches Bild vom Islam gezeichnet, das zu vielen Missverständnissen beigetragen hat“ (Schimmel 1996, 12). Seine tatsächliche Bedeutungsverschlechterung wird von vielen Autoren nicht zur Kenntnis genommen, so dass sie diesen Begriff mit dem „großen Djihad“, der vom Gläubigen innere Läuterung verlangt, übersetzen.
9 Unter der Kapitelüberschrift „Vom klassischen Djihad der Eroberung zum Djihadismus des irregulären Krieges“ zeigt Tibi (2004) die semantische Bedeutungsverschlechterung dieses Begriffes, der auch einer tatsächlichen entspricht, hinreichend auf.
10 Ein „supra-naturalistisches Wertsystem“ rechnet außer mit der Existenz einer physischen mit der einer jenseitigen, metaphysischen Realität.
11 Mannheim (1984) unterscheidet zwei Denkzugänge: „von innen her“ und „vom Sein her (1982, 213). Ersteren nennt er „Idee“, letzteren „Ideologie“ (213). Nicht so sehr das Was der Ideen will Mannheim bestimmen; er will das geistige Gebilde als soziologisch auf bestimmten Bedingungen beruhende Funktion betrachten. Im weiten Sinne geht es um das dahinterstehende sozio-kulturelle Wertsystem, das begreiflich macht, warum das entstandene geistige Produkt Ergebnis eines Denkens aus einer bestimmten Interessenlage heraus, aus einer „Ideologie“, einem bestimmten Zeitgeist sind. Dieser Begriff wird hier als „Ideologie(+)“ (Tepe 1988, 8) bezeichnet. Diese Auffassung deckt sich weitgehend mit dem geschichtsphilosophischen Konzept Russels.
12 Islamischer Fundamentalismus ist eine defizitäre Weltanschauung, weil sie vorgibt, politisch aus dem heiligen Koran eine ideale Welt durchsetzen zu können, deren Wirklichkeit in naher Zukunft erreichbar ist.
13 Tepe, P.: Theorie der Illusionen. Essen 1988. Ders.: Illusionskritischer Versuch über den historischen Materialismus. Essen 1989.
14 Gemäß der intersubjektiven Erfahrung, dass „der Geist nicht vom Himmel fiel“, wie ein Buchtitel von v. Ditfurth die metaphysische These der creatio ex nihilo negativ paraphrasiert, wird behauptet, dass eine sprachlich verfasste Botschaft, auch wenn der Überbringer sie wörtlich und ohne eigenen Zusätze weitergibt, die damalige Beschaffenheit der Sprache mit all den vom Menschen hervorgebrachten Implikationen unkritisch einfach als göttlich zugrunde gelegt hat. Unbestreitbar ist, dass, da das Koran-Arabisch eine menschliche Schöpfung ist, die eine mehr oder weniger lange Entwicklung hinter sich hat, sie Bedingung für das Verstehen der Heilsbotschaft ist, die Allah nur unter der Bedingung der Existenz und Beherrschung eines vom Menschen geschaffenen und sich ständig wandelnden sprachlichen Sinnsystems hat verkünden können. Allah kann nicht anders, als in menschlicher Sprache zum Menschen sprechen. Er musste „menschlich“ werden.
Es darf hier die Frage erlaubt sein, wie Mohammed durch einen Akt Gottes den Ur-Koran hat lesen können, wenn er nach allgemeinem Urteil Analphabet war.
Hauptteil
1. Der Islam
Die Zahl der Veröffentlichungen über den Islam ist Legion, so dass jedem interessierten Leser der Zugang zu dieser Religion leicht gemacht wird, die in Deutschland die drittstärkste Konfession bildet. Deshalb wird hier ein schon differenziertes Vorwissen über diesen weltumspannenden Glauben an einen Gott, Allah, einkalkuliert und nur eine erste zusammenfassende Darstellung vorangestellt. Die sich entwickelnde Problematik verlangt dann im Verlauf der Erörterung ein genaueres Eingehen auf einzelne zu erfragende Teilbereiche.
Deskriptiv (religionswissenschaftlich) gesehen, ist der Islam eine Schöpfung des Propheten Mohammed (geb. um 570 n. Chr.), der sich von Allah inspiriert glaubt, Gottes Wille den Menschen verkünden zu müssen. Mohammed lebt als Händler und Kaufmann in Mekka und lernt als Karawanenführer das Christentum und Judentum kennen; er selbst ist Anhänger des Polytheismus, der von den arabischen Stämmen praktiziert wird. Die Kaaba in Mekka, heute das höchste Heiligtum des Islam, genießt als religiöses Heiligtum bei vielen Polytheisten hohes Ansehen. Den vielen oft miteinander befehdeten Stämmen entsprechen auch verschiedene polytheistische Systeme, so dass Mohammed mit einer Fülle von Gottheiten, die sich oft auch noch befehden, in Berührung kommt. Er zieht sich, weil er sich als wahrer Gottsucher in dieser sich widersprechenden Götterwelt fühlt, in die Wüste zurück und meditiert.
Im Jahre 610 n. Chr. beginnt seine prophetische Phase; er nimmt in Gestalt des Engels Gabriel die Stimme seines, des einigen Gottes wahr, die ihm nach einem Einblick in den Ur-Koran die wahre Gotteslehre zumutet und auch den Auftrag, diese allen Menschen zu verkünden. Nach seinem Tod werden, da Mohammed selbst Analphabet ist, seine Visionen, die schon einzeln schriftlich fixiert worden sind, in dem „Buch“, im Koran zusammengefasst, leider nicht chronologisch, sondern nach Länge der Suren, die sich immer mehr verkürzen.
Der Islam kann sich auf zwei Quellen berufen; den Koran, das Worte Gottes, und das gottgefällige Leben des Propheten. Das in Arabisch, der ‚Sprache’ Gottes verfasste „Buch“, ist gemäß seiner als göttlich angenommenen Abkunft nicht in andere Sprachen übersetzbar, es ist die Wahrheit schlechthin, überzeitlich gültig, für jeden Muslim in allen Lebensbereichen verpflichtende Richtschnur. Der Korantext ist nach Willen Mohammeds das direkte Wort Gottes; er selbst ist nur „das Siegel der Propheten“ (33:40). Damit besteht der Koran, hermeneutisch gesehen, nur aus einem einschichtigen Text, dessen Wahrheit offen vorliegt und nicht aus Schichten verschiedener Wahrheitsstufen, so dass eine Tiefeninterpretation nicht nötig ist. Dieser Meinung wird von Hermeneutikern heftig widersprochen, weil sie beweisen können, dass der Koran an vielen Stellen sehr missverständliche und widersprüchliche Texte enthält, die ihren Grund nur in sich widersprechenden Hintergrundprämissen und historischen Einflüssen haben können. Deshalb soll der gläubige Anhänger des Islam (Ergebung in den Willen Gottes) den Koran nicht reflektieren, analysieren und interpretieren, sondern Gottes Wort in den gemeinten Sinne eins zu eins überführen. Und das geschieht am besten, wenn man den Text auswendig lernt.
Das gottgefällige Leben des Propheten, dem aber jede Göttlichkeit abgesprochen werden muss, bietet eine zweite Basis für die Lehren des Islam, denn dieses gottgeleitete Leben ist Vorbild für jeden Muslim, aber in seiner wahrheitsgeleiteten Stringenz unter den Koran einzuordnen. Aussprüche, Handlungen, Fragen, viele davon den Alltag betreffend, zu denen der Prophet Stellung bezogen hat, wurden von seiner Umgebung gesammelt und von den vier ersten Kalifen kommentiert. Neben der Schrift gibt es also eine kurze Tradition im Islam, in der diese Anweisungen gesammelt werden, deren Stellenwert meiner Ansicht nach viel zu hoch bewertet wird, da sie keine Gottesworte und vom Koran nicht autorisiert worden sind. Eine solche in sich geschlossene Anweisung wird Hadith genannt, von denen „bis zu einer Million [...] in sechs kanonischen Büchern zirkulieren“ (Barth 2003, 63), was eine nicht zu übersehende Fülle von Auslegungsvarianten zulässt, auch wenn nur etwa 9000 Hadithe anerkannt werden und zu vielfachem Anlass von Streitigkeiten innerhalb des Islam führen.
Im Augenblick scheint es so zu sein, als ob Mohammed ein höheres Ansehen als Gott bei den Muslimen genießt. Die in den Hadithen enthaltenen Anweisungen, die dort, wo der Koran keine Regelung vorgesehen hat, ihre Anwendungen finden, bilden zusammen mit dem Koran die Sunna, das, was gemäß dem Vorbild des Propheten „Brauch“ geworden ist.
Davon zu unterscheiden ist die Umma, die „Gemeinschaft aller Muslime“ (Tibi 2001, 30), wie sie Mohammed eingerichtet hat. Sie ist die inkorporierte Staatsidee des Islam und besagt, dass alle Muslime in einer staatlichen Gemeinschaft leben sollen. Oberhaupt eines solchen universalistischen Staates solle in der Nachfolge Mohammeds ein Kalif oder ein gerechter Imam sein. In der Moderne gibt es eine solche Umma nur als Utopie, weil nur islamische Nationalstaaten existieren, aber noch kein übergreifender Staatenverbund Wirklichkeit ist. Für den Islam aber ist die universalistische Idee einer Umma, einer „Weltmacht Islam“, (38) unterschwellig immer politisches Programm.
Es bleibt noch, die umstrittene Institution „Scharia“ vorzustellen, für viele Europäer ein negativ besetztes Reizwort. Er ist „der Sammelbegriff für islamische Lebensregeln, religiöse Pflichten und das religiös begründete, auf Offenbarung zurückgeführtes Recht des Islam“ (Barth 2003, 67). Auch regionale Modifikationen oder frauenfeindliche Lebens- und Bekleidungsvorschriften haben in diesem das ganze Leben des Muslims umfassende, religiös legitimierten Gesetzeswerk Eingang gefunden. Mohammeds Herabstufung der Frau in die zweite Reihe hat einen machohaften Männlichkeitswahn gefördert, den wir häufig bei jungen Türken und Jugendlichen anderer muslimischen Staaten wahrnehmen. Frauenrechte sind im Laufe der Geschichte des Islam immer stärker reduziert worden. Zu einem Existenzproblem wird, wenn andersgläubigen Minderheiten die Scharia aufgezwungen wird. Sie ist die Summe aus Koran, Sunna, Hadithen, Konsens und Analogieschluss. Wir haben hier ein umfassendes Rechtssystem, welches das gesamte menschliche Leben umschließt; es ist total, weil es alle Lebensbereiche regelt, damit eine große Lebenssicherheit vermittelt, es ist totalitär für diejenigen, die die Scharia als Bevormundung wahrnehmen.
Damit gibt es im Islam eine stufenförmig zu denkende Wahrheitspyramide. An der Spitze stehen Gott und der Koran; es folgen die Aussprüche Mohammeds, die Hadithe, zusammengefasst in der Sunna, der Analogieschluss, in dem Fragen, die nicht explizit im Koran und den Hadithen aufgeführt und gelöst worden sind, gemäß Ähnlichkeit mit ihnen entschieden werden, und der Konsens, die übereinstimmende Meinung von islamischen Theologen, der als Fatwa gutachterliches Ansehen genießt. Die Scharia umfasst alle diese Stufen insoweit, wie in sie Regelungen der vier Rechtsquellen eingeflossen sind.
Das Glaubensgut des Islam, in das Christliches, Jüdisches und Polytheistisches assimilierend aufgenommen worden sind, kann in zwei Bereiche gegliedert werden, Glaubensinhalte und Glaubenspraktiken.
Unverzichtbare Glaubensinhalte sind „die Einheit Gottes (monolithischer Monotheismus), die Macht der Engel, die Offenbarung, das Prophetentum, die Existenz des jenseitigen Lebens und der Glauben an die Vorherbestimmung“ (76). Als die fünf Säulen des Islam gelten die Glaubenspraktiken: das Glaubensbekenntnis, das fünfmal abzuleistende Tagesgebet, das Almosengeben, das Fasten und die Pilgerfahrt, die Hadsch.
Ehe jetzt die These ‚Der Islam besitzt ein implizites Ideologiepotential, das besonders leicht aktivierbar ist und als Islamismus heute den Islam und seine politischen Grundlinien bestimmt’, geprüft werden kann, ist eine eigene Standortbestimmung notwendig, die auf anthropologischer Grundlage beruht, weil nämlich der Begriff „Ideologie“ gemäß der Theorie Tepes zu der dem Menschen eigentlich konstituierenden Bestimmung seines Wesens wird. Seine Definition des Menschen als „illusionsanfälliges Tier“ (1988, 7) ist wegen ihrer zunächst befremdlich anmutenden Begriffswahl erklärungsbedürftig.
2. Darstellung des eigenen ideologiefunktionellen Standpunktes aus Sicht der Kulturanthropologie im Vergleich zum islamischen Menschenbild
Zwischen dem islamischen Menschenbild, das im Koran niedergelegt ist, und dem der wissenschaftlichen Kulturanthropologie bestehen, wie nicht anders zu erwarten, fundamentale Unterschiede, die sich in den letzten Jahrzehnten noch verschärft haben, weil eine muslimische Immigration nach Europa eingesetzt hat, die statt zu Assimilation zu Parallelgesellschaften geführt hat. Die räumliche Nähe hat beide Wertsysteme also nicht zusammengeführt, sondern immer mehr voneinander entfremdet.
Durch das Satellitenfernsehen sind die Moslems täglich mit ihrer Heimat verbunden und nehmen die sie umgebende Wirklichkeit hauptsächlich aus dieser Perspektive wahr. Sie sind „mit ihrem Kopf in der Heimat, mit ihrem Körper in Deutschland“; doch dadurch, dass diese unterschiedlichen Wertsysteme ständig mehr auseinanderdriften, drohen sie die persönliche Identität der Muslime und die der politischen Identität der Einwandererstaaten zu zerreißen. Den Unterschied zwischen dem Menschenbild der Kulturanthropologie und dem des Korans gilt es jetzt, namhaft zu machen.
2.1 Kulturanthropologische Prämissen
Nach dieser Theorie ist der Mensch kein Wesen, das von Gott sicher durch diese Welt geleitet wird, er ist ein instinktreduziertes Wesen mit offenen genetischen Programmen, die Lernen ermöglichen. Das Tier ist durch AAMs (Angeborene Auslösende Mechanismen) a priori an seine Welt angepasst, die wenig Modifikationsspielraum zulassen. Das Instinktrepertoire eines Lebewesens, ein genetisch verankertes Vorwissen für charakteristische Aktionen und Reaktionen, passt dieses im Voraus so seinem Lebensraum an, dass es überleben kann.
Doch bei der Evolution des Menschen hat eine Instinktreduktion stattgefunden; das in den Genen gespeicherte antizipierende Wissen von der Außenwelt besteht teilweise nur noch in offenen Lernprogrammen. Während AAMs, etwa ‚Feindbilder’, die zur Flucht nötigen, nur sehr selektiv und attrappenhaft ansprechen, haben sich beim Menschen sehr stark erweiterte Formen der Wissensantizipation entwickelt, die von Kant entdeckten und von Lorenz (1997) naturhistorisch gedeuteten Kategorien, die gleichsam Regeln der Gegenstandserkennung enthalten, und zwar a priori. Was ein möglicher Gegenstand der Erfahrung sein kann, wird vom Menschen schon im Voraus gewusst, und in jedem konkreten gedachten Gegenstand sind die Anschauungsformen Raum und Zeit wie auch die Kategorien Quantität, Qualität, Relation, Modalität mitrepräsentiert. Sie arbeiten, indem sie vorgängig ein Ordnungssystem antizipieren, durch das die einströmende Datenmenge strukturiert wird. Dadurch wird der Mensch ein „weltoffenes Tier“ (Tepe), das unendlich viele mögliche Gegenstände wahrnehmen, beschreiben und entsprechend auf sie reagieren kann. Doch diese Evolution hin zur Flexibilität und gleichzeitiger Abstreifung der instinktgeleiteten Verhaltensweisen muss der Mensch mit Entlassung aus der Sicherheit dieses schützenden Schirmes und Schildes bezahlen.
Damit bekommt er ein Problem: Er ist, paradox gesprochen, gezwungen, frei zu sein. (Es ist kein Gegenargument, dass viele Menschen diese Freiheit zugunsten von institutionellen Sicherheiten aufgeben und sich unter deren Schutz begeben. Religionen z.B. bieten dem Verunsicherten das Gefühl der eigenen Sicherheit.) Seine Selbsterkenntnis lässt ihn unablässig spüren, dass er ein ständig gefährdetes, ständig leidumdrohtes, sterbliches Wesen ist, da es keine leitenden Instinktprogramme mehr gibt. „Realitäts- und Leidensdruck“ (Tepe / Topitsch) hemmen jede Lebensbewältigung. Jetzt helfen ihm auch die offenen Lernprogramme nichts; denn wozu soll der Mensch etwas lernen?
Er ist zuvörderst gezwungen, sich einen Instinktersatz zu schaffen, der ihm die lebensnotwendige Sicherheit seines Lebensvollzuges garantiert. Dieser ist notwendig, denn der Normalmensch ist kein Romulus und Remus und auch kein Robinson, die in Isolation aufwachsen können, sondern ein Wesen, das in Kultur eingebettet ist. Der Mensch ist ein „Kulturwesen von seiner Natur her“ (Gehlen / Lorenz), d.h. eine menschliche Natur als Artbestimmung gibt es nicht, was einer gemeinsamen biologischen Grundausstattung nicht widerspricht, weil seine ‚Natur’ in der notwendigen Aufnahme von Kultur besteht, so dass er ein von der Kultur zum zweiten Male erschaffenes Wesen wird, das selbst wieder Kultur hervorbringen kann, die sich in einer unüberschaubaren Vielfalt präsentiert.
Diese Kultur begegnet dem Menschen in einer unübersehbaren Fülle von Entwürfen, bedeutet aber durch „Institutionalisierung“ (Gehlen) Stabilisierung seiner Bedürfnisse. Sie erfüllt ähnliche Aufgaben wie der Instinkt: der Mensch wird in eine bestimmte Kultur hineingeboren, deren Aprioris und Werte er assimiliert. Staatliche und gesellschaftliche Institutionen, durch Tradition, Sanktionen und Moral festgeschriebene Regeln des Zusammenlebens, mythische und religiöse Bräuche, gemeinsame Sprache und gemeinsame Vergangenheit sind der Kitt, der jetzt einen sinnerfüllten Lebensvollzug ermöglicht. Man kann deshalb sogar von einem metaphysischen Bedürfnis des Menschen nach ewig geltenden Werten sprechen; doch die menschliche Geschichte besteht im Gegenteil aus einer Abfolge sich ablösender Wertsysteme. Während die drei Grundverhaltensweisen Kognition, Emotion und Willen das tierische Leben als Verhalten, als Einheit von Wissen, Fühlen und Handlungsbereitschaft gestalten, haben sich diese Vermögen beim Menschen differenziert. Das Gehirn als Überlebensorgan ist evolutiv zusätzlich zum Erkenntnisorgan geworden, das relativ unabhängig von Gefühlen und persönlichen Interessenlagen urteilen kann. Im Wissenserwerb steckt also Objektivität, es (das Wissen) kann nicht ganz falsch sein, obwohl es verschiedenen kulturellen und persönlichen Quellen entspringt; denn Leben braucht Sicherheit. Unsere Ratio ist, so die realistische Prämisse, fähig, die Realität, wenn auch in bescheidenem Maß, abzubilden.
Was den Menschen durch den „objektiven Geist“ (Hegel), Kultur genannt, sehr lange verborgen bleibt, ist, dass dieser in Wirklichkeit nur ein Produkt des „subjektiven Geistes“ ist, Produkt des menschlichen Geistesschaffens, das mit ihm entsteht, sich wandelt und vergeht. Solange, wie Mythisches und Religiöses als ewig Dauerndes zusammen mit einer dazu passenden lebensnahen Rationalität der Wahrnehmung der Natur als Realität aufgefasst werden, ist eine psychische Existenzgrundsicherung gegeben, die jedoch schon ins Wanken gerät, als Mythen und Religionen sich verschriftlichen und damit eine hermeneutische Befragung nach ihrem Wahrheitsgehalt zulassen müssen. Sie sind – so das Ergebnis der Befragung – keine Objektivationen des Göttlichen oder Geistigen, sondern nur noch Symbole einer vorher gelebten Wirklichkeit, die nun zur Fiktion wird. Sie sind nur lebensnotwendige Täuschungen (falls sie einen objektiven Wahrheitsanspruch anmelden), sie ermöglichen ein persönlich erfülltes und sozial getragenes Leben dem, der glaubt, so dass Tepe vom Menschen als dem ideologieverfallenen Wesen sprechen kann, dessen anthropologische Konstante die Angewiesenheit auf essentialisierte Illusionen (kulturbewahrende Institutionen) beschreibt.
Man kann es eine Tragödie nennen, dass die Untersuchung der mythischen und religiösen Wertsysteme den naiven Glauben an die Wahrheit der Identität stiftenden Symbolwelt zerstört hat. Es stellte sich nämlich bald heraus, dass diese ontologischen Entwürfe nicht stimmen, dass sie kollektive Projektionen des menschlichen Wollens sind, damit das, was im Menschen als Hoffnung, Wunsch, Utopie, Ideal, Illusion auf Wirklichkeit und Verwirklichung drängt, auch in Wahrheit so existiert, wie es existieren soll.
Die eigene Nichtigkeit kann mit diesen oft verdrehten Projektionen kompensiert werden: aus dem Sklaven auf der Erde wird ein Herr im Himmel, die irdische Sterblichkeit verwandelt sich als ewiges Leben nach dem Tode, an das man fest glaubt, so dass gerade derjenige, dessen irdisches Schicksal bejammernswert ist, im Himmel dafür mit ewigen Freuden belohnt wird. Dieses selbst erdachte und dann rationalisierte Trostpotential, dass dasjenige, was sein soll, auch ist, das subjektive Wünsche in objektive Wirklichkeit verwandelt, hat unschätzbare kulturelle Güter hervorgebracht, ist aber gleichzeitig Quelle von unzulässigen Objektivierungen.
Was aber geschähe, würde es eine Möglichkeit geben, die Menschheit illusionsfrei existieren zu lassen? Diese Frage berührt die permanente Krisenstimmung der Moderne; denn gerade dadurch, dass sie grundsätzlich alle Werte kognitiv auf ihren Wahrheitsgehalt im Sinne der positiven Naturwissenschaften befragt, muss sie feststellen, dass alles, was unsere Kultur hervorgebracht hat, nämlich Werte, an sich keine überzeitliche Geltung wie Naturgesetze beanspruchen können. Im Wissen, dass jedes Wertverständnis und Wertverhalten nur einen temporären Nutzen für die Menschheit erbringt, dass jede geschichtliche Epoche von sich wandelnden Werten bestimmt wird, liegt die von Nietzsche am radikalsten vertretene These des Nihilismus zu Grunde, dass selbst das Schaffen neuer Werte schon a priori ihre Destruktion bedeutet. Das Heil in der Wahrheit der Naturwissenschaften zu suchen, scheitert daran, dass die Natur in keiner Weise Antworten auf die Fragen unseres Lebens geben kann, weil sie selbst wertfrei existiert und nur wertneutral wissenschaftlich erforscht werden kann.
Die Welt des Intellekts ist kalt, sie gewährt kein wärmendes Lebensgefühl. Der zugedachte absolute, aber verengte Wahrheitsanspruch der positiven Wissenschaften, der ihr von außen als Wissenschaftsgläubigkeit und –hörigkeit aufgenötigt wird, sorgt für ein Hinterhofdasein von Werten, Emotionen, Erleben, spirituellen Erfahrungen: das metaphysische Bedürfnis nach existenzieller Geborgenheit wird nicht mehr bedient. Doch gerade diese speisen das menschliche Bedürfnis nach Kunst, Kultur, moralischer Selbstwertigkeit und Daseinsbejahenden Religionen, die durch Traditionen und Institutionen ihm ein sinnhaftes Leben vermitteln. Als ein auf soziale und kulturelle Beziehungen angewiesenes Wesen (verlängerte Kindheit, „physiologische Frühgeburt“, „sekundärer Nesthocker“) (Portmann) bietet die Kultur dem Menschen den Schutzraum zu seiner Entfaltung, damit er den „Leidens- und Realitätsdruck“ sublimieren kann. Die dadurch gebändigte Existenzangst kann jedoch dann wieder ungehemmt ausbrechen, wenn der Mensch den bloßen Konstruktcharakter dieser Kulturwelt reflektiert, was heute der Fall ist, so dass viele Menschen an der Moderne leiden.
Jeder Mensch ist durch quasitranszendentale Konstanten seiner Kultur schon im Voraus auf sie geprägt. die wir mit „Werthaltungsgebundenheit“ und mit „Weltauffassungsgebundenheit“ Tepe 1988, 10) übersetzen können. Letztere beschränkt unseren kognitiven Erwartungshorizont auf das in dieser Zeit Denkbare, erstere dient als Kompensation vom Leidensdruck, weist aber noch mehr einen sozialen Sinnhorizont zu, um ein gutes Leben zu führen. Doch wenn der Konstruktcharakter der menschlichen Kulturwerte transparent geworden ist, wenn dem Menschen seiner Bedeutungslosigkeit schmerzlich bewusst geworden ist, sucht er nach sicheren, überzeugenden Werten und findet in Wirklichkeit nur Utopien, Ideologien(-) (siehe nächster Abschnitt), als wahr angenommene Illusionen, rauschhafte Verklärungen des Daseins, phantastische Kartenhäuser, wenn er diese nicht metaphysisch überhöht, also mit ‚höheren Weihen’ ausstattet. An dieser Stelle kommen wir auf Tepes Theorie der Illusionen (1988) zurück, in der er von der „unaufhebbaren Ideologiehaftigkeit“ (8) des menschlichen Daseins ausgeht. Damit fasst er diesen Begriff sehr weit, als „Abhängigkeit von Wertorientierungen“ (8). Die durch Instinktreduktion bewirkte anfängliche biologische Orientierungslosigkeit wird durch das kulturelle Wertesystem, in welchem der junge Mensch eingebettet aufwächst, zunächst mehr als ausgeglichen.
Aus diesem umfassenden und wertneutralen bis wertpositiven Ideologiebegriff, den man auch mit Kulturgebundenheit oder „Werthaltigkeit“ (8) übersetzen kann, entwickelt Tepe seine beiden Ideologiebegriffe (+) und (-), deren inhaltliche Bestimmung und Kennzeichnung der Autor übernehmen möchte, wenn der Kontext nicht eine eindeutige Zuordnung zulässt. Allgemein ist der Mensch von Ideologie(+) bestimmt, von Werthaltungen, die grundsätzlich wie ein Apriori das menschliche Leben oft unbewusst und unbemerkt leiten. Ideologie(+) ist die kulturanthropologische Bezeichnung für den Kampf des Menschen gegen den lähmenden Realitätsdruck. Wenn dieser aber explizit projektiv die Dinge so verwandelt, dass aus Wünschen und Wollen ontologisiertes kognitives und rationales Sein wird, dann ist der engere Begriff von Ideologie(-) maßgebend, weil etwas, was nur normativen Charakter hat, mit der Folge zu einem deskriptiven Gegenstand gemacht wird, dass ein kognitiv allgemeingültiger Wahrheitsanspruch erhoben werden kann und auch erhoben wird. Diese Verwandlung von Normativem zum Deskriptiven ist, ideologiekritisch gesehen, als Taschenspielertrick zu beurteilen, der zu einem „Erkenntnisdefizit“ (8) führt.
Ein kurzer Streifzug in Richtung Islam macht das Zentralproblem deutlich: ‚Wie ist der absolute, von Gott autorisierte Wahrheitsanspruch dieser Religion ideologiekritisch zu bewerten? Liegt hier eine voluntaristische Projektion, dass das, was sein soll, Gottes Allmacht, die menschliche Existenz auch de facto trägt, vor?’ Der Islam offeriert dem Menschen ein ewiges Leben im Paradies, wenn er Gottes Willen, von Mohammed verkündet, erfüllt, er verspricht ewige Existenzsicherheit, ohne diese empirisch beweisen zu können; unser dem Positivismus und dem Kritischen Rationalismus verpflichteter Erkenntnisanspruch sieht im Menschen ein Wesen, das prinzipiell von jeder Transzendenz ausgeschlossen ist, so dass es sich durch Schaffung und Teilhabe von Kultur einen Ersatz schaffen muss, der als solcher immer schon durchschaut, sich nur als zeitlich begrenzter Wertfunktion erfüllen kann. Er ist im Sinne Nietzsches eine „Lebenslüge“.
Die westliche Anthropologie lässt sich in den Sätzen zusammenfassen: Der Mensch ist ein Wesen, das durch die biologische Evolution entstanden ist und sich durch die kulturelle Evolution selbst geschaffen hat und ständig sich durch Hervorbringung von Kultur selbst erschafft. Er ist Herr über sich selbst, aber ständig durch Sinnentleerung des Seins bedroht, so dass er sich nach der Sicherheit transzendenter Mächte sehnt.