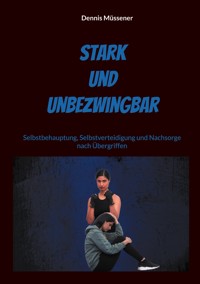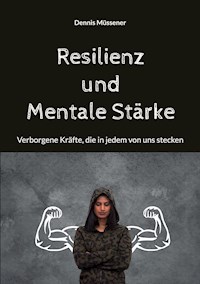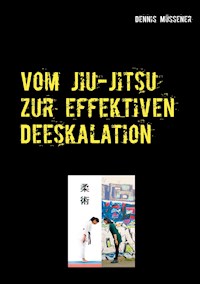
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Anthologie - Reihe: Mentale Stärke gewinnen
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist kein klassisches Kampfsportbuch. Es handelt vielmehr von der Philosophie des Jiu-Jitsu "Siegen durch Nachgeben". Es geht nicht um die ultimative Technik einen Kampf zu beenden, sondern viel mehr um das Erlangen mentaler Stärke um in möglichen Konfliktsituationen einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen zu können. Neben einer starken Persönlichkeit ist die richtige Kommunikation ein wichtiger Bestandteil um kritische Situationen eskalationsfrei gestalten zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Wesen und Wert einer ostasiatischen Kampfkunst
für ein professionelles deeskalierendes Verhalten in
alltäglichen Anforderungssituationen
Inhalt
I.1 Zur Person mit einem Geleitwort von Dennis Müssener
I.2 Für wen könnte dieses Buch interessant sein?
II.1 Der Mythos des Jiu-Jitsu als Legende – Siegen durch Nachgeben
II.2 Die Geschichte des Jiu-Jitsu
III. Einklang von Körper, Geist und Seele im Jiu-Jitsu als Unterbau für Deeskalationsstrategien
IV.1 Die sieben Tugenden erlangen
IV.2 Mentale Stärke erlangen
V.1 Die sechs Komponenten – die Deeskalations-Etikette nach Dennis Müssener
V.2 Innere Stärke
V.3 Aufrichtigkeit
V.4 Wertschätzung
V.5 Selbstbeherrschung
V.6 Positives Denken
V.7 Mögliches Scheitern einplanen
VI. Siegen durch Nachgeben
VII. Shu-Ha-Ri: Das Prinzip vom Geben und Nehmen
VIII. Das S-O-R-Modell
VIII.1 Das dunkle Waldstück
IX. Formen und aggressives Verhalten
X. Was sind Konflikte?
XI. Die Eskalation von Konflikten nach Friedrich Glasl
XI.1 Vier Seiten einer Botschaft (Schulz von Thun)
XII. Was sind Angriffe?
XIII.1 Deeskalation
XIII.2 Die Methoden
XIII.2.1 Die Ansprech-Methode nach Erich Rahn
XIII.2.2 Fragen stellen-Methode
XIII.2.3 Trennen-Methode
XIII.2.4 Ich-Botschaften-Methode
XIII.2.5 Du-oder-Sie-Methode
XIV.1 Grundregeln der Deeskalation
XIV.2 Fehler bei der Deeskalation
XIV.3 Durchführung einer erfolgreichen Deeskalation
XV. Exit Strategie: Die drei Stufen der Deeskalation
XVI. Deeskalation ... gescheitert!
XVII. Gewalt gegen Rettungskräfte
XVIII. Schlusswort
XIX. Danksagung
XX. Schülerrezensionen
XXI. Literaturverzeichnis
I.1 Zur Person mit einem Geleitwort von Dennis Müssener
Eigentlich wollte ich nur meine schriftliche Arbeit für den bevorstehenden 5. Dan im Jiu-Jitsu schreiben und gar nicht so weit ausschweifen. Ich versank jedoch immer mehr in dem Thema, und es fing plötzlich an Spaß zu machen. Und so entschied ich mich, dieses Buch zu verfassen, denn wie im Jiu-Jitsu kann auch das Schreiben von Büchern eine Passion werden, wenn das Thema passt.
Zuerst vielleicht ein paar Dinge über mich. Ich fange am besten ganz vorne an. Da ich immer sehr schmächtig war, erzählte meine damalige Grundschullehrerin meinen Eltern, dass ich dringend Sport machen müsste. Daraufhin meldete mich meine Mutter im Turnverein an. Dort war ich einige Male, aber so richtig Freude hatte ich nie. Als mein Vater mich dann eines Tages abholte und sah, dass ich eine Strumpfhose zum Sport trug, war es das dann auch schon mit der Karriere als Turner gewesen, obwohl natürlich sogar Jean-Claude van Damme diesem Kreis entstammt.
Er nahm mich mit zum Judo und unterrichtete mich auch einige Jahre, ehe ich mit 15 Jahren zum Jiu-Jitsu wechselte. Zwischen 1999 und 2009 (17-27 Jahre) nahm ich an diversen Turnieren, Wettkämpfen und Meisterschaften teil und bestritt weit über 200 Kämpfe.
Rückblickend bin ich jedoch viel stolzer auf die Auseinandersetzungen, die außerhalb der Matte nicht stattfanden, da in diesem Alter auch in Alltagssituationen Konflikte mit hohem Risikopotential entstehen können. Im Nachhinein kann man sagen, dass es immer besser ist, von einer Schlägerei berichten zu können, die niemals stattgefunden hat.
Solche Situationen gab es viele, egal ob man in Discotheken, Bars oder auf Partys unterwegs war, und das war ich zur damaligen Zeit, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene, oft.
Auch während meiner Zeit als Sicherheitsfachkraft in einem Nachtclub, die ich neben der Ausbildung absolvierte, kam es immer wieder zu Situationen, in denen es brenzlig wurde und sich eigentlich unvermeidliche Konflikte anbahnten.
Meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger bedeutete mir viel, deshalb war es in meinem Job im Sicherheitsgewerbe meine größte Intention, Schlägereien zu vermeiden, da ein positiver Leumund in der Gesundheitsbranche erforderlich ist, um überhaupt als examinierte Kraft tätig werden zu können. Intuitiv versuchte ich deshalb schon damals deeskalierend in Konfliktsituationen vorzugehen, ohne große Ahnung zu haben, wie man das richtig umsetzt.
Es kam aber in den allerwenigsten Fällen zu körperlichen Auseinandersetzungen. Natürlich hatte ich schon einen kampferprobten Hintergrund, aber das ist kein Freifahrtschein im Alltag, wie viele fälschlicherweise meinen. Man betreibt lediglich Chancenoptimierung zu seinen Gunsten, schließlich weiß man auch nicht, wer einem gegenübersteht.
„Seinen Gegner zu unterschätzen kommt dem Verlust eines Schatzes gleich.“
Chinesisches Sprichwort
2008 wechselte ich dann nach Bochum, wo ich auf meinen Lehrer Großmeister Verna Domenico Capraro traf. Obwohl ich bereits seit nun fast sieben Jahren den blauen Gurt (2. Kyu) besaß, hatte ich das Gefühl von ganz vorne anzufangen, sozusagen bei 0. Ich erkannte die Vielfältigkeit, die diese Sportart mit sich brachte und war in höchstem Maße davon beeindruckt.
Der Großmeister legte sehr viel Wert auf die Einhaltung der Dojo-Etikette (dazu später mehr) und ahndete jegliche Art von Vergehen gegen selbige. Der Schwerpunkt lag im Training in der Selbstverteidigung und der Philosophie des Jiu-Jitsu. Na klar, zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits (mit Judo zusammen) 20 Jahre Kampfsporterfahrung gesammelt und konnte dem Wortlaut und der Wortbedeutung nach über die Philosophie des Jiu-Jitsu Auskunft geben, aber mehr eben nicht. Wie auch? In Wettkämpfen lernt man die Philosophie und Tradition des Sports auch nicht kennen. Den tieferen Sinn und Wert der philosophischen Grundlagen begriff ich nach und nach aber erst als Schüler meines Mentors. Viel Halt und Disziplinierung haben mir die ständige Beachtung der Etikette sowie die Abfragung japanischer Terminologien gebracht und was mir damals als noch viel schlimmer erschien: Ich musste erklären, warum welche Technik wie funktionierte.
Der Großmeister wollte wissen, warum ich was wie machte und kritisierte mich stark, wenn ich Fehler machte oder in Erklärungsnot geriet. Was mir am Anfang wie Schikane vorkam, ließ mich immer mehr wachsen, und ich verstand von Mal zu Mal das Prinzip „Siegen durch Nachgeben“ besser und welche Bedeutung dieses im Rahmen der Umsetzung eines Stils und einer Lebenseinstellung innerhalb der Kampfkunst Jiu-Jitsu hatte. Der Budosport hat das Ziel, den wahren Charakter zu formen. Der Weg dahin ist jedoch lang und geht nur über Versagen, Fehler und Rückschläge. Der wichtigste Verbündete, um diesen scheinbar endlosen Weg voller Hindernisse und Tücken wie Neid, falschen Stolz und Selbstzweifel zu meistern, ist die Geduld. Nur mit ihr überwinden wir das eigene Zweifeln in uns, geben nicht auf und machen ständig weiter, bis wir am Ziel angelangt sind.
Die Techniken waren zum Teil von brachialer Ästhetik und hatten nicht viel mit einer sanften Kunst zu tun, aber das Training beschränkte sich nicht nur auf die Lehre von Selbstverteidigungstechniken. Je mehr Selbstsicherheit ich in der Erkenntnis der Gefährlichkeit der Techniken erwarb, desto mehr wurde mir klar, dass ich diese nur im äußersten Notfall gegen Menschen anwenden wollte. Die großen Budosportler benutzen ihre äußere Kraft lediglich im Training oder um andere zu schützen.
„Wer diese Macht also missbraucht, verschwendet seine Energie und gerät in ein dunkles Labyrinth, verliert jegliche Hoffnung auf wahre Meisterschaft, auf das Vordringen bis zum letzten Geheimnis.“
Zitat aus „Die Kunst zu siegen, ohne zu kämpfen“
Da die Eigenart des Jiu-Jitsu und der japanischen Kampfkünste die Gewaltlosigkeit ist, verachtete es der Großmeister zutiefst, wenn sich Schüler außerhalb des Trainings prügelten und warf jene, welche dies trotzdem taten, aus dem Verein.
Er lehrte mich den Weg des Shu-Ha-Ri, worauf ich später noch zurückkommen werde. Anfangs konnte ich damit nur wenig anfangen, und es klang eher wie ein Kampfschrei aus einem Videospiel.
Heute ist das Shu-Ha-Ri tief in meinem Leben und meinem Bewusstsein verwurzelt, und ich gebe dieses Wissen an meine Schüler weiter. Im Dezember 2011 bestand ich meine Prüfung zum 1. Dan und durfte mich fortan nun selbst Sensei (Meister) nennen. Damit war das Lernen aber alles andere als beendet. Denn im Jiu-Jitsu ist das Lernen ein ständiger, unentwegter Prozess für Jeden. Ich wurde noch mehr von meinem Großmeister, mit dem ich in der Zwischenzeit ein freundschaftliches Verhältnis hatte, gefordert. Ich musste nun das Wissen, die Techniken und vor allem die Philosophie an die nächsten Schüler weitergeben, und das tat ich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn auch nicht immer fehlerfrei.
2013 kehrte Großmeister Verna Domenico Capraro zurück auf die Philippinnen und seine Meisterschüler übernahmen den Verein. 2015 wurde ich dann Cheftrainer der Jiu-Jitsugruppe, welche ich bis heute im Sinne der Lehren meines Großmeisters fortzuführen gedenke.
I.2 Für wen könnte dieses Buch interessant sein?
Obwohl sich in dem Titel der Begriff „Jiu-Jitsu“ wiederfindet, ist dies kein klassisches Jiu-Jitsu Buch im typischen Sinne. Es handelt ebenso wenig von Selbstverteidigungstechniken, wie sie im Training oder in Seminaren unterrichtet werden. Ich demonstriere auch nicht anhand von Abbildungen Hebel, Würfe oder sonstige Griffe, obwohl ja gerade diese feste Bestandteile der „sanften Kunst“ sind. Dazu gibt es jede Menge anderer hervorragender Fachbücher, die sich mit dem Thema beschäftigen und gute Anreize zur Verbesserung des Trainings und der Trainingseigenschaften liefern. Ich spreche ganz bewusst nur von Anreizen, denn Selbstverteidigung lernt man wie auch jede andere Sportart wie Fußball oder Segeln nicht durch das Lesen von Büchern, ganz egal wie intensiv man auch liest, sondern nur durch jahrelanges kontinuierliches Training. Auch die „geheime ultimative“ Technik für den nächsten Kampf wird hier nicht zu finden sein, aber vielleicht die Technik, die einen Kampf erspart.
„Ein Gegner, den du besiegst, bleibt dein Feind. Ein Feind, den du überzeugst, wird dein Freund.“
Chinesisches Sprichwort
Ich möchte mich der Philosophie dieser schönen Kampfkunst „Siegen durch Nachgeben“ widmen. Obwohl es sich um eine Kampfsportart handelt, steht nicht der Kampf im Vordergrund, sondern das Vermeiden eines Kampfes. Durch das regelmäßige Training wird an innerer Stärke gewonnen und der Charakter eines jeden Einzelnen geformt. Diese Stärke ist es, die wir von der Matte in den Alltag projizieren und die es uns ermöglicht, einen friedvollen Umgang mit unserem Umfeld zu führen. Unser äußeres Verhalten ist ein Zeichen der inneren Veränderung. Sollte es trotz mentaler Stärke und der aufrechten Einstellung zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen, hat man dennoch eine bessere Chance, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen, um handlungsfähig zu bleiben. Wie Pat Morita in Karate Kid schon sagte: „Kämpfen ist nicht gut, aber wenn kämpfen dann gewinnen.“ Dieses Buch ist aber nicht ausschließlich an Jiu-Jitsuka oder Kampfsportler im Allgemeinen gerichtet, sondern an jene, die Gefahrensituationen lieber aus dem Weg gehen möchten, aber vielleicht nicht ganz genau wissen wie. Ich möchte Anreize und Strategien aufzeigen, die dafür nützlich sein könnten. Leider gibt es nicht die ultimative Technik, da jede Situation neue Ausgangsvoraussetzungen und andere Bedingungen aufweist und auch Technikpräferenzen eine entscheidende Rolle spielen. Das trifft auf der Matte, aber auch für die Deeskalation zu. Man muss nicht jede der diversen verschiedenen Deeskalationsstrategien beherrschen, sondern sich einer Handvoll effektiver Techniken bedienen, die zu der eigenen Persönlichkeit passen und welche man vor allem auch verinnerlichen können sollte. Durch meine langjährige Tätigkeit im Pflege- und Erziehungsdienst im Maßregelvollzug (psychiatrisches Krankenhaus für psychisch erkrankte Straftäter) begegne ich immer wieder potenziellen Gefahren- sowie Konfliktsituationen und habe diese Erfahrungswerte genutzt, um meine Deeskalationsfähigkeit zu trainieren. Um ein gewaltfreies Leben führen zu können, habe ich aus den verschiedensten Strategien meine eigene, die auf mich persönlich zugeschnitten ist, entwickelt und diese „Etikette der Deeskalation“ genannt, angelehnt an die Budo-Etikette. Genau so entstand auch vor einigen Jahrhunderten das heute uns bekannte Jiu-Jitsu. Es hat sich aus verschiedenen Stilen zusammengesetzt, immer wieder weiterentwickelt und verbindet heute traditionelle und moderne Kampfsportvorstellungen:
„Auch wenn unser Pfad ein ganz anderer ist als die Kampfkünste der Vergangenheit, ist es nicht notwendig, die alten Methoden völlig aufzugeben. Nimm die ehrwürdigen Traditionen in diese neue Kunst auf, indem du sie in ein neues Gewand kleidest, und baue auf den klassischen Stilen auf, um bessere Formen zu schaffen.“
Morihei Ueshiba
II.1 Der Mythos des Jiu-Jitsu als Legende – Siegen durch Nachgeben
Über den Ursprung und die Entstehung des Jiu-Jitsu gibt es bereits unzählige Bücher, welche sich mit diesem doch sehr komplexen Thema beschäftigen, da nur schwerlich herauszufinden ist, was historischorganisch der Ursprung des Jiu-Jitsu ist. Ich möchte nur auf den Mythos der Entstehung eingehen, auch wenn dieser der Wahrheit nicht wirklich entspricht und den Adam Kraska in seinem Buch „Die Geschichte des Jiu-Jitsu“ kritisch in Frage stellt und daher wohl eher eine Legende sein dürfte.
Der Kinderarzt Akiyama Shirobei Yoshitoki aus Nagasaki reiste um 1660 nach China, um dort sein medizinisches Wissen zu erweitern. Er suchte nach neuer Heilkunde, die er mit nach Japan bringen wollte. Während seiner Reise hat er auch einige chinesische Kampftechniken erlernt, welche jedoch sehr kraftaufwendig waren. Zurück in Japan, soll er durch Meditation vor einem Tempel weitere Techniken erlernt haben. An einem verschneiten Wintertag saß er in seinem Garten und beobachtete seine Bäume. Er sah wie die Äste einer starken Eiche durch die schwere Last des Schnees durchbrachen und zerstört wurden, während sich die Äste der Weiden aufgrund des enormen Gewichts des Schnees beugten und somit der Schnee herunterglitt und die Äste heil blieben. Aufgrund dieser Erkenntnis soll er das Jiu-Jitsu mit dem Prinzip „Siegen durch Nachgeben“ entwickelt haben.1 Dieses Prinzip ist technisch wie auch philosophisch zu sehen, denn sein Ziel war es den Kampf zu vermeiden. Er gründete seine Schule mit dem Namen Yoshin-Ryu, zu Deutsch die „Weidenherzschule“.
In dieser Schule soll er auch drei Samurai unterrichtet haben, welche die Techniken ihres Meister individuell weiterentwickelten und eigene Schulen gründeten. Sie sollen die Stile Fukuno-Ryu, Miura-Ryu und Isogai-Ryu gegründet haben.
1 Kraska, Adam: Die Geschichte des Jiu-Jitsu, Hrsg.Kristkeitz, Werner, Heidelberg 2020