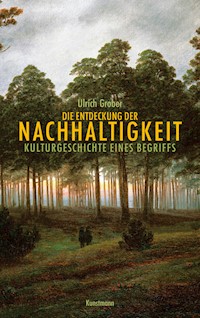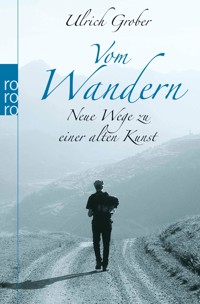
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die alte Kunst des Wanderns ist heute der Einspruch gegen das Diktat der Beschleunigung und wird deshalb immer beliebter. Wer wandert, kommt ins Sinnieren, deshalb ist dieses Buch auch ein kleines philosophisches Brevier, das uns hilft, wieder uns selbst zu entdecken, und das beweist, dass sanfte Bewegung und Orientierung in der Natur zur allergrößten Zufriedenheit führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulrich Grober
Vom Wandern
Neue Wege zu einer alten Kunst
Über dieses Buch
Die alte Kunst des Wanderns ist heute der Einspruch gegen das Diktat der Beschleunigung und wird deshalb immer beliebter. Wer wandert, kommt ins Sinnieren, deshalb ist dieses Buch auch ein kleines philosophisches Brevier, das uns hilft, wieder uns selbst zu entdecken, und das beweist, dass sanfte Bewegung und Orientierung in der Natur zur allergrößten Zufriedenheit führen.
Vita
Ulrich Grober, geboren 1949 in Lippstadt/Westfalen, hat Germanistik und Anglistik in Frankfurt und Bochum studiert und anschließend in mehreren soziokulturellen Projekten sowie in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Seit 1992 ist er freier Autor, Publizist und Journalist. Er schreibt regelmäßig für DIE ZEIT, taz, Deutschlandradio, WDR, RBB und viele andere. Seine zahlreichen Reportagen, Radiosendungen, Dokumentationen, Essays konzentrieren sich vor allem auf die Themen Literatur und Naturerfahrung, Kulturgeschichte und Zukunftsvisionen, Wandern und sanfter Tourismus, Ökologie und Nachhaltigkeit. 1998 erschien sein erstes Buch «Ausstieg in die Zukunft».Der Autor lebt in Marl am Rand des Ruhrgebiets, ist verheiratet, hat eine Tochter und ist passionierter Wanderer von Kindesbeinen an.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2011
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach dem Original des Zweitausendeins-Verlages
Coverabbildung @ Fotoarchiv Herbert Schnierle-Lutz, Bad Teinach
ISBN 978-3-644-44101-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zugänge. Vom Wandern im 21. Jahrhundert
Einfach verschwinden. Losgehen. Vier bis fünf Kilometer in der Stunde zu Fuß zurücklegen. Mal weniger, mal mehr, je nach Gelände und Witterung. Ziele, Routen, Pausen selber wählen. Richtungen ändern. Vom Weg abweichen. Im Weglosen gehen. Souverän über Raum und Zeit verfügen. Gehen und tragen. Alles, was man braucht, im Rucksack bei sich haben. Sich etwas zumuten. Bis hart an die eigene Grenze gehen. Blickachsen, Hörräume, Duftfelder wahrnehmen und immer wieder pendeln: zur Innenschau, der Zwiesprache mit sich selbst, dem Hören auf die innere Stimme: Essenz des Wanderns …
Wandern im 21. Jahrhundert? Wie bitte? Unsere Art, mobil zu sein, geht in eine andere Richtung. Unsere Erlebniswelten sind anders geartet. Man lebt temporeich und fast grenzenlos. In 24 Stunden ist mit dem Flugzeug jeder Punkt des Planeten zu erreichen. Per Fernbedienung oder Mausklick überwindet man den Raum in Sekundenschnelle. Alles wird «besehbar». Für nahezu jede Aktivität außerhalb der eigenen vier Wände benutzen wir das Auto oder öffentliche Transportmittel. Kaum etwas scheint noch «begehbar». Zu Fuß bewegen wir uns allenfalls zwischen Parkplatz und Arbeitsplatz, in den Passagen der urbanen Einkaufs- und Erlebniswelten. Wie weit gehen wir noch aus eigener Körperkraft? Wenig mehr als vier oder fünf Kilometer pro Woche. Am jeweiligen «Standort» wird gearbeitet. Meist im Sitzen. Ein Großteil der Freizeit spielt sich via Medien in den globalen Räumen ab. Ebenfalls im Sitzen. Unsere mentalen Landkarten erweitern sich, aber verarmen auch. Die Sehnsüchte richten sich auf immer fernere Ziele, auf das ganz Andere. Die «wertvollsten Wochen des Jahres» sind für möglichst exotische Schauplätze reserviert. Dort erfüllen wir uns unsere Lebenswünsche. Dort «lebt» man.
Diese Strategie bekommt in der Regel weder dem Hier noch dem Dort. Ist sie auf Dauer lebbar? Das Bedürfnis nach Entschleunigung wächst. Oder genauer gesagt: nach einer neuen Balance von schnell und langsam. Die Idee der Auszeit gewinnt an Boden. Wandern im 21. Jahrhundert? Ja bitte! Als Kontrast- und Differenzerfahrung zur unkontrollierbaren Beschleunigung, dem irrsinnigen Rattenrennen.
Wandern – der Fuß, der Schritt, das humane Tempo ist das Maß. In Bewegung bleiben. Sich selbst orientieren. Bei Wind und Wetter. Im Wesentlichen so wie Ötzi, der Mann aus dem Eis, vor 5000 Jahren in der Bergwelt der Alpen. So wie 30.000 Jahre vor ihm Homo neanderthalensis auf seinen schmalen Pfaden über die eiszeitlichen Rheinterrassen. So wie die lange Kette der Generationen seit der Morgenröte der Menschheit im Osten Afrikas. Den Boden unter den Füßen spüren, den Bach plätschern hören, die blühende Landschaft riechen. «Geht» das noch in unserer von Technik überformten Restnatur, mit unserem abgestumpften Sensorium? Wir wandern – sie fahren Geländewagen. Auch ein Zusammenprall der Kulturen.
Sicher, die wachsenden Möglichkeiten, sich die Welt in den eigenen Horizont zu holen, sind ein Zugewinn. Die Freiheit, aufzubrechen, wohin man will, ist ein kostbares Gut. Sehnsüchte domestizieren zu wollen wäre ein Irrweg. Sie werden schon allzu oft kolonisiert und «all inclusive» vermarktet. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um eine neue Balance zwischen «besehbaren» und «begehbaren» Räumen. Wer schon mal freischweifend gewandert ist, kennt Alternativen zum reglementierten Stop-and-go-Verkehr der Metropolenräume. Wer die Farbenpracht eines herbstlichen Laubwaldes bewusst erlebt hat, nutzt die Farbskalen der Designersoftware souveräner. Ohne die direkte Erfahrung von Nahräumen, so scheint es, bleibt die Wahrnehmung globaler Räume oberflächlich. Ohne das eigene Erleben in begehbaren Räumen ist man den medial vermittelten Bildern ausgeliefert. Virtuelle Realitäten werden nur im Gegenlicht von realen Erfahrungen produktiv. Erst im Pendeln zwischen den Welten, in der Kontrasterfahrung erschließt sich die ganze Fülle. Davon handelt dieses Buch.
20. August 2002. Nächtliches Zikadenkonzert am Wegrain oberhalb der Weinbergterrasse. Es riecht süß nach Heu. Durch die talwärts laufenden Reihen der Rebstöcke fällt der Blick auf die zerfließende Lichtbahn des Mondes, der sich im Rhein spiegelt. Dann, ganz matt schimmernd, die Felswand der Loreley.
4. August 2003. Zügiges Gehen am Spülsaum des Strandes. Der zweite Tag barfuß. Die Ostsee wirkt südseehaft. In der flirrenden Sonne verschwimmen Meeresoberfläche und Himmel. Auf einem Tangbüschel vor mir leuchtet ein Stück Bernstein auf.
3. Februar 2005. Monotones Schneeschuhstapfen durch weißen Wald. Auf dem Höhenkamm zwischen Moldau und Mühl. Abgrundtiefe Stille. Die eigenen Schritte, Atemzüge, Herzschläge, Pulsschläge – sonst kein Laut. In sich selbst einsinken.
Rare Momente, unvorhergesehen, unvorhersehbar. Das Ziel einer Wanderung ist nicht ein topographischer Punkt am Ende eines Weges, sondern der Augenblick, wo die Pforten der Wahrnehmung sich weit öffnen und man «eins wird mit dem Bild seiner Sehnsucht» (Cees Nooteboom). Von der Möglichkeit der Annäherung erzählt dieses Buch.
«Ein Stichwort muss als Erstes fallen: das der Bewegung.» Wie ein Leitmotiv zieht sich das Nomadische durch Leben und Werk von Joseph Beuys; so etwa 1968: «Wir befinden uns in einer nomadischen Kultur; der Geist muss ohne Weltanschauung auskommen.» Drei Jahre darauf entsteht auf der Mittelmeerinsel Capri ein Foto, das, lebensgroß reproduziert, seine Gestalt zur Ikone macht: Die Aufnahme erfasst den Gehenden im Moment einer dynamischen Vorwärtsbewegung. Mit weitausgreifendem Schritt kommt er direkt auf die Kamera, also den Betrachter, zu. Das rechte Bein ist vorgestreckt. Der Fuß trifft gerade mit der Ferse auf dem Boden auf, wird im nächsten Sekundenbruchteil abrollen. Die rechte Hand greift den Schulterriemen einer Umhängetasche. Der Oberkörper ist leicht eingeknickt. Aus der Hüfte holt das Bein Schwung für den nächsten Schritt. Der ganze Körper ist in Bewegung, kommt zügig nach vorne. Vom Blick aus den beschatteten Augen bis hinab zu den Stiefelspitzen läuft alles frontal auf den Betrachter zu. Jedoch keineswegs bedrängend oder bedrohlich, sondern einladend, mitreißend, mobilisierend. Geballte, zielsichere, durch nichts abzulenkende Energie. Das Outfit: Filzhut, weißes Hemd, Anglerweste, Jeans, wadenhohe Stiefel. Der Beutel ist groß genug für minimales Gepäck. Typisch Beuys: der Habitus eines Wanderers. Das Ambiente wirkt ärmlich. Vom stockfleckigen Mauerwerk im Bildhintergrund bröckelt der Putz. Zwischen den Pflastersteinen des Weges tritt nacktes Erdreich hervor. Man ahnt den Wildwuchs von Gräsern, Kräutern und Quecken. Am unteren Rand des sepiabraungetönten Posters prangt der Stempel einer neapolitanischen Galerie. Darunter – auf einem Pflasterstein – Beuys’ Namenszug und, ebenfalls handgeschrieben, der italienische Satz: «La rivoluzione siamo Noi» (Die Revolution sind Wir). Ikone Beuys, November 1971.
Beuys bewegte sich in einer langen Tradition. Einen ersten Aufbruch zu einer anderen Moderne wagte vor 250 Jahren Jean-Jacques Rousseau. Auch er einer aus der Bruderschaft der eigensinnigen Wanderer und Wahrheitssucher: «Ich brauche keine gebahnten Wege. Ich komme überall durch, wo ein Mensch gehen kann. Da ich nur von mir selbst abhänge, genieße ich alle Freiheit, die ein Mensch haben kann.» Die befreiende Wirkung des schweifenden, leichtfüßigen Wanderns scheint wieder aktuell zu sein. Auch wo es «nur» darum geht, den Kopf frei zu bekommen. Befreiung aber hat von Rousseau bis Beuys immer eine weitere Dimension. Freiheit wozu? Zur Rückbindung an das Elementare, an die «Urphänomene» (Goethe). Lassen sich aus dem kulturellen Erbe Funken schlagen für eine – sagen wir mal – Rucksackrevolution? In Rückblenden auf die Kulturgeschichte des Wanderns versuche ich eine Annäherung.
Wandern ist vielerlei: Freizeitspaß, sanfter Natursport, nachhaltiger Tourismus … Alles hat seine Berechtigung. Mich interessiert die nach oben offene Skala der Möglichkeiten. Die fließenden Übergänge, wo das Wandererlebnis in die Erfahrung von Natur und Kultur – und Kosmos – übergeht. Wo die Kunst des Wanderns sich berührt mit Lebenskunst und deren Kern: Selbsterfahrung und Selbstsorge. Wo beim Gehen das Tagträumen einsetzt – und die Sinnsuche.
«En rollenden stên settet kain moss», heißt es im Wörterbuch der westfälischen Mundart von 1882. Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Eine wahrlich global und multikulturell verbreitete Metapher. «A rolling stone gathers no moss», sangen die schwarzen Blues-Barden aus dem Mississippidelta. Die Kinder der 60er Jahre nahmen das begierig auf. Sie entdeckten auf ihren Reisen, in ihren Bewegungen und Garagenwerkstätten den Zusammenhang von Mobilität, Flexibilität und Kreativität. Lassen sich diese Fähigkeiten und Tugenden wieder aus dem Griff der Beschleuniger und Gewinnmaximierer befreien? «Wild und frei leben, das wollen doch drei Viertel aller Leute», sagt Jule alias Julia Jentsch in der Filmkomödie Die fetten Jahre sind vorbei, die im Frühjahr 2004 in die Kinos kam.
Meine eigene Wandererbiographie verlief ziemlich patchworkartig. Eine Handvoll Kindheitserinnerungen an Gänge mit den Eltern. Fast immer im Sommerwald: von einer kleinen, längst geschlossenen Bahnstation an der Möhnetalsperre zu einem Ausflugslokal im Arnsberger Wald. Um 1956. Über buchenbestandene Kuppen an der Bergstraße hinauf zum Melibocus, tief unten in der Ferne das silberne Band des Rheins. Durch das verwinkelte Naumburg hinaus auf einen Weg am Fluss, auf steilen Pfaden empor zu trutzigen Burgen an der Saale hellem Strande, zurück mit dem Motorschiff. Ferientage in Naturfreundehäusern, jeden Tag auf markierten Wanderwegen unterwegs. Kleines Walsertal, Pfälzer Wald und so weiter. Anfang der 60er Jahre änderte das erste Auto die familiären Reisegewohnheiten. Mit zwölf das erste von mehreren Zeltlagern. Eine kirchliche Gruppe, noch ein Hauch von Wandervogel und bündischer Jugend. Lagerfeuer, Nachtwachen, Gewaltmärsche rund um den Großen Arber im Böhmerwald, durch die Wutachschlucht im Schwarzwald, an manchen Tagen über 30 Kilometer. Gute Erinnerungen.
Um 1968 erweiterten sich die Spielräume. Zwischen Trondheim, Dublin und Marseille, New York und San Francisco war ich per Anhalter unterwegs. Später kamen Fahrten im Auto und Flugreisen. Das Wandern beschränkte sich auf kurze, aber erlebnisreiche Touren. Auf dem Indian Trail oberhalb von Aspen, Colorado, dem Redningsstien durch die Felsklippen von Bornholm, dem Sentier douanier an der bretonischen Steilküste. Das Gehen im Nahraum habe ich neu entdeckt, als Hanna, unsere Tochter, auf die Welt kam. Den neuen Radius bestimmten der Buggy, die Waldwege am Stadtrand und – in den Ferien – ihr Bedarf an Luftveränderung. Es war eine schöne Zeit. Meine neuen Wanderjahre begannen erst mit 50. Im Jahr 2000. Meine Frau schenkte mir eine ausgedehnte Wanderung durch Thüringen. Zurück zu den Wurzeln, in den «Fußstapfen der Ahnen», die dort gelebt hatten. Diese «Auszeit» war ein Auftakt. Seitdem wandere ich wieder regelmäßig. Zu allen Jahreszeiten, meist allein, manchmal mit Freunden. Mein persönlicher Stil? Ein Freund fand einen treffenden Begriff: Landschaftsflaneur.
In diesem Buch erzähle ich von Wanderungen der letzten Jahre. Es geht mir nicht in erster Linie darum, ein paar unkonventionelle Wanderrouten zwischen Ostsee und Alpenkamm zu beschreiben. Brauchbare Wanderführer gibt es überall. Es geht vielmehr um die Zutaten für eine gelingende Wanderung. Am Beispiel verschiedener Landschaftstypen möchte ich zeigen, wie man die Erlebnispotenziale – und das Geheimnis – von Räumen und Wegen aufspüren und erwandern kann. Immer im Blick auf die spezifische Erlebnisqualität der Jahreszeiten. Die Beschreibungen sollen dazu anregen, die eigene innere Wünschelrute in Gang zu setzen. Seine mentale Landkarte genauer zu lesen und den ganz persönlichen Kanon von Sehnsuchtszielen und Traumpfaden zu entwickeln. Die eingeschobenen, typographisch abgehobenen Abschnitte verweisen auf aktuelle Denkwege aus verschiedenen Wissensgebieten, die für eine neue Kunst des Wanderns zu nutzen wären. Aus den einzelnen Teilen, so hoffe ich, entsteht Stück für Stück ein brauchbarer Kompass. Er soll vor allem Lust und Mut machen, loszugehen, um gestärkt zurückzukommen. Vielleicht sogar mit mehr Gelassenheit und Weitblick. Im Sinne von Hans Jürgen von der Wense, dem in der Mitte des 20. Jahrhunderts beim Wandern irgendwo zwischen Hameln und Brilon aufging: «Die Erde ist ein Stern. Wir leben im Himmel.»
1.Auf Schneeschuhen
Hinter den letzten Häusern von Přední Výtoň, einem Dorf in den südlichen Ausläufern des Böhmerwaldes, machen Schneewehen den Weg unpassierbar. Eine meterhohe Barriere baut sich auf, wo der Traktor den Schneepflug gewendet hat. Jenseits zieht eine weiße Fläche hinauf zum Waldrand am Bergkamm. Die Feldwege, selbst die Weidezäune sind darin versunken. Mit klammen Fingern schnalle ich die Schneeschuhe an.
Die ersten Schritte im tiefen Schnee: behutsam den Schneeschuh mit der ganzen Tragfläche auf die Schneedecke aufsetzen und unter Einsatz der Teleskopstöcke das Körpergewicht dorthin verlagern. Die Oberfläche bricht. Schnee quillt durch Rahmen und Gitter. Es knirscht, knarrt und knarzt. Ich sinke ein. Aber nicht tief. Oberhalb des Knöchels, spätestens im unteren Bereich der Wade, kommt die Sinkbewegung zum Stillstand. Die Verstrebungen und geschlossenen Flächen des Schneeschuhs haben unter meinem Gewicht die Luft aus der Struktur des Schnees herausgepresst, ihn verdichtet und so fest getreten, dass er mich an dieser einen Stelle trägt. Sobald das Standbein Halt spürt, ziehe ich das andere nach, indem ich den Fuß nach oben anwinkele und den Schneeschuh aus der ovalen Vertiefung hebe, die er eingedrückt hat. Mit der nach oben gebogenen Front durchbricht er die vordere Kante des Abdrucks und kommt aus der Versenkung hervor. Es stäubt bis zum Knie hoch. Ohne Gamaschen wären die Hosenbeine schnell durchnässt. Zurück bleibt wieder ein kleines Relief im Schnee. Die nächste Bewegung: Das Gewicht des Oberkörpers wieder verlagern, das Bein strecken und den angehobenen Schneeschuh parallel an dem anderen vorbei heben. In einem Abstand, der weit genug ist, dass sie beim Aufsetzen nicht übereinandergeraten und sich verkanten, aber so eng, dass der Gang nicht breitbeiniger als nötig ausfällt. Eine Schrittlänge weiter vorne setze ich den Schneeschuh auf. Ich sacke ein, aber wiederum nicht sehr tief, vielleicht zwanzig Zentimeter, und finde Stand. Wie tief man kommt, ist vom Aufbau der Schneedecke abhängig, nicht von ihrer Höhe. Sehr pulvriger und sehr nasser Schnee geben am wenigsten Halt.
Das Prinzip des Schneeschuhgehens ist einfach: Du vergrößerst die Trittflächen deiner Fußsohlen und verteilst so dein Körpergewicht auf mehr Quadratzentimeter. Nach ein paar Schritten bekommst du ein Gespür dafür, wie tragfähig der Schnee dadurch geworden ist. Die anfängliche Angst zu versinken verfliegt und weicht einem Grundvertrauen. Der große Unterschied zum Skilaufen: Du gleitest nicht über die Oberfläche. Du watest im Schnee. Das alte deutsche Wort «stapfen», laut Grimms Wörterbuch «fest auftretend schreiten», trifft am besten diese besondere Art des Gehens. Durch den Schnee stapfen ist schweißtreibend und mühsamer als die Fortbewegung auf Skiern. Aber es braucht keine präparierten Loipen oder Pisten, keine geräumten Wege. Du bahnst dir – oder besser – spurst dir deinen eigenen Pfad im Unwegsamen. Dorthin, wo kein Pferd und keine Hunde den Schlitten ziehen, wo kein noch so bulliger Geländewagen, nicht einmal ein Snowmobil vordringt. Du bist autonom. Du gewinnst die Freiheit, auch im strengsten Winter aufzubrechen, wohin du willst.
Mein alter Traum: ein paar Tage auf Schneeschuhen durch weiße Wälder wandern. Dass ich auf den Böhmerwald verfiel, lag an Adalbert Stifter. Ein paar seiner Geschichten, die dort spielen und von Schneestürmen und eiszapfenbehangenem Hochwald erzählen, haben die Phantasie in Gang gesetzt. Nun liegt das Moldautal unter mir. Der Lipnostausee, der die Talsohle auf dreißig Kilometer Länge einnimmt, ist dick überfroren. Seine Eisdecke ist kaum noch vom festen Land zu unterscheiden. Der Jänner, so hatte ich im Gasthof in Přední Výtoň gehört, war noch grün. Es hatte nach einem weiteren milden Winter ausgesehen. Erst Anfang Februar kam der große Schnee. Ein kalter Wind bläst aus Nordwesten, als ich zu meiner viertägigen Tour durch das Grenzgebiet von Südböhmen, Oberösterreich und Ostbayern aufbreche.
Nach einer Stunde und hundert Höhenmetern sanftem Aufstieg ist die erste Kammlinie erreicht. Ein Blick zurück. Ging da ein Yeti? Meine ovalen Fußstapfen haben eine reißverschlussartige Spur hinterlassen, die in einer Schlangenlinie den Wiesenbuckel heraufkommt. Ohne Schneeschuhe wäre die Tour spätestens hier zu Ende gewesen. Erschöpft, durchnässt, entnervt hätte ich aufgegeben. Vor mir liegt das hügelige Land in monotonem Weiß. Scheinbar weglos und grenzenlos. Der schweifende Blick des Wanderers orientiert sich an den Strukturen der Landschaft und nicht am Netz der Wege. Nach Westen hin senkt sich der Höhenzug ins oberösterreichische Mühlviertel herab. Seine Kammlinie bildet die kontinentale Wasserscheide zwischen Moldau und Mühl, Donau und Elbe, Schwarzem Meer und Nordsee. Drei Kilometer unterhalb verläuft die uralte Grenze zwischen Böhmen und Oberösterreich. Jahrhundertelang war sie eine durchlässige grüne Grenze, dann vierzig Jahre lang hermetisch abgeriegeltes militärisches Sperrgebiet, Eiserner Vorhang. Nun ist sie wieder offen, wenn auch vorerst nur eingeschränkt. Auch nach dem EU-Beitritt Tschechiens sind Reisende an die Grenzübergänge gebunden. Die kleineren sind im Winter zu. Der nächste ganzjährig geöffnete ist Guglwald. Vor mir erhebt sich die gezackte Silhouette eines Tannenwaldes. Die Wanderkarte bezeichnet das Gelände als «Svatý Tomáš», Wald und Berg des heiligen Thomas. Von seiner runden Kuppe läuft der Kamm nach Nordwesten zunächst in einer sanften Kurve, dann steil ansteigend über das Massiv des Hochficht zur Felswand des Plechy, des Plöckensteins, des Königs des Böhmerwaldes, und springt von dort zum Gipfel des Dreisesselbergs. Obwohl ich zum ersten Mal in dieser Landschaft bin und trotz aller radikalen Umbrüche des 20. Jahrhunderts, scheint sie vertraut. Das Schneeland vor mir ist die Landschaft, die Adalbert Stifter vor 150 Jahren beschrieb, jener «breite Waldesrücken» mit dem «Gewimmel mächtiger Joche und Rücken» an der «Mitternachtseite des Ländchens Österreich». Ein Bändchen mit seinen Erzählungen habe ich im Rucksack. Für die langen Abende.
Der Weg in den Wald hinein ist verweht. Nur als gekrümmte Schneise ist er zwischen den Baumstämmen auszumachen. Hier ist seit Wochen niemand mehr gegangen. Niemand? Tierspuren kreuzen den Weg. Sie sind viel auffälliger als im Sommerwald. Die Vorderläufe hintereinander, die Hinterläufe links und rechts gesetzt: Spuren eines Hasen. Mittelfingertief ist er eingesunken, in Sätzen von einem halben Meter mühsam vorwärtsgehoppelt. Eine winzige Spinne läuft behände vorbei. Wenig später eine neue Fährte. Die ovalen Trittsiegel bilden eine durchgehende Linie. Ein Fuchs ist entlanggeschnürt und nach einer Weile in Richtung Mühltal abgebogen. Zu seinem Bau? Zu einer Stelle, wo er Beute zu machen hofft? Viele Waldtiere halten Winterschlaf oder Winterruhe. Mit dem Verwelken der Bodenvegetation im Herbst stellen die Tiere ihre Lebensäußerungen um. Sie ruhen sehr viel. Manche graben sich in Schneehöhlen ein. Sie drosseln die Temperatur in den Extremitäten, reduzieren den Energiebedarf des Körpers. So kommen sie mit sehr viel weniger und minderwertiger Nahrung aus. Die Bäume haben ihre Wachstumsphase beendet. Das Gewebe der frischen Triebe ist verholzt. Die Blätter sind längst abgeworfen und die Blattstielnarben mit Kork verschlossen. Der Schnee schützt die Waldbodenpflanzen und deren Knospen vor dem Frost und bewahrt sie vor dem Erfrieren. Unter dem Schnee geht der Pulsschlag des Lebens, wenn auch stark verlangsamt, weiter. Ihr Existenzminimum finden die pflanzenfressenden Tiere in Form von Knospen und Nadeln. Die anderen Arten setzen ihre Beutezüge fort. Die kargen Spuren im Schnee erzählen von ihrem Leben und Überleben. Für das Wild, besonders für störanfällige Arten wie Raufußhühner, also Auer- und Birkhühner, kann es lebensbedrohlich werden, wenn sie öfters aus ihren winterlichen Ruheräumen aufgescheucht werden. Jede Fluchtbewegung bringt ihren Energiesparhaushalt durcheinander. In kalten Nächten gehen sie dann an Entkräftung und Unterkühlung zugrunde. Dieses Abc der Ökologie des Winterwaldes muss ein Schneeschuhwanderer kennen. Die Gänge abseits der Wege quer durch den Wald, so verlockend sie sind, sollte man sparsam dosieren. Habitate der Raufußhühner sind auf jeden Fall zu meiden. Im Nationalpark Bayerischer Wald sind ihre Ruhezonen gekennzeichnet.
Es hat zu schneien begonnen. Wind kommt auf. Die Flocken wehen frontal ins Gesicht, decken im Nu die Vorderseite des Anoraks zu. Im Bart gefriert der Atem zu Eisperlen. Einmal stürze ich der Länge nach in den Tiefschnee. Die hinteren Spitzen sind stecken geblieben, als ich bei einem Wendemanöver einen Schritt rückwärts mache. Das geht auf Schneeschuhen nicht. Man muss die Füße Zug um Zug seitwärts bewegen, um die Schneeschuhe in die gewünschte Richtung zu bringen. Bei jedem Sturz wird die eindringende Nässe unweigerlich zum Problem. Vor allem wenn man schon schwitzt. Es dauert seine Zeit, bis ich mich aufgerichtet und den Schnee einigermaßen abgeschüttelt und abgeklopft habe. Einiges bleibt haften. An den Handgelenken zwischen Handschuhen und Ärmeln und am Hals zwischen Rollkragen und Kapuze hängen Eisklumpen, die auf der Haut rasch schmelzen. Trocken bleiben ist beim Winterwandern oberstes Gebot. Nicht klirrender Frost, sondern die von Schweiß und Schnee feuchte Kleidung führt zur Unterkühlung. Erst recht, wenn der Wind kalt und böig weht, wird das schnell gefährlich. Gefühllosigkeit in Fingern und Zehen sind die ersten Symptome. Wenn unkontrollierbares Zittern und Zähneklappern einsetzen, wird es höchste Zeit, die Wanderung abzubrechen.
Ich drossele das Gehtempo, um nicht stärker ins Schwitzen zu kommen, bleibe häufig stehen. Als ich zwischen Bäumen und Granitgeröll den Steilhang nach Svatý Tomáš hinaufstapfe, reißt die Wolkendecke auf. Die Himmelsbläue löst die harten Schwarz-Weiß-Kontraste auf. Zwischen dem warmen Braun der Baumstämme und dunklem Tannengrün beginnt das kalte Weiß der Schneedecke und der Schneehauben auf den Ästen und Felsblöcken zu glitzern. Die Sonne enthüllt die «Pracht» – ein Lieblingswort Stifters – des Winterwaldes. Ein weites Schneefeld bedeckt die Bergkuppe. Im Frühsommer, stelle ich mir einen Moment lang vor, leuchtet hier das Gelb von Löwenzahn und Arnika aus saftigem Grün. An der Kammlinie taucht der Glockenturm eines Kirchleins auf: St. Thomas. Hinter der Kirchhofsmauer eine kleine Ansammlung von Plattenbauten und neuen Häusern. Auf dem bewaldeten Bergplateau ragt ein stählernes Turmgerüst hervor – ein ehemaliger Wachtturm der tschechischen Grenztruppen. Gleich daneben, von Wipfeln noch fast verdeckt, das Gemäuer einer Burgruine: Hrad Vitkův kámen, Burg Wittinghausen. In der Topographie von Stifters poetischer Landschaft war das «alte Schloss», wie man in den umliegenden Dörfern zu seiner Zeit sagte, neben Dreisesselberg und Plöckensteiner See die wichtigste Landmarke. Es ist das feste «Haus», das die Hauptfigur im Mittelalterroman Witiko für seine junge Frau Bertha baut. Es ist die am Ende von den Schweden zerstörte «Waldburg» aus der Erzählung Hochwald, die Ruine, die in Granit der Großvater seinem Enkelkind zeigt.
Bei der Annäherung erkennt man die kompakte Struktur der gotischen Burganlage. Wie das Kirchlein wurde sie in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet, also etwa zu der Zeit, als ein Mönch im nahen Passau das Nibelungenlied aufschrieb. In seinem historischen Roman Witiko erzählt Stifter von der Gründung der Burg durch die «Herren der Rose», die böhmische Adelsfamilie der Rosenberger. Die Fundamente ruhen auf einem Untergrund aus Granit. Ein wuchtiger, quaderförmiger Turm mit Fensteröffnungen und Schießscharten und einem niedrigen, aber massigen polygonalen Vorbau bildet den Kern der Burg. Der zweistöckige Turm, aus Bruchstein gemauert, vereinigt die Funktionen von Palas und Bergfried, Wohnbereich und Befestigung. Die Ringmauern, an denen früher die Wehrgänge entlangliefen, sind einigermaßen gut erhalten. Burghof und Brunnenschacht, Burggraben und die Lage der Zugbrücke kann man unter der Schneedecke erahnen.
Stifter kam sommertags von Oberplan, Horní Planá, seinem Heimatort, oder von Friedberg, dem heutigen Frymburk, aus dem Moldautal heraufgewandert. «Oft saß ich in vergangenen Tagen in dem alten Mauerwerke, ein liebgewordenes Buch lesend oder bloß den lieben aufkeimenden Jugendgefühlen horchend, durch die ausgebröckelten Fenster zum Himmel schauend …», heißt es im Anfangskapitel seiner 1842 erschienenen Erzählung Hochwald. Bevor die Handlung einsetzt, eine bittersüße Liebesgeschichte aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, gibt er eine dichte Beschreibung des Schauplatzes. Sein Blick wandert über den «grauen viereckigen Turm auf grünem Weidegrund», die «tausend Gräser» auf dem Hof, die «Wildnis schöner Waldkräuter», die sich in den Gemäuern eingenistet hat. Stifter als Reiseführer? Trotz aller wiedererkennbaren Bezüge ist seine Landschaft ein imaginärer poetischer Raum. Mit Hilfe der Fixpunkte entwerfen die Texte ein Netz räumlicher Beziehungen, eine Ordnung. Die Zeit darin verläuft zyklisch, bestimmt vom natürlichen Rhythmus der Jahreszeiten, der Sukzession der Pflanzengesellschaften, der Abfolge der Generationen. Raum und Zeit verschmelzen zu einem sinnstiftenden Kosmos. Stifters Erzählungen handeln von der Initiation der Kinder in diese Ordnung hinein, von gewaltsamen Störungen, nicht zuletzt durch das «Scheusal Krieg», von Verlust und Wiedergewinnung der räumlichen und moralischen, äußeren und inneren Orientierungen. Seine Utopie kreist um den Einklang von Mensch, Natur und regionalem Lebensraum. Sie ist sozusagen ein spätromantisches Modell von «Nachhaltigkeit». Die elementare Tugend, die er seinen Figuren einschreibt, zuallererst den einfachen Menschen, den Holzfällern, Wildschützen und Kräuterfrauen, ist das «Zartgefühl». Gemeint ist die Fähigkeit zur Sensibilität im Umgang mit der Natur und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Stifter in seiner Heimat zu lesen ist erhellend: Die Dichtungen gewinnen an Leben, der Raum bekommt Aura. Die doppelte Annäherung ist in dieser Landschaft von besonderer Bedeutung. Kaum eine andere in Mitteleuropa war von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts so stark betroffen.
Die Fernsicht nach Süden auf die Alpenkette, jenen «ungeheueren Halbmond» der Norischen Alpen, von der Stifter schwärmte, ist an diesem Nachmittag verhangen. Auch der im Nordwesten gelegene Plöckenstein bleibt verborgen, von dessen Gipfel im Hochwald die beiden schönen Töchter des alten Burgherrn von Wittinghausen im Fernrohr die Rauchfahnen aus den Trümmern der heimatlichen Burg entdeckten. Zwischen Berg und Burg liegen laut Roman «zehn Wegstunden». Auf der Wanderkarte sind es 23 Kilometer Luftlinie. Ich habe vier Tage Zeit, wähle nicht wie Stifters Figuren die Route im Moldautal, sondern will dem Schwarzenbergischen Schwemmkanal folgen. Der Fahrweg – und Radwanderweg – von Svatý Tomáš nach Koranda, wo man auf den Kanal stößt, ist geräumt. Man geht auf plattgefahrenem Schnee. Die Schneeschuhe kann ich also erst mal abschnallen und am Rucksack festmachen. Sie sind für mich Fortbewegungsmittel, kein Sportgerät. Jede Abwechslung tut gut. Auch wenn ich mich überraschend schnell mit ihnen angefreundet habe – jetzt ist das Gefühl der Befreiung deutlich. Man merkt, wie anstrengend das stundenlange Waten im Tiefschnee gewesen ist.
Der Weg führt wieder durch Fichtenwald. Aus der Ferne knattert eine Kettensäge. Ein Förster überholt mich im Geländewagen. Ein Reiter kommt mir auf einem starkknochigen Pferd entgegen. Dobrý den – guten Tag! Ein alter Mann mit Bartstoppeln, Russenschapka, derber Joppe. Nach Koranda – wie viel Kilometer? Drei Finger gehen hoch, und die Handbewegung, immer geradeaus. Die Grenze nach Österreich? Koranda, dann zwei Kilometer. Kommt man rüber? Neni problem.
Koranda, der Rosenhügel, entpuppt sich als flache, weite Lichtung. Eine Holzbrücke überquert einen zwei, drei Meter breiten Wassergraben, der sich, überfroren und schneebedeckt, schnurgerade durch das Gelände zieht. Im tschechischen Reiseführer bekommt dieser eher unscheinbare Punkt in der Landschaft als «technikgeschichtliches Denkmal» drei Sterne. Die österreichische Tourismuswerbung spricht vom «(s)achten Weltwunder». Ich habe den Schwarzenbergischen Schwemmkanal erreicht. Koranda ist die Stelle, wo man das Holz eine kurze Strecke bergauf geflößt hat. Hier überquert der Schwemmkanal die kontinentale Wasserscheide und senkt sich ins Tal der Großen Mühl, die er auf der österreichischen Seite bei Haslach erreicht. Über den Rosenhügel wurde im 19. Jahrhundert das Holz in Scheiten von den Höhen des Böhmerwaldes zur Großen Mühl und weiter zur Donau geflößt. Dreißig Bäche speisten den Kanal während der Schwemmperiode zur Zeit der Schneeschmelze. Bis zu 1000 Saisonarbeiter, die «Scheiterbehm», waren mit der Holztrift beschäftigt. Unter Ausnutzung der erneuerbaren Energien von Wasser und Muskelkraft wurde 100 Jahre lang die Kaiserstadt Wien mit Millionen Festmetern des nachwachsenden Rohstoffs versorgt.
Stifter lebte, als Holzeinschlag und Flößerei im Böhmerwald ihren Höhepunkt erreichten. Das spektakuläre Bauwerk hat er nur ein einziges Mal erwähnt. Vermutlich sah er in dem Meisterwerk der Ingenieurkunst vor allem die Ursache für die vielen «Baumfriedhöfe», die Kahlschläge in den heimatlichen Wäldern. Stifters «sanftes Gesetz» beruht auf einem tieferen Respekt vor dem Wirken der Elemente und dem Haushalt der Natur. Sein Wald ist kein Ressourcenlager, sondern ein Organismus. «Denken wie der Wald», fordert die junge Bertha in Witiko von ihrem künftigen Ehemann. Die nachwachsenden Rohstoffe pfleglich nutzen, ihre Regenerationszeiten beachten, die Artenvielfalt bewahren, «jungfräulichen» Wald und «göttliche» Wildnis schützen – all das gehört unverzichtbar zum «Sittengesetz» der Nachhaltigkeit. Stifters «sanftes» Gesetz huldigt Gaia, der lebenspendenden Sphäre des Planeten.
Ein Wegweiser: 1,8 Kilometer bis zum Iglbach-Durchlass. Ich schnalle die Schneeschuhe wieder unter, folge auf der Böschung diesem ältesten Abschnitt des Schwemmkanals. Zwischen Fichtenstämmen und Uferböschung stapfe ich durch unberührten Schnee. Die Stille des Winterwaldes nimmt mich auf. Es ist nicht die durch Vogelstimmen, Insektensummen, Windrascheln und plätscherndes Wasser grundierte, lebendige Stille des Sommerwaldes. Diese hier ist abgrundtief. Unter und neben den Atemzügen werden Herzklopfen und Pulsschlag hörbar. Ich muss mich längst nicht mehr auf die Bewegungsabläufe konzentrieren, muss auf keinen Weg achten. Beim monotonen Gehen durch das weiße Schweigen kann man in sich selbst einsinken.
Schon kurz nach vier geht die Sonne hinter dem Kamm unter. Mit der rasch hereinbrechenden Dämmerung erwacht die Sorge um das Nachtquartier. Im Winter hat sie eine andere Dringlichkeit. Der Wettlauf mit der Dunkelheit beginnt. Am Iglbach-Durchlass bin ich auf österreichisches Territorium gewechselt. Das Licht im Wald wird fahl, die Atmosphäre beklemmend.
Eine Stunde lang gehe ich, renne ich neben einer Langlaufloipe her. Am Waldrand der erlösende erste freie Blick ins Tal: vor mir die anheimelnden Lichter eines alten Vierseithofes, tief unten im Mühltal die Häuser von Aigen-Schlägl. Mitten im Ort, von einem warmen Licht angestrahlt, die barocken Türme von Stift Schlägl. Noch ein kurzes Stück Weg, dann die behagliche Wärme eines Mühlviertler Landgasthofes – ein ungemein wohliges Gefühl.
Die Schneeschuhe sind am Rucksack festgezurrt, als ich am nächsten Morgen bei minus vier Grad von Oberhaag wieder in Richtung Schwemmkanal aufbreche. So ähnlich mögen in vergangenen Jahrhunderten die Holzhauer des Stifts und die Jagdburschen der Herren von Schwarzenberg wintertags zur Arbeit in die Wälder gezogen sein. Skier wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt – von Forstleuten, die in Skandinavien gewesen waren. «Schneereifen», wie man früher sagte, haben eine viel längere Tradition. Sie waren immer schon das Utensil der Waldarbeiter und Bergbauern, der Jäger und Bergknappen, Wilderer und Schmuggler, auch der Landärzte und Schulkinder – also aller, die darauf angewiesen waren, auch im Winter außerhalb der Dörfer überallhin zu kommen.
Das Wort «Schneereif» belegt Grimms Wörterbuch mit einer Quelle aus dem Jahr 1575. Diese berichtet über Bergleute, von denen «etliche mit ihren secken, schnereyff, fuseysen und pergstecken» zu den abgelegenen Erzstollen wanderten. Stifter erwähnt «Schneereife» in einer Aufzählung bäuerlicher Geräte. Im Herbst würden sie zusammen mit Schlitten und Schaufeln bereitgestellt, um nicht durch die kommenden Schneemassen von der Welt abgeschnitten zu werden. Im Waldmuseum im bayerischen Zwiesel sind alte Modelle ausgestellt. Schlichte Holzrahmen aus Buche oder Esche, im nassen Zustand gebogen und zusammengenagelt, tellerrund oder oval, mit einem Geflecht aus Weidenruten, Lederriemen oder Hanfschnüren und einer einfachen Bindung versehen.
Ein ziemlicher Kontrast zu dem modernen Modell, das mich durch den Böhmerwald trägt. Die Schneeschuhe bestehen aus orangefarbigem Plastik, sind von der etwas nach oben gebogenen Front bis zum Sporn am hinteren Ende 60 cm lang und, leicht geschweift, an der breitesten Stelle 25 cm breit. Auf der Unterseite geben zwei Reihen von jeweils drei Dornen Halt im verharschten Schnee. Meine Schuhe, ziemlich wasserdichte und kälteisolierende Winterstiefel aus dem Schlussverkauf einer Billigkette, sind auf einer an der Ferse beweglichen Bindungsplatte befestigt, die vorne mit einer dreizackigen Kralle in den Schnee greift. Ein Modell aus Frankreich, wo das Wandern auf «raquettes à neige» sehr populär ist – der neueste Schritt in der Evolution des Schneereifens.
Das alte Wort hat sich nur im Südtiroler Deutsch erhalten. Dort spricht man heute noch von «Schneerafn». Überall sonst im deutschen Sprachraum läuft man Gefahr, missverstanden zu werden, wenn man es benutzt. Sind vielleicht «Winterreifen» gemeint? Die Umrüstung der Fahrzeuge ist in der Gegenwart zum wichtigsten Teil der Vorsorge für den Winter aufgestiegen. In der Rangliste der Google-Suchbegriffe besetzt «Winterreifen» zu Beginn der Saison regelmäßig einen der vorderen Plätze. Das Comeback des Schneereifens verdankt sich einem amerikanischen Trend. Dort waren Schneeschuhe bei den Wald-Indianern und den Eskimos in den polaren Schneewüsten Kanadas und Alaskas seit mindestens 6000 Jahren überlebenswichtiger Gebrauchsgegenstand. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts entdeckte man sie als Sportgerät für jedermann. Zwar wurden die klassischen Biberschwanz- oder Bärentatzenformen mit dem netzartigen Geflecht aus Rohlederstreifen oder Elchsehnen bald durch funktionale Hightech-Anfertigungen aus Aluminiumrahmen und Neoprenbespannung ersetzt. Aber die Indianer-, Goldgräber- und Trappernostalgie, Jack Londons Alaskaroman Lockruf der Wildnis entlehnt, blieb mit dem neuen Sport verknüpft. In den Wäldern Kanadas oder der Sierra Nevada mag sie am Platz sein. Leicht skurril wirkt es, wenn Veranstalter von Schneeschuhwanderungen im barocken Mühlviertelort Aigen-Schlägl mit Hilfe von Schlittenhunden und Lagerfeuern Wolfsblutromantik zaubern wollen. Wie wär’s stattdessen mit einer Prise Wildschütz- und Waldhüter-Romantik aus dem erzählerischen Fundus Stifters? Gold hat man übrigens auch aus dem Flussbett der jungen Moldau gewaschen. Spuren davon sollen heute noch zu finden sein.
Wieder auf der Route, den Weg am Schwemmkanal, jetzt am Nordosthang von Bärenstein und Sulzberg, 1000 Meter hohe Berge. Leichter Schneefall. Der Graben ist auf weiten Strecken zugeschneit und kaum zu erkennen. Nur an den Schleusen, wo ein Bach einfließt oder in Rohren den Kanal überquert, kommt auf kurze Strecke blankes Eis, hier und da schwarzes Wasser zum Vorschein. Für kurze Zeit unterbricht das Rauschen des Baches die Stille. Dieser Klang soll dem Böhmerwald seinen tschechischen Namen gegeben haben: «Šumava» kommt von «šumit», rauschen. Ob das Wasser namensgebend war oder der rauschende Wald – oder beides –, ist noch umstritten. Einem namenlosen Bachlauf folge ich im Wald bergauf. Wie geht man auf Schneeschuhen einen Abhang an? Am besten direkt, in der Falllinie. Man muss nur das Gewicht stärker nach vorne verlagern und mehr mit den Stöcken arbeiten. Beim letzten Anstieg kann man bei Bedarf die Schneeschuhe zum V anwinkeln und in den Pinguingang überwechseln. So sind auch Steigungen von über 30 Prozent zu meistern. Ins Rutschen – wie auf Skiern – kommt man nicht. Im Wald sollte man allerdings die Stellen meiden, wo junge Fichten dicht zusammenstehen. In den Zwischenräumen hat das Astwerk unter der Schneedecke Hohlräume gebildet. Man bricht unweigerlich ein. Sich aus dem Loch zu befreien ist mit den sperrigen Tellern an den Füßen gar nicht so einfach. Dasselbe gilt für das Überqueren von verschneiten Wasserläufen und sumpfigen Stellen. Im Gelände sind sie kaum zu erkennen. Dort ist der Schnee von unten her getaut und von fließendem Wasser unterspült. Bricht man in solch ein Schneeloch oder eine Schneebrücke ein, holt man sich zumindest nasse Füße und durchnässte Hosenbeine. Das kann – anders als im Sommer – wirklich gefährlich werden. Bei diesen Temperaturen hat man nicht viel Zeit. Man muss sich schnell umziehen, darf nicht warten, bis alles gefroren ist. Sonst bekommt man unter Umständen die Schuhe nicht mehr ausgezogen.
Nicht weit von hier, in den Wäldern der rauschenden Wildwasser, ist Viktor Schauberger aufgewachsen. Ein eigensinniger Tüftler, Naturphilosoph und Erforscher der Wasserenergien. Geboren ist er 1885, keine 20 Jahre nach Stifters Tod, in dem Weiler Holzschlag am Hochficht, wo sein Vater als Förster mit der Flößerei am Schwemmkanal direkt zu tun hatte. An den Gebirgsbächen und Wasserfällen hat er im Spätherbst die Wanderung der Forellen zu ihren Laichplätzen beobachtet. Sein Schlüsselerlebnis hatte er in einer mondhellen Nacht: «Es schien, als würde sich die Forelle wiegen, und sie tanzte in stark ausgeprägten Schlingerbewegungen eine Art Reigen im wellenden Wasser. Plötzlich verschwand sie unter dem wie Metall einfallenden Wasserstrahl. Die Forelle richtete sich kurz auf, und ich sah eine wilde Kreiselbewegung. Aus dieser löste sich die verschwundene Forelle und schwebte bewegungslos aufwärts.» Fasziniert von der Kraft des «lebendigen Wassers» begann Schauberger nach einer forstlichen Ausbildung mit dem Bau von Holzschwemmanlagen. Dazu nutzte er diejenigen Energien des strömenden Wassers, die durch Verwirbelung und Temperaturgefälle entfesselt werden. Hatte Stifter von seiner Sehnsucht nach «frischer Luft und edlem Wasser» gesprochen, so entwickelte Schauberger in den 1930er Jahren Verfahren zur «Veredelung» von Wasser, nämlich zur Herstellung von quellwasserähnlichem Trinkwasser. Dann wandte er sich der Entwicklung von Schiffsschrauben und Turbinen zu, experimentierte – zeitweilig auch im Dienste der Nazis – mit Implosionsmotoren. So richtig funktioniert hat offenbar nichts. Viktor Schauberger starb 1958 in Linz. Belächelt, verfemt, von wenigen verehrt. Einer von den vielen Grenzgängern zwischen Tradition, Technik und Esoterik, deren Zeit unwiderruflich vorbei ist – oder noch kommt. Im Internet jedenfalls werden seine Ideen von Esoterikern und kühlen Praktikern lebhaft diskutiert.
Nach drei Stunden ein Dorf. Abgelegen auf der Höhe, dicht an der tschechischen Grenze: Sonnenwald. Nur eine Ansammlung von Häusern auf einem Schneefeld, Rauchfahnen in der Luft. Sonnenwald ist ein ehemaliges Glasmacherdorf des Stiftes Schlägl. Das alte Handwerk ist längst ausgestorben. Aber sonst hat sich der Ort seit Schaubergers und Stifters Zeiten äußerlich wohl wenig verändert. In der Jausenstation gibt es eine heiße Suppe. Der Wirt nennt mir ein paar landschaftliche Höhepunkte und ein paar Quartiere an meiner Route. Noch drei Kilometer bis zum ganzjährig geöffneten Grenzübergang Schöneben. Am späten Nachmittag bin ich im Quartier, einer neugebauten Pension oben am Talhang in Zadní Zvonková, dem ehemaligen Glöckelberg. Abends beleuchtet der Mond das weite Moldautal. Bei einer Kanne Tee im warmen, dunklen Zimmer genieße ich das Panorama. Hügel und Bergkämme liegen im fahlen Licht. Im Süden der Signalmast von Svatý Tomáš, meinem Ausgangspunkt. Unten die Uferlinie des zugefrorenen Lipnosees, jenseits die Lichter von Horní Planá, dem Stifter-Ort. Im Garten läuft ein Baummarder in eleganten Bewegungen am Holzstapel vorbei, verharrt, schlüpft dann durch den Zaun und setzt seinen Beutezug auf freiem Feld fort. Mich zieht es noch einmal hinaus. Ich schnalle die Schneeschuhe unter, mache einen kurzen Gang über das Feld. Der Polarstern ist herausgekommen. Die Schneekristalle reflektieren das Mondlicht. Die Konturen der Dinge treten viel klarer hervor als in einer Frühlingsnacht.
Später Aufbruch am nächsten Morgen. Das alte Kirchlein von Glöckelberg ist Ausgangspunkt für die vorletzte Etappe. Es steht einsam an der Stelle, wo die schmale, von Ulrichsberg kommende Passstraße den Schwemmkanal überquert und sich ins Moldautal hinabsenkt. Ein Dorf existiert nicht mehr. Das Territorium zwischen Stausee und Staatsgrenze wurde in der sozialistischen Zeit systematisch von Bewohnern geräumt. Eine Handvoll LPG-Komplexe und Wohnblocks für Militärangehörige traten an die Stelle der Dörfer. Der 2001 erschienene tschechische Reiseführer nennt die alten deutschen Namen der böhmischen Dörfer und vermerkt nicht ohne Wehmut deren Schicksal: «Nach der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung verödet und rasch verfallen …», «nach 1960 praktisch spurlos verschwunden …», «geplündertes Objekt …», «völlig ausgesiedelt, die Gebäude abgerissen …», «gänzlich verfallenes Dörfchen …», oder: «Das Leben ist erloschen.» Die deutsche Okkupation und die daraus resultierende Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung, die Errichtung des Eisernen Vorhangs in Form eines breiten Sperrgürtels, schließlich der Bau der Staumauer und die Flutung des Moldautales in den 1950er Jahren haben das Antlitz der Landschaft brutal verändert. Erholt hat sie sich noch nicht.
Der Schwemmkanalweg läuft jetzt zwischen Waldrand auf meiner linken und offenem Talgrund zu meiner rechten Seite am Bergrücken des Smrčina/Hochficht entlang. Ich laufe wieder auf meinen Tellern. Die Bewegungsabläufe haben sich automatisiert. Die Koordination von Beinen, Armen und Atmung bedarf kaum noch der bewussten Steuerung. Ein Wegweiser zeigt die Richtung, in der es zur Fähre nach Horní Planá geht. Ein Weg ist in der Schneewüste allerdings nicht zu erkennen. Ich stelle mir ein staubiges Band durch blühende Wiesen vor: Trauermäntel flattern von Blüte zu Blüte, Silberdisteln wuchern am Wegrand, in flirrender Hitze liegen Steg und Badestelle. Aber jetzt fällt der Schnee dichter aus bleiernem Himmel. Heftige Windböen stäuben ihn von den Tannen herab. Die Bäume ächzen. Schwere Ballen rutschen herunter. Dünne weiße Schleier, von faustdicken Brocken durchsetzt, wehen mir entgegen. Der sich ankündigende Schneesturm bleibt aus. Trotzdem gebe ich meinen Plan, noch den Plöckensteiner See zu erreichen, auf und biege talwärts ab in Richtung Nová Pec, einem alten Holzfällerdorf an der Moldau, das heute noch von der Holzindustrie lebt.
Die Bettlektüre an diesem Abend ist Stifters Aus dem bairischen Wald, sein faszinierender Bericht von einem Schneesturm, den er in den Lackerhäusern auf der bayerischen Seite des Dreisesselmassivs, gut 15 Kilometer Luftlinie von hier, im November 1866 erlebt hat: «Das war kein Schneien wie sonst, kein Flockenwerfen, nicht eine einzige Flocke war zu sehen, sondern wie wenn Mehl von dem Himmel geleert würde, strömte ein weißer Fall nieder …» Von seiner Stube im Rosenberger Gut aus, wo er sich von seiner schweren, letztlich todbringenden Krankheit erholen wollte, sieht der Autor mit zunehmender Fassungslosigkeit dem «Naturereignis» draußen vor seinem Fenster zu: «Die Gestaltungen der Gegend waren nicht mehr sichtbar. Es war ein Gemische da von undurchdringlichem Grau und Weiß, von Licht und Dämmerung, von Tag und Nacht, das sich unaufhörlich regte und durcheinandertobte, alles verschlang, unendlich groß zu sein schien, in sich selber bald weiße fliegende Streifen gebar, bald ganze weiße Flächen, bald Balken und andere Gebilde, und sogar in der nächsten Nähe nicht die geringste Linie oder Grenze eines festen Körpers erblicken ließ …» Stifter beschreibt hier, was die Meteorologen in Nordamerika «white out» nennen, einen völligen Verlust der räumlichen Orientierung in den herabfallenden Schneemassen. Das Erlebnis hat ihn ein Jahr vor seinem Tod zutiefst verstört, ähnlich wie die Sonnenfinsternis, die er als junger Mann 1842 erlebt und beschrieben hatte: Die Natur ist keine Idylle. Sie ist lebenspendende Kraft, aber immer auch zerstörerische Gewalt. Drei Tage lang war er in der Schneewüste von der Außenwelt abgeschnitten. Dann erst konnte er sein Quartier verlassen, aber auch nur mit Hilfe aus dem Dorf. «Die Leute traten … mit Schneereifen auf den feuchten Schnee so feste Fußstapfen, dass man auf ihnen gehen konnte. Jeder Tritt aber seitwärts hätte unberechenbares Einsinken zur Folge gehabt.»
Sonnenaufgang 7.27 Uhr. Klirrender Frost, völlig klarer Himmel, Windstille. Von der Moldaubrücke in Nová Pec ist der mächtige Bergzug zwischen Hochficht und Dreisesselberg zu überblicken. Irgendwo in den bewaldeten Berghängen versteckt, liegt der Plöckensteiner See, mein letztes Ziel. Die Straße geht sanft, aber stetig bergauf, über eine Bahnlinie, an einem modernen Sägewerk, einer Arbeitersiedlung und Ferienhäusern vorbei zum Waldrand. Sie ist geräumt, aber an manchen Stellen tückisch vereist. Auf einer Wiese am Ortsende stakst ein Reh durch den tiefen Schnee, sinkt fast bis zum Bauch ein. Ein kurzer Blick zurück ins Tal, die Schneeschuhe angeschnallt. Dann nimmt mich der Wald, Stifters «Hochwald», auf. Er ist heute ein ausgedehnter Bergfichtenwald, mit Tanne, Eberesche, Bergahorn und Buche gemischt. Je höher man kommt, desto urwüchsiger wird er. Stamm an Stamm, im Abstand von sechs, sieben, manchmal zehn Schritten stehen die hohen Fichten am Hang. Die großen Äste sind von schweren Schneehauben heruntergebogen, die Schäfte an der Wetterseite von weißen Leisten überzogen. Unter der Schneedecke die kugeligen Gestalten weihnachtsbaumgroßer Jungfichten und erratische Granitblöcke. Am Seebach erreicht man das «Tal der Hirschberge», den Ort, wo in Stifters Novelle Hochwald die Flüchtlinge ihrem Beschützer, dem alten, weisen, ritterlichen Gregor begegnen, der sie in ihr Versteck am Plöckenstein bringen wird. Der Wald wird lichter, der Weg zu einer breiten Schneise. Beim Versuch, am Bach meine Flasche zu füllen, bricht die Schneebrücke, auf die ich mich vorgewagt habe. Um ein Haar hätte sie mich in das eisige Wasser mitgerissen.
Dann ein magischer Moment meiner Winterwanderung: Die aufgehende Sonne hat den Punkt ihrer Bahn erreicht, von dem aus sie den Hang, den ich gerade emporsteige, voll beleuchtet. Überall um mich herum beginnen Myriaden Schneekristalle zu funkeln und zu glitzern. Bei jedem Schritt erlischt ein diamantenes Feld, und ein neues scheint am Boden auf. Die Sonnenstrahlen bringen das Wunder des Schneekristalls zum Vorschein. Jede Schneeflocke, sagt man, ist anders. Jede ist eine ureigene, freie Variation der ihr vorgegebenen sechseckig-kristallinen Struktur. In jeder hat sich hoch oben in den Wolken der Zusammenschluss des Wassermoleküls mit der Luft in einer anderen Gestalt vollzogen. Jede ist in ihrem freien Fall zur Erde zu einem komplexen und symmetrischen, einzigartigen Gebilde gewachsen, das, wenn es schmilzt, für immer verloren ist. Unendliche Vielfalt, Schönheit und Vergänglichkeit. Die glitzernden Flächen ringsum, der weiße Wald, der blassblaue Himmel, verbinden sich zu einem Bild makelloser Schönheit. «Terra lucida», lichterfüllte Erde, sagten die Mystiker. Die Anstrengungen der letzten Tage fallen von mir ab. Aus den Bewegungen ist jede tapsige Schwerfälligkeit verschwunden. Ich habe das Gefühl eines harmonischen Schreitens durch den Winterwald. Ein exquisites Erlebnis. Der letzte Anstieg ist ein schmaler Steig durch engstehende junge Fichten. Ab und zu streift mich ein Ast. Schnee stäubt. Ich bin der Erste, der an diesem Morgen hier geht. Eine verwehte Spur, kaum noch erkennbar, weist den Weg. Zwischen den Stämmen erscheint eine ebene Fläche. Dann bin ich am Ziel. Ein fast runder See, überfroren, verschneit, umgeben von einem Kranz schmaler Bergfichten, vor einer steil aufragenden, mächtigen Felswand. Der Plöckensteiner See, Stifters «Zaubersee». Tiefe Einsamkeit, tiefe Ruhe.
Einfach verschwinden. Den Rucksack packen, verschwinden. Unterwegs auf sich allein gestellt sein. Niemanden brauchen. Den Weg verlassen können. Ohne Weg gehen. Flexibel reagieren können. Natur erleben. Sich selbst in einer großen Landschaft erleben. Keine Spuren hinterlassen. Autonom, selbstgenügsam, autark sein. «Autárkeia», das griechische Ursprungswort, übersetzt man neuerdings mit «Selbstmächtigkeit». Das Erlebnis weitgehender Freiheit ist Essenz und Faszinosum des Wanderns. Ausrüstung hat dem zu dienen. Sie ist dazu da, dafür die Spielräume zu schaffen und zu erweitern. Wie für das Wandern selbst gilt auch für die Wahl der Ausrüstung: Es gibt nicht den einzigen, richtigen, linearen Weg. Jedes Dogma wäre von vornherein verfehlt.
Ötzi, der Gletschermann, wanderte in einem Umhang aus Gras und mit Bärenfellstiefeln an den Füßen über den Alpenkamm. Saigyo, der Wandermönch aus dem 12. Jahrhundert, schnitt sich einen Bambusstab für seine einsamen Pfade durch das japanische Hinterland. Hölderlin schulterte sein kleines «Felleisen» und nahm seinen «Dornenstock», sein «unentbehrliches Meuble», in die Hand, als er Ostern 1791 zu seiner Wanderung von Tübingen zum Vierwaldstätter See aufbrach. Hesse packte sein «Zeug» in einen verschlissenen grünen Jägerrucksack. Clemens Forell, der archetypische deutsche Kriegsgefangene aus dem Epos So weit die Füße tragen, hatte für vier Wochen Brot, Dörrfisch, Machorka und Wodka im Leinensack, als er im Winter «Neunundvierzig» auf sibirischen Birkenbrettern seine lange Flucht antrat. Reinhold Messner war bei seinen Gipfelerlebnissen auf dem Dach der Welt in Fleece und Goretex aus den Retorten der Chemieindustrie gekleidet. Mit seiner E. M. U. (Extravehicular Mobility Unit) aus schneeweißem Raumanzug, Helm und kastenförmigem Rucksack trug Neil Armstrong 1969 auf seinem gut zweistündigen «moonwalk» eine komplette Atmosphäre mit sich. Die Zeiten ändern sich. Aber in ihrer Zeit, auf jeweils eigene Weise war jeder aus dieser großen Bruderschaft der Wanderer ein Meister der Selbstsorge.
Was wir am Körper und auf dem Rücken tragen, ist dann «funktional», wenn es uns optimal hilft, unser Ziel zu erreichen. Das ist freilich nicht in erster Linie der Punkt Omega am Ende unserer Route. Das Ziel liegt im Erlebnis des Weges und des Unterwegsseins selbst. Wann und wo der Wanderer Momente des Glücks oder der Bewusstseinserweiterung erlebt, ist nie vorhersehbar. Meistens geschehen sie auf dem Weg und nicht erst am Ziel. Alles, was die Durchlässigkeit für den Strom der Eindrücke von außen und der Regungen von innen steigert, ist willkommen. Alles, was uns an Bewegung und Wahrnehmung hindert, was uns von Natur und Kosmos und unserer Gefühlswelt abschottet, ist Ballast. Damit ist keiner radikalen Askese das Wort geredet. Es gibt ganz gewiss ein «Zuviel», aber eindeutig auch ein «Zuwenig». Wer stundenlang vor Kälte bibbernd unterwegs ist, hat nur noch einen Gedanken: ins Warme kommen. Wo eine Wanderung freudlos wird, wo sie die Gesundheit eher gefährdet als kräftigt, ist ebenfalls eine Grenze der Belastbarkeit überschritten. Die richtige Balance finden, für sich persönlich, prägt den individuellen Stil des Wanderns.
Eines scheint besonders wichtig: die Freude am Gehen nicht von der Qual des Tragens zerstören lassen. In diesem Licht ist die Frage der Ausrüstung zu bedenken. Nach der Wahl von Raum, Route und Jahreszeit für die Wanderung lauten die zwei Schlüsselfragen: Was brauche ich wirklich? Und: Wo liegt für mich persönlich die Grenze der Tragfähigkeit? Hier geht es um die genaue Bestimmung der eigenen Prioritäten. Was brauche ich, bei meiner aktuellen körperlichen Verfassung, dort, wo ich hin will, für die Zeit, die ich unterwegs bin? «Wandern ohne Gepäck» ist gewiss für manchen eine Option, aber im Prinzip keine Lösung. Man begibt sich dabei in die Abhängigkeit von Reiseveranstaltern und Hoteliers. Die Erfahrung von Freiheit, Autonomie und Autarkie geht dabei weitgehend verloren. Wer diese Erfahrung auskosten will, muss bei der Planung jeder Wanderung mehrere grundsätzliche Entscheidungen treffen: Will ich draußen schlafen? Will ich kochen? Bin ich bereit, bei Wind und Wetter zu wandern? Wer sich alle Optionen offenhält, erweitert seine Bewegungsfreiheit und Spielräume. Gleichzeitig reduziert er sein Budget. Aber er benötigt eine besondere Ausrüstung, muss also anderswo Abstriche machen. Kein Missverständnis also: Strapazen gehören elementar zum Wandern. Jane Fondas Motto «no pain, no gain» gilt auch hier. Aber die Strapazen sollten vom weiten Aktionsradius, von zerklüftetem Gelände oder rauer Witterung herrühren und nicht vom unerträglich schweren Gepäck.
Alle Erfahrung spricht für einen sorgfältigen Minimalismus. Gemeint ist eine alte, schlichte Weisheit. «Packt euren Rucksack leicht! Zieht euch leicht und schön an», so formulierten sie die Berliner Wandervögel vor dem Ersten Weltkrieg. Das «travel light» aus der Tradition der Trapper und Cowboys und «pack light, be safe» sind Parolen der Backpacker in den nordamerikanischen Wildnisreservaten. Alles weglassen, was verzichtbar ist. Aber auch alles mitnehmen, was für das Gelingen einer Wanderung unverzichtbar ist. Die Bewertung ist natürlich subjektiv. Für den einen sind Wanderstöcke ein absolut notwendiges Requisit. Der andere braucht seinen Vorrat an hochprozentiger Zartbitterschokolade. Bruce Chatwin hätte eher seinen Reisepass geopfert als sein Moleskine-Notizbuch. Darauf zu achten, dass man genug dabeihat, um unterwegs die Wanderlust zu erhalten und die Pforten der Wahrnehmung weit offen zu halten, wäre das Element der Sorgfalt in einer minimalistischen Strategie.
Leicht gesagt. Immer wieder tappt man in die Falle des Zuviel. Unterschwellig folgen wir erst mal der Logik: Je mehr wir mitnehmen, desto besser sind wir gegen alle Eventualitäten geschützt, desto besser gelingt die Wanderung. Dass diese Logik nicht stimmen kann, schwant jedem, der beim Aufbruch unter der Last des Rucksacks ins Taumeln kommt. Die Hoffnung, dass Körper und Geist sich nach ein paar Tagen an die Belastung gewöhnen, erweist sich als trügerisch. Trotzdem wandern wir allzu oft viel zu schwer beladen. Also mit aller Sorgfalt Ballast abwerfen. Ausgangspunkt sind die Fragen: Bis wohin geht für mich persönlich der «grüne Bereich» beim Packgewicht? Wo beginnt für meinen Körper die Schmerzgrenze? Bis zu welchem Punkt gehe und trage ich relativ unangestrengt und genieße noch die Leichtigkeit des Seins? Diesen Punkt gilt es zu ermitteln.
Sherpas schultern 30 Kilo und mehr für ihre ausländischen Kunden beim Trekking auf dem Dach der Welt. Die Portadores schleppen 25 Kilo über die andinen Inkapfade. Aber das ist ihre Arbeit. Annähernd gleiche Lasten haben Wildniswanderer im Norden Skandinaviens bei ihren 200-km-Winter-Touren auf dem Buckel. Trekking-Ferntouristen orientieren sich eigenartigerweise an dem 20-Kilo-Limit für Gepäck, das die Fluggesellschaften zulassen. Die Kataloge der Outdoor-Branche unterstellen, dass ein Backpacker durchschnittlich 15 Kilo Ausrüstung brauche.
Die konventionelle Weitwandererweisheit geht ungefähr so: Das Limit für eine mehrtägige Wanderung sollte man bei etwa 10 Kilo ansetzen. Zelt und Kochausrüstung für die volle Autarkie bringen noch einmal mindestens 5 Kilo extra auf die Waage. Wichtig ist, dass der Rucksack ein Tragesystem hat, welches das Gewicht gleichmäßig auf Schultern, Hüften und Rücken verteilt. Denn Schulter- und Nackenmuskulatur sind die neuralgischen Punkte. Der Rucksack muss eine gute Hinterlüftung haben, damit sich am Rücken keine Schweißpfütze bildet. Hauptkniff zum Gewichtsparen ist das «Zwiebeln». Man nehme also Kleidungsstücke, die sich übereinander anziehen lassen, und lege sie nach Bedarf Schicht für Schicht ab. Moderne Funktionsfasern sind eindeutig vorzuziehen. Sie sind leichter, atmungsaktiver und trocknen schneller als Naturfasern wie Wolle oder Baumwolle. Der leichteste und wärmste Schlafsack ist der Daunenschlafsack. Wenn er feucht wird, verliert er allerdings schnell seine Isolierfähigkeit. Dann ist man in einem Schlafsack aus synthetischen Hohlfasern besser aufgehoben. Bei den Wanderschuhen sollte man nicht sparen. Sie müssen ein exzellentes Fußbett haben, hinreichend stoßabsorbierend und stabil sein. Halbschuhe reichen fürs Mittelgebirge. In gerölligem, alpinem Gelände sind knöchelhohe Stiefel unabdingbar. Die Wandersocken sollten Fersen- und Fußsohlenverstärkung haben und perfekt sitzen. Vieles davon ist sehr überzeugend. Was aber tun, wenn man die vermeintlich «normale» 10- bis 15-Kilo-Last nicht schultern kann oder will? Dann hilft nur der Mut zum Weniger.
Eine radikale, aber in sich schlüssige Strategie des Ultraleichtwanderns hat der kalifornische Weitwanderer Ray Jardine entwickelt. Zusammen mit seiner Frau ist er schon mehrfach den seit 1968 existierenden Pacific Crest Trail von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada gewandert. Für die Strecke von 4000 Kilometern durch Wüsten, Bergwald und Gletscherregionen brauchten sie knapp fünf Monate. Ihr Tagespensum liegt bei durchschnittlich 40 Kilometern. Jeder hat knapp vier Kilo Grundgewicht bei sich. Dazu kommen Proviant und Wasser. Auf ihren extremen Touren arbeiten die Jardines mit einem ausgeklügelten Logistiksystem. Per Post lassen sie sich Ersatzsachen und Lebensmittel an ausgewählte Punkte entlang der Route schicken. Entscheidend aber ist: Sie bereiten sich in einem monatelangen Training von Muskulatur und Bänderapparat auf jede große Wanderung vor.
Ray Jardine, Jahrgang 1945, war, bevor er seinen Beruf an den Nagel hängte, Ingenieur für Raumfahrttechnologie. Er denkt also von Hause aus in «ultraleichten» und in «systemischen» Lösungen: alles Überflüssige weglassen, für jedes Teil die leichteste Variante wählen. Mit der Gewichtsreduktion bei den schwersten Brocken anfangen. Jardine kritisiert vehement die Kommerzialisierung des Wanderns durch die Outdoor-Branche, die immer neue Produkte auf den Markt bringt und für unverzichtbar erklärt. No logo! Die meisten seiner Ausrüstungsgegenstände sind Billigprodukte oder aus einfachen Materialien selbst geschneidert. Auch für den, der überwiegend in den dichtbesiedelten mitteleuropäischen Kulturlandschaften wandert, lohnt sich ein Blick auf das Konzept aus dem amerikanischen Westen.
Es setzt beim Elementaren an. Bei jedem Schritt hebt man mit der Beinmuskulatur den Fuß an, bewegt ihn durch Strecken vorwärts, setzt ihn wieder auf den Boden und lässt ihn abrollen. Diese Basisfunktion des Körpers beim Wandern gelte es zuallererst, so leicht wie möglich zu gestalten. In den Fokus kommt das Schuhwerk, der in der Regel schwerste Ausrüstungsgegenstand. Das Gewicht an den Füßen zu reduzieren sei die wirksamste Maßnahme zur Erleichterung des Wanderns. Also lehnt Jardine die klassischen, zwei Kilo schweren Bergstiefel ab und empfiehlt selbst für das Weitwandern im alpinen Gelände simple Laufschuhe. Auf Kosten der Sicherheit? Mitnichten, meint Jardine. Leichtfüßigkeit erhöhe nicht nur Ausdauer und Aktionsradius, sondern auch die Sicherheit. Denn entscheidend für den Schutz vor Prellungen, Zerrungen und Brüchen ist vor allem eine instinktive Achtsamkeit bei jedem Schritt, den man tue. Sportpsychologen nennen das die «psychomotorische Ansteuerung» des Bodens. Das Gespür für das Terrain und die Genauigkeit beim tastenden Aufsetzen des Fußes ist mit Joggingschuhen oder Sandalen eher als in klobigen Wanderstiefeln zu erzielen. Die unabdingbare Voraussetzung: ein kontinuierliches Training des Bewegungsapparates. Beine und Füße sind durch den Alltag auf glatten, harten Oberflächen «verblödet». Ihre Intelligenz muss sich langsam wieder entwickeln. Nicht der knöchelbedeckende Schaft, so Jardine, vermindere das Unfallrisiko, sondern vor allem die antrainierte Kraft von Fuß- und Kniegelenk und umgebender Muskulatur, von Bändern und Sehnen. Das Risiko, zu stürzen oder umzuknicken, wachse proportional zu dem Gewicht, das man mitschleppe. Was tun bei nassen Füßen? Einfach zulassen. Solange man in Bewegung sei, meint Jardine, gehe von der Feuchtigkeit kaum Gefahr aus. Wichtig sei, bei jeder Pause sofort die nassen Sachen auszuziehen und die Füße zu wärmen. «Was wir brauchen», schreibt Jardine in seinem Buch Beyond Backpacking, «sind nicht Wanderstiefel, welche die Füße trocken halten, sondern Schuhe und Socken, die einigermaßen schnell trocknen, sobald der Regen aufgehört hat.»
Warum schleppen wir notorisch zu viel mit? Ein Faktor, meint Jardine, ist unsere Entfremdung von der Natur. Sie macht uns überängstlich und verhindert, dass wir uns auf die natürlichen Gegebenheiten – auf Wind und Wetter und Unbilden der Natur – einlassen und uns ihnen flexibel anpassen. Wir sind unsicher, was unser Körper zu leisten vermag. Überzogene Komfortansprüche und Sicherheitsbedürfnisse stehen uns im Weg. Die Maßstäbe nehmen wir aus unserem sesshaften urbanen Alltag. Dort freilich sind wir abhängig von einer Menge von Dingen, um die vorgegebenen Standards von Körperpflege, Kleiderordnung, thermischer Behaglichkeit etc. einzuhalten. Wer unterwegs denselben Komfort wie zu Hause braucht, sollte nicht wandern. Wer sich an den Standards der Outdoor-Branche oder am Dresscode im Speiseraum eines Landhotels orientiert, muss mit höherem Gewicht büßen. Wandern ist ein temporärer Ausstieg aus der Sesshaftigkeit, um der Erfahrung des Anderen willen. Es ist kräftezehrend und schweißtreibend. Unweigerlich beginnt unterwegs ein «sanfter Abstieg in die Verwahrlosung».
Der amerikanische Autor und Appalachian-Trail-Weitwanderer Bill Bryson hat ihn – selbstironisch – beschrieben: «Am Ende des ersten Tages fühlt man sich etwas schmutzig, trägt es aber mit Fassung; am zweiten Tag verstärkt sich das Gefühl bis zum Ekel; am dritten Tag kümmert es einen nicht mehr; am vierten hat man vergessen, dass es mal anders war.» Sich dagegenzustemmen erfordert Berge an frischer Wäsche. Lässt man sich auf «primitive travelling» ein, kann man auch bei einer längeren Wanderung mit einer einzigen Garnitur Wechselwäsche auskommen. Die allerdings sollte warm und trocken und leicht zu waschen sein. Also keine Absage an Sauberkeit und Körperpflege. Sich selbst am – nicht im! – Bach oder See zu waschen ist oft unbequem, aber machbar. Die tägliche kalte Dusche aus der Wasserflasche oder eine Abreibung mit dem nassen Handtuch unter freiem Himmel reicht unterwegs eine Zeit lang aus. Es ist ein erfrischendes Ritual und Abenteuer für sich.
Ein Zelt als «mobiles Wohnzimmer» braucht man bei vielen Touren nicht. In den mitteleuropäischen Nächten tut es meistens auch ein Biwaksack. Die Jardines schlafen auf ihren extremen Touren im Wilden Westen nahe am Trail, um keine Zeit und Kraft für den Abstieg zu Schutzhütten oder Campingplätzen zu vergeuden. Rechtzeitig vor Sonnenuntergang suchen sie für das Nachtlager sorgfältig eine Stelle im Gelände aus. Ihr «stealth camp» (getarntes Biwak) liegt versteckt, windgeschützt und trocken. Eine selbstzugeschnittene Plastikplane, mit Stangen aufgestellt, erfüllt bei regnerischem Wetter die elementare Funktion eines Zeltes: Obdach zu geben. Die aufblasbare Isomatte – bequem, aber schwer – ist verzichtbar. Als Unterlage dient ein auf Körpermaß geschnittenes Stück Schaumstoff. Es wird mit dürren Ästen, trockenem Laub und Kleidungsstücken unterfüttert. Aber: Wer immer sich die Freiheit nimmt, in der Natur zu nächtigen, sagt Jardine mit großem Nachdruck, hat sich strikt an eine Regel zu halten: «no trace!» Keine Spuren hinterlassen.
Für fünf Kilogramm Gepäck braucht man keinen Riesenrucksack. Schon dieser Verzicht bringt eine enorme Gewichtsreduktion. Denn große Rucksäcke haben ein hohes Eigengewicht. Sie sind voluminös und aufwändig ausgestattet. Mit Zwischenböden, Innengestell, Polstern, Hüft- und Schultergurten sind sie dazu konstruiert, eine Vielzahl von Dingen zu fassen und deren in der Summe bleiernes Gewicht einigermaßen gleichmäßig auf Rücken und Hüfte zu verteilen. Folgt man Jardine, so reicht auch für weite Wanderungen ein schmaler 30- bis 40-Liter-Tourenrucksack vollkommen aus. Unverzichtbar ist jedoch, dass der Inhalt trocken bleibt. Dafür sorgt aber nicht die – angeblich – wasserdichte Außenwand des Hightech-Rucksacks. Ein oder zwei einfache Müllsäcke, in denen man bei Regen alle Sachen innerhalb des Rucksacks verstaut, tun es auch, vielleicht sogar besser.
Beim «ultraleichten» Wandern erscheint auch eine weitere Gretchenfrage der Ausrüstung in neuem Licht, nämlich die Frage der Wanderstöcke. Kein Zweifel, die zwei Stöcke entlasten Knie- und Fußgelenke. Wer dort oder im Rücken Probleme hat, sollte selbstverständlich diesen Vorteil nutzen, vor allem bei langen, steil abschüssigen Strecken. Aber je leichter Schuhe und Rucksack wiegen, desto eher entfällt die Notwendigkeit von Gehhilfen. In vielen Fällen wird der Gebrauch von Wanderstöcken überflüssig. Eine gute Nachricht für Wanderer, die Stöcke ablehnen. Sei es, weil diese ihren Rhythmus beim Gehen oder ihren Gleichgewichtssinn durcheinanderbringen. Sei es, weil ihnen Nordic Walking zu laut ist oder weil sie es schlicht und einfach für affig halten. Auch «Ray’s ways» sind kein Dogma. Aber sie haben drei große Stärken: Sie denken die Frage der Ausrüstung von der Bewegung in der Landschaft her. Sie zielen auf den möglichst intimen Kontakt mit der Natur. Sie sparen viel Geld.