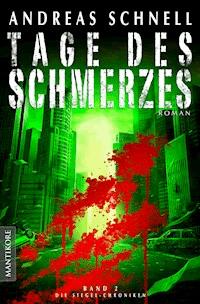5,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: A. Fritz Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Frankfurt am Main. Heute! Eine Sondereinheit des Innenministeriums kümmert sich um die „Gestrandeten“, Menschen und andere Kreaturen, die über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Als ein grauenvoll zugerichteter Leichnam gefunden wird, übernimmt Noah Lumen den Fall, doch der heruntergekommene Ermittler ist mehr mit sich selbst und dem Hass auf die Welt beschäftigt, als mit der Lösung des Falles. Erst als immer mehr Leichen auftauchen und sich eine vorwitzige Kripo-Beamtin einmischt, nehmen die Dinge Fahrt auf. Aber Noah hat noch eine ganz andere Rechnung offen, die er begleichen will, koste es was es wolle!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Ähnliche
Von Leichen, Magie und Geistern der Vergangenheit
Andreas Schnell
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Epilog
Über das Buch
Frankfurt am Main. Heute!
Eine Sondereinheit des Innenministeriums kümmert sich um die „Gestrandeten“, Menschen und andere Kreaturen, die über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Als ein grau- envoll zugerichteter Leichnam gefunden wird, übernimmt Noah Lumen den Fall, doch der heruntergekommene Er- mittler ist mehr mit sich selbst und dem Hass auf die Welt beschäftigt, als mit der Lösung des Falles. Erst als immer mehr Leichen auftauchen und sich eine vorwitzige Kripo-Beamtin einmischt, nehmen die Dinge Fahrt auf. Aber Noah hat noch eine ganz andere Rechnung offen, die er begleichen will, koste es was es wolle!
Über den Autor
Andreas Schnell, geboren 1973, lebt und arbeitet als Publizist und Unternehmer in der Kreativbranche in Frankfurt am Main.
Nachdem er bereits mit den „Siegel-Chroniken“ seine Heimatstadt zum primären Ort der Handlung machte, begibt er sich mit „Noah Lumen“ erneut in das Herz der Mainmetropole.
Originalausgabe
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
A. FRITZ VERLAG
Autor: Andreas Schnell
Titelbild: Dmitrijs Bindemanis
Korrektorat: Anke Schnell
Lektorat: Ulrich Schüppler
a-fritz-verlag.de
ISBN 978-3-944771-20-5
Für Anke, die Noah niemals aufgegeben hat!
Kapitel 1
„Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky voraus sein.“
- Humphrey Bogart
Das Ambiente bot zweifelsohne den Rahmen für einen denkwürdigen Abend. Die nikotingeschwängerte Luft hing schwer in der kleinen Bar, aus den Lautsprechern ertönte ein langsamer Blues. Es war zwei Uhr morgens und der Barkeeper begann damit die Einnahmen zu zählen. Noah saß derweil auf dem Hocker und starrte in sein Glas, in dem sich ein paar Eiswürfel und der Rest des bernsteinfarbenen Bourbons befanden. Er konnte darin jedoch nichts weiter erkennen als das Bedürfnis, so schnell wie möglich nachzuschenken.
»Willst du nicht langsam mal den Heimweg antreten?«, fragte Elmo. Er war der Besitzer, Rausschmeißer, DJ und die Bedienung seiner Bar. Eine echte eierlegende Wollmilchsau, zwangsweise, die Zeiten waren schlecht. Darüber hinaus war er aber auch einer der wenigen, die sich zu Noahs Freunden zählen konnten.
»Und dann?«, fragte Noah, nahm den letzten Schluck aus seinem Glas und schob es zu Elmo rüber.
»Vielleicht schlafen? So machen das normale Menschen, habe ich gehört.« Elmo grinste, aber seine müden Augen verrieten, dass er mit seinem Ratschlag nicht allein das Wohl seines Freundes im Sinn hatte.
»Ja, genau«, sagte Noah und gab zur Untermalung seiner leicht lallenden Aussprache noch ein prustendes Geräusch von sich. »Normale Menschen.«
Noah war der letzte Gast und es war klar, dass er weder Anstalten machte, sich von seinem Platz zu erheben, noch in der Stimmung für Smalltalk war. Nach seinem Dafürhalten war es nur gerecht, wenn er so lange hier sitzen bliebe, bis er vom Hocker fallen und Elmo ihn irgendwie heimbringen würde. Es wäre wahrlich nicht das erste Mal gewesen.
»Ich muss morgen früh raus«, sagte Elmo. »Also schwing deinen Arsch nach Hause, ich will den Laden dicht machen.«
Jeder andere hätte für diese verbale Entgleisung ein paar saftige Backpfeifen von Noah kassiert, der – besonders wenn er getrunken hatte – nur wenig Geduld aufbringen konnte. Die meisten Menschen hätten Derartiges aber ohnehin nicht zu ihm gesagt. Noah war mit etwa 1,80 Meter zwar nicht überdurchschnittlich groß, hatte aber etwas an sich, das Gesprächspartnern einen gewissen Grundrespekt einflößte.
Noah war massig gebaut, manche hätten es dicklich genannt. Er hatte nicht die Figur eines Bodybuilders, aber Arme und Schultern zeugten davon, dass er niemand war, der sein Leben lang auf der Couch zugebracht hatte. Doch wie so oft im Leben waren Äußerlichkeiten nur die halbe Miete. Wie er redete, sich bewegte, besonders aber wie er Menschen anschaute, das ließ die Nachricht »schau mich schief an und ich polier dir die Fresse« rüberkommen. Man konnte wahrlich nicht behaupten, dass Noah jemand war, der rasend schnell Freunde gewann.
»Leck mich doch, du Penner«, sagte Noah und stand auf. Als er mit seinem ganzen Gewicht auf beiden Beinen stand, wankte er kurz, hatte sich aber soweit im Griff, dass er nicht der Länge nach hinschlug.
Elmo, der auch nicht gerade zimperlich war, wenn ihm jemand dumm kam, nickte nur und winkte ab. Beide kannten sich schon seit der Schulzeit, die rund zwanzig Jahre zurücklag. Auch wenn es hin und wieder mal ordentlich im Karton schepperte, waren sich sowohl Noah als auch Elmo darüber im Klaren, dass sie mit dem jeweils anderen Pferde hätten stehlen können. Anrufe morgens um vier, gemeinsame Besäufnisse, Schlägereien, Herzschmerz: Es gab nur wenig, was die zwei Frankfurter nicht miteinander geteilt hatten.
»Soll ich dir ein Taxi rufen?«, fragte Elmo, doch bereits in dem Moment, als er den Satz zu Ende gebracht hatte, wusste er, dass es vergebene Liebesmüh war. Noah schwankte schon in Richtung Ausgang und die einzige Antwort, die er für Elmo übrig hatte, war der ausgestreckte Mittelfinger, den er ihm präsentierte, während er die Tür öffnete und nach draußen schritt.
Das eiskalte Becken nach einem Saunagang, ein Gummiknüppel auf dem Schädel oder die schallende Backpfeife einer Frau, die man liebte: All das erzeugte ein ähnliches Gefühl, wie dieser Augenblick, als sich die kühle Luft um Noah schloss, wie Schnee nach einer Lawine. Hinter ihm fiel die Eisentür mit einem lauten Knall ins Schloss und er wurde sich schlagartig bewusst, dass seine Jacke noch in der Bar hing.
»Das kannst du dir abschminken«, sagte Noah zu einem imaginären Elmo und setzte einen Fuß vor den anderen, in der Hoffnung, dass sein Gedächtnis ihn bezüglich des Standorts seines Wagens nicht trügen würde.
Obwohl das Rotlicht und die leicht bekleideten Damen, die aus einigen der Fenster schauten, den Anschein von Wärme verbreiteten, sprach die kalte und feuchte Novemberluft eine andere Sprache. Fünf Grad und ein eisiger Wind, der durch die Hochhausschluchten der Mainmetropole fegte, ließen Noah zittern. Aber selbst arktische Temperaturen und zehn Pferde hätten ihn nicht zurück in die Bar gebracht.
Er hatte seinen Stolz. Irgendwo zwischen »Foxy Ladies« und einer grell leuchtenden Reklame, die »Girls & Drinks« versprach, hörte Noah ein Klingeln. Er blieb stehen und während sich sein Oberkörper in kreiselförmige Bewegungen ergab, versuchte er auszumachen, woher das Geräusch stammte.
In Frankfurt war es niemals wirklich ruhig, zumindest nicht im Bahnhofsviertel, aber in diesem Moment konnte er in seiner unmittelbaren Umgebung niemanden sehen oder hören. Erst nach ein paar Sekunden hatte er begriffen, dass es sein eigenes Mobiltelefon in derHosentasche war, das nach Aufmerksamkeit schrie.
Der eine oder andere sagte Noah nach, dass er vollkommen veraltete Ansichten hatte. Darüber konnte man in einigen Punkten streiten. Außerhalb jeglichen Debattierrahmens war jedoch sein Handy, das bereits vor zehn Jahren keinen Nerd mehr hinter dem Ofen hervorgelockt hätte.
Es war verhältnismäßig groß und schwer, hatte nur ein kleines Monochromdisplay und die größte Finesse bestand darin, eine SMS verschicken zu können.
»Was?«, bellte Noah, nachdem er endlich die Taste mit dem grünen Hörer gefunden hatte, um das Gespräch anzunehmen.
»Noah?«, ertönte eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Scheiße, ja. Du musst doch wissen, wen du angerufen hast!«, knurrte Noah. Dabei hörte sich seine Antwort so an, als wäre ein Wort direkt an das andere gebunden, ohne den kleinsten Zwischenraum.
»Hier ist Patrizia«, antwortete die Frau unbeeindruckt und gelassen. Es schien nicht das erste Mal zu sein, dass sie Noah in einem derartigen Zustand am Telefon hatte. »Spitz mal für einen Moment deine Ohren und versuche, die paar Gehirnzellen, die du dir noch nicht weggesoffen hast, zusammenzunehmen.«
Noah hielt das Telefon nun von sich weg und betrachtete es mit einer Mischung aus Ärger und Unverständnis. Dazu schüttelte er den Kopf, als könne er es nicht fassen, dass – nach Elmo – nun noch eine weitere Person die Dreistigkeit besaß, ihn auf diese Art und Weise anzufahren. Erst als er Patrizia wieder reden hörte, bewegte er das Telefon langsam in Richtung seines Ohres.
»Es gibt einen 107 im Gallusviertel«, sagte Patrizia.
»Wir haben von einem Informanten den Tipp bekommen, dass es was für uns sein könnte. Fahr bitte sofort vorbei und stelle fest, was da los ist. Die Adresse schicke ich dir gleich auf das Tablet. Alles klar?«
Noah sortierte die Informationen, die er gerade von Patrizia bekommen hatte, und atmete mehrmals tief durch. Ihm war klar, dass er von jetzt auf gleich unmöglich nüchtern werden konnte, aber er wusste, dass er zumindest einigermaßen auf dem Damm sein musste, bevor er im Gallus ankommen würde.
»Noah«, rief Patrizia, »hast du das alles verstanden?«
»Ja, ja«, sagte Noah, »nerv nicht.« Dann legte er auf und ging ein wenig gradliniger und schneller in Richtung seines Autos, von dem er nun sicher war, dass es sich vor dem Laufhaus in der Niddastraße befand.
Auf dem Weg schimpfte er in seinen Dreitagebart hinein, dass das Leben beschissen, Patrizia eine nervtötende Schlampe und sein Job überhaupt und sowieso das Allerletzte war. Nur die Hälfte davon meinte er wirklich ernst, aber es half ihm, ein wenig Dampf abzulassen und als er bei seinem Auto angekommen war, hatte sein Puls beinahe schon wieder auf Normalfrequenz erreicht.
Er fummelte nach dem Autoschlüssel und öffnete die Tür des silbergrauen 5er BMW, der seine besten Jahre schon lange hinter sich gelassen hatte.
Der Gestank kalten Rauches, der sich schon lange in alle Poren und Ritzen des Interieurs gefressen hatte, vermischt mit dem Pinienduft des Wunderbaumes und alten Fastfoodresten umgab Noah, als er die Autotür hinter sich zuzog. Für einen Moment schloss er die Augen und atmete mehrmals tief durch. Dann kramte er aus dem Unrat auf dem Beifahrersitz einen Pappbecher mit Deckel heraus, in dem sich noch ein Rest Kaffee von gestern befand. Mit einem Schluck schüttete er sich die schwarze Flüssigkeit in den Rachen und schaltete dann den Computer ein, der in der Mittelkonsole eingebaut war.
Der sieben Zoll große Bildschirm leuchtete in einem sanften Blau und stand mit den serifenlosen weißen Lettern, die unter dem Thymion-Logo das Menü bildeten, einen futuristischen Kontrast zum Rest der Umgebung, die ein wenig wirkte, als wäre sie aus der Zeit gefallen. Oben links blinkte bereits ein kleines Briefumschlagsymbol, in dessen unterer Hälfte eine rote Eins zu sehen war.
Noah las sich die Nachricht von Patrizia durch, die lediglich eine Adresse im Gallusviertel enthielt. Eine Direktverknüpfung verriet ihm, dass das Ziel 6,5 Kilometer entfernt war. Daneben befand sich ein Symbol, um die Navigationsapp zu aktivieren.
Noah schaltete den Computer wieder aus, startete den Motor und fuhr mit quietschenden Reifen los, nachdem er beim Zurücksetzen aus der Parklücke beinahe ein vorbeifahrendes Auto gerammt hatte. Die wütenden Rufe des Fahrers ignorierte Noah, da er weder in der Stimmung war, noch Zeit dazu hatte, sich mit Verrückten auseinanderzusetzen.
Die Stadt bemühte sich redlich, dem Gallusviertel einen neuen Anstrich zu geben. Das alte Arbeiterviertel hatte sich seit den 1970er Jahren zusehends zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Für Noah war das nie ein Problem gewesen, er mochte diese Kiez-Mentalität und das Wandern zwischen den Grauzonen der modernen Gesellschaft, die für ihn ohnehin dem Untergang geweiht war.
Sehr viel mehr störte ihn die Tatsache, dass immer mehr Menschen dort wohnten, die seiner Meinung nach im Gallus eigentlich nichts zu suchen hatten: Banker und andere Geschäftspfeifen, die mit dem Underdog- Status des Viertels kokettierten, aber dennoch niemals dazugehören konnten oder wollten.
Mit diesem Gefühl in der Magengegend, verbunden mit Schlafmangel und reichlich Bourbon im Blut, fuhr er an der Galluswarte vorbei in Richtung der Adlerwerke, einem alten Industriebau, der inzwischen von Kulturschaffenden okkupiert war. In einer der Seitengassen war er am Ziel seiner mehrminütigen Reise angelangt. Obwohl Noah am Ende der Straße zwei Einsatzwagen der Polizei, eine kleine Menschentraube und die dazugehörige Absperrung sehen konnte, parkte er in einiger Entfernung und legte den Rest des Weges zu Fuß zurück. Ein paar Schritte mehr – um sich zu konzentrieren und frische Luft zu tanken – konnten nicht schaden.
Obwohl es inzwischen drei Uhr morgens war, standen gut ein Dutzend Menschen um den Eingang der Mietskaserne herum. In dieser Gegend sah ein Haus wie das andere aus. Oberflächlich betrachtet war alles durch aufwendige Renovierungsmaßnahmen der Wohnungsgesellschaft aufgehübscht worden, aber an den menschlichen Dramen, die sich im Inneren abspielten, hatte sich nichts geändert.
Nie war das Wort Fassade passender, dachte Noah und drängte sich durch die Menschentraube in Richtung Eingangstür, wo zwei Polizisten standen und verzweifelt versuchten, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er schätzte die beiden Männer, die den Rang eines Polizeimeisters innehatten, auf nicht viel älter als 24 oder 25 und wusste, dass sie sich die Nacht anders vorgestellt haben mussten. Einer war breitschultrig und mit einer bemerkenswerten Knubbelnase ausgestattet, während der andere eher klein und fast schon zierlich war.
Noah löste sich aus der Menge, bückte sich unter dem Absperrband durch und ging geradewegs auf die Eingangstür zu. Polizeimeister Knubbelnase trat einen Schritt vor und machte eine zurückweisende Handbewegung. »Es tut mir leid. Ich muss Sie bitten, sich wieder hinter …«
»Schon gut«, sagte Noah und zückte eine aus Leichtmetall und mit Goldüberzug versehene ovale Marke, auf der sich eine achtstellige Identifikationsnummer befand. Darunter sein Name, Noah Lumen. Umrandet war das Ganze mit dem Schriftzug „Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland – Spezialeinheit 3 (SE3)“.
Noah wartete auf keine Reaktion der beiden verdutzten Beamten, die noch nie in ihrem Leben eine solche Marke gesehen hatten oder auch nur im Entferntesten verstanden, um was es sich bei der SE3 des Innenministeriums handelte. Er lief einfach weiter, rempelte noch den schmalbrüstigen Polizisten an und ging in den Hausgang hinein.
Gerade als er die ersten Stufen erklommen hatte, drehte sich Polizeimeister Knubbelnase – nachdem er ein paar hektische Worte mit seinem Kollegen gewechselt hatte – zu Noah um und rief ihm hinterher: »Bleiben Sie mal stehen. Ich kann Sie nicht so einfach durchlassen. Ich muss …«
Noah blieb stehen und seufzte. Er wusste, dass es immer eine Fifty-fifty-Chance gab, dass sein Auftreten so einschüchternd wirkte, dass er genau das tun konnte, was er wollte. Die beiden jungen Polizisten schienen aber von der Sorte zu sein, die einen Rüffel ihres Chefs mehr fürchteten als Noahs forsche Art. Diese Verzögerung trug nicht wesentlich dazu bei, Noahs Laune zu verbessern.
»Jetzt hört mir mal zu, Dick und Doof«, sagte er und ging wieder eine Treppenstufe herunter, »wenn ihr zwei Quadratschädel zu bescheuert seid, eine Marke zu erkennen, wenn ihr sie seht, ist das nicht mein Problem. Wir können das hier auf zwei Arten regeln: Ihr dreht euch einfach wieder um und steht weiter Spalier oder aber ich rufe jetzt sofort euren Vorgesetzten an, ich schätze mal Polizeihauptkommissar Schick vom 16. Revier. Dann dürftet ihr die nächsten vier Wochen damit beschäftigt sein, Strafzettel zu verteilen. Also, wie wollen wir es machen?«
Knubbelnase und Schmalbrust drehten sich um und entschieden sich für die erste Option. Da Noah sich keine allzu große Mühe gegeben hatte, leise zu sprechen, waren sie nun auch noch dem Spott der Zuschauer ausgesetzt. Aber Noah bekam nichts davon mit. Er befand sich wieder auf dem Weg nach oben.
Der Hausflur war deprimierend. Beigefarbene Wände und steingraue Treppenstufen. An zahlreichen Stellen bröckelte der Putz ab. Im ersten Stock angekommen, präsentierten sich Noah die hölzernen Wohnungstüren jeweils links und rechts von ihm. Beide waren geschlossen, aber er zweifelte keinen Moment daran, dass dahinter die allseits aufmerksamen Nachbarn standen, ihre Ohren gegen die Tür und Augen gegen den Spion gepresst. Egal was passiert war, es würde schnell die Runde machen.
Von weiter oben konnte Noah Stimmen hören und machte sich daran, das nächste Stockwerk zu erklimmen. Mit jedem Schritt verdichtete sich das Stimmengewirr zu verständlichen Worten und ließ Noah hoffen, nicht weiter nach oben gehen zu müssen. Er war eigentlich in passabler Form, aber sein Körper ließ ihn unmissverständlich wissen, dass er in naher Zukunft die weiße Fahne schwenken würde.
Im zweiten Stock stand die Tür zu Noahs Linken halb offen. Auf einem lieblos angebrachten Namensschild unter dem Spion konnte er den Namen „Nowak“ erkennen. Der offene Türspalt ließ eine Stimme vernehmen, die einen vertrauten Fachjargon benutzte. Ein Arzt müsse den Tod feststellen, sagte die Stimme, und dann sollte der Leichnam so schnell wie möglich von hier weggebracht werden. Bloß keine Presse. Eine Riesensauerei.
Hier bin ich also genau richtig, dachte Noah und trat in die Wohnung ein. Sofort konnte er den Geruch von verbranntem Fleisch wahrnehmen, was in ihm eine Magensaft-Bourbon-Mischung aufsteigen ließ und Noah einige Konzentration abverlangte. Er wusste, dass es für seinen Auftritt nicht besonders förderlich sein würde, die anwesenden Polizisten mit Erbrochenem zu begrüßen.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und schritt langsam durch den zugemüllten Flur. Noah hatte schon einige Messi-Wohnungen gesehen. Das hier war zwar keine, stand aber kurz davor. Entlang der linken Wand waren zahllose leere Flaschen und Dosen aufgereiht und versprachen ein ordentliches Sümmchen an Pfandgeld. Rechts war eine kleine Kommode, auf der sich ein Stapel Zeitungen befand, gekrönt von dreckiger Wäsche. Zu beiden Seiten gingen Türen ab, die ins Badezimmer und die Küche führten. Das Interessante spielte sich aber direkt vor Noah im Wohnzimmer ab.
»Was ist hier passiert?«, fragte er, als er in das vollkommen überfüllte Zimmer trat. Zwei Schutzpolizisten standen am Fenster, einer telefonierte, der andere unterhielt sich mit einer jungen Frau und einem grau melierten, dickbäuchigen Kerl. Noah war sich sicher, dass sie zur Kriminalpolizei gehörten.
Sie alle hatten sich um einen Sessel herum drapiert, der ein paar Meter von dem – zumindest nach heutigen Maßstäben – vollkommen veralteten und viel zu kleinen Röhrenfernseher entfernt stand. Die Quelle des Gestanks und der allgemeinem Aufmerksamkeit saß in dem schwarzen Lederimitatsessel. Ein junger Mann, etwa dreißig Jahre alt. Jogginghose, Turnschuhe, Oberkörper nackt. Das weiße T-Shirt lag zusammengeknüllt ein paar Meter weiter weg in einer verdreckten Ecke.
Verfluchte Scheiße, dachte Noah und konnte seinen Blick nicht von dem Mann nehmen. Von Brustmitte bis zum Bauchnabel klaffte eine große Wunde, die an beiden Enden spitz zulief. Die Ränder waren ausgefranst und verbrannt. Für sich genommen ein schrecklicher Anblick, aber noch faszinierender waren die nicht vorhandenen Knochen und Innereien des Opfers. Dort, wo der Blick auf Teile des Brustkorbs, des Magens, der Leber und Teile des Darms treffen sollte, war nichts mehr vorhanden.
»Und wer sind Sie?«, fragte die Frau. Es dauerte einige Sekunden, bis Noah wieder all seine Sinne beisammen hatte und von der leergeräumten Leiche zu der Polizistin schaute.
»Noah Lumen«, sagte er und präsentierte seine Marke.
»Innenministerium SE3.«
Die junge Frau war gut und gerne ein Kopf kleiner als Noah. Die schwarzen Haare, die zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden waren, und die haselnussbraune Haut verrieten ihren südländischen Hintergrund. Sie schaute skeptisch auf die Marke und dann Noah in die Augen. Er erkannte sofort zwei Dinge: Erstens war sie nicht erfreut, irgendeinen Ministeriumsheini hier an ihrem Tatort zu haben, der unter Umständen den Fall an sich reißen konnte. Und zweitens, sie hatte Feuer.
»Carmen Tirado. Kripo«, sagte die Polizistin und deutete anschließend auf ihren wesentlich älteren Kollegen.
»Das ist mein Partner, Henri Bader. Was macht das Innenministerium hier?«
»Ich wurde informiert, dass es hier möglicherweise einen Vorfall gibt, der im Zusammenhang mit einer Serie von Verbrechen steht, die wir untersuchen.«
»Da wurden Sie aber schnell informiert, Herr Lumen«, sagte Carmen und konnte ihren aufkommenden Ärger nur schwer unterdrücken. »Wir sind auch erst seit ein paar Minuten hier.«
»Vielleicht bin ich einfach ein weniger schneller als ihr Schnarchnasen von der Kripo«, sagte Noah und grinste breit. Für einen Moment sah er die Augen von Carmen aufblitzen und rechnete fest damit, eine Backpfeife zu kassieren. Stattdessen zog sie jedoch nur ihre Stirn kraus und würdigte den Kommentar Noahs mit einem abfälligen Schnauben.
»Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich mir Ihre Identität bestätigen lasse, oder?«, schaltete sich Henri ein und zückte sein Handy.
»Nur zu.«
»Nichts anfassen«, sagte Henri und verließ mit dem Telefon am Ohr den Raum.
Unter den wachsamen Blicken der beiden Uniformierten und der Kriminalpolizistin ging Noah den Raum ab. Für eine Weile galt sein Interesse noch der Leiche, dann schaute er sich um. Er war guter Dinge, das weder die beiden Kripobeamten noch die Jungs von der Streife hier gewütet hatten, was eine mögliche Sicherung von Beweisen erleichtern würde.
»Was ist das hier?«, fragte Carmen. »So was habe ich in meinen zehn Dienstjahren noch nie gesehen.«
»Ja«, sagte Noah und ging zu dem T-Shirt des Mannes, das es sich gemeinsam mit einigen Spinnweben und Staubflocken auf dem grauen Teppich – Noah vermutete, dass er einmal weiß gewesen sein musste – gemütlich gemacht hatte. »So was kommt selbst hier im Gallus nicht so oft vor, was?«
Carmen wollte gerade zu einer schnippischen Antwort ansetzen, als Henri wieder ins Zimmer kam. Sein verärgerter Gesichtsausdruck verriet Noah, dass er von seinem Vorgesetzten eine Antwort erhalten hatte, die ihm ganz und gar nicht in den Kram passte. »Der Kerl kommt wirklich vom Innenministerium und weißt du was?«
Carmen schüttelte den Kopf.
»Das ist jetzt sein beschissener Fall. Auf Anweisung von ganz oben sollen wir, ich zitiere, ,ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen.«
»Na, so was«, polterte es aus Noah heraus, dessen aufgesetzte Freude und Großspurigkeit nur noch von seinem Blick übertroffen wurde, der Carmen, jedoch insbesondere Henri, wie ein schmerzhafter Schlag ins Gesicht traf. »Dann gehen wir mal an die Arbeit!«
Henri blieb mit verschränkten Armen in der Tür stehen. Es war offensichtlich, dass er nicht nur mit der Situation an sich, sondern auch mit Noah seine Probleme hatte. Carmen, die zwar auch nicht sonderlich darüber erfreut war, dass man ihr nun jemanden vor die Nase gesetzt hatte, den sie nicht kannte, nahm das Ganze wesentlich gelassener. Noah hatte den Eindruck, dass sie in erster Linie daran interessiert war, den Fall aufzuklären, vermutlich von Ehrgeiz und Neugier getrieben. Eine Kombination, die, das wusste kaum jemand besser als Noah, nicht der schlechteste Ansatz war.
»Arzt und Leichenwagen sind bestellt«, sagte Carmen. »In einer knappen Stunde dürfte auch die Spurensicherung hier sein. Wir haben momentan nur ein Team und das ist noch anderweitig beschäftigt.«
»Wissen wir schon, wer der Kerl ist?«, fragte Noah, schaute jedoch nicht auf und widmete sich weiter dem T-Shirt, das er inzwischen mit einem Kugelschreiber aufgespießt hatte und von allen Seiten betrachtete.
»Boris Nowak«, sagte einer der Uniformierten und hielt einen kleinen Notizblock in der Hand. »29 Jahre alt, ledig, keine Kinder.«
»Das ist alles?«, fragte Noah, legte das T-Shirt auf den Fernseher und breitete es aus. »Was habt ihr hier die ganze Zeit gemacht? Dick und Doof unten halten wenigstens die Leute in Schach.«
»Was soll das denn, wir …«, verteidigte sich der Polizist.
»… sollten einfach die Klappe halten«, unterbrach Noah sein Gegenüber und bedachte ihn mit einem genervten Blick. »Und jetzt macht, dass ihr hier rauskommt. Es gibt doch bestimmt noch etwas Wichtiges zu tun, oder? Sucht ein paar randalierende Kids oder stopft euch mit Donuts voll. Hauptsache ihr steht hier nicht im Weg rum.«
Die zwei Polizisten sagten kein Wort mehr und verließen erst das Wohnzimmer und dann die Wohnung von Boris Nowak. Zum Abschluss gab es noch eine knallende Tür und Noah wurde spontan an zwei kleine Jungs erinnert, die vom Vater in ihr Zimmer geschickt wurden. Er grinste und schaute zu Carmen und Henri, die über sein Verhalten weitaus weniger amüsiert zu sein scheinen.
»Meine Güte«, sagte Henri und schüttelte den Kopf, »was für ein Riesenarschloch Sie sind.«
Henri und Carmen waren seit rund fünf Jahren Partner und obwohl sie sich gut verstanden, hätten sie unterschiedlicher nicht sein können. Während Henri kurz vor der Pensionierung stand und nicht müde wurde zu erwähnen, dass er sich nicht mehr krumm machen würde, hatte Carmen noch echte Ambitionen. Ein Umstand, den Henri meist unkommentiert ließ, jedoch hin und wieder mit einem mitleidigen Lächeln quittierte.
»Dieser Noah hat auf hundert Meter gegen den Wind nach Alkohol gestunken«, sagte Henri und schüttelte mit einer Mischung aus Ekel und Ärger den Kopf.
Beide waren auf dem Weg zurück ins Präsidium. Inzwischen war es fünf Uhr morgens und ihre Schicht würde in rund einer Stunde beendet sein. Bei dem Gedanken an den Papierkram begannen die Schläfen von Carmen zu pochen. Sie hasste jegliche Art von Büroarbeit und wenn ihr damals jemand in der Polizeischule erzählt hatte, dass ein Großteil des Jobs darin bestehen würde, irgendwelche Formulare auszufüllen, wäre sie vermutlich Plan B gefolgt und Tierärztin geworden.
»Wahrscheinlich haben Sie ihn aus einer Bar rausgeklingelt«, sagte Carmen, während sie den Dienstwagen, einen nicht ganz neuen Golf, vor einer roten Ampel zum Stehen brachte. »Das würde auch seine beschissene Laune erklären.«
»Mich würde ja mal interessieren, was diese Spezialeinheit des Innenministeriums überhaupt ist und warum die sich in unseren Scheiß einmischen«, polterte Henri. »Ich meine, eigentlich ist mir das ja egal, aber dieser Typ hat uns ja behandelt wie die letzten Vollpfosten.«
Carmen kommentierte die Schimpftirade ihres Partners nicht weiter. Sie wusste, dass sie damit nur Öl ins Feuer gießen würde. Henri war normalerweise relativ gelassen, aber was er auf den Tod nicht ausstehen konnte, war herumgeschubst zu werden. Auch wenn es nie wirklich zur Sprache gekommen war, vermutete Carmen, dass das der wunde Punkt von Henri war und er es deswegen nicht viel weiter auf der Karriereleiter geschafft hatte. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie er als junger Spund irgendeinem hohen Tier richtig die Meinung gegeigt hatte, nachdem dieser ihn zum Kaffee holen schicken wollte. Bei dem Gedanken musste sie grinsen.
»Du findest das wohl witzig, was?«, knurrte Henri.
»Ich kenne solche Typen. Die saugen dich aus und wenn es hart auf hart kommt, werfen sie dich den Hunden zum Fraß vor.«
»Jetzt komm mal wieder runter, Henri«, erwiderte Carmen. Sie verdammte sich für das Grinsen. »Er war wirklich nicht besonders nett, aber warte erst mal ab, was sich da entwickelt.«
In der Tat war Carmen ebenfalls nicht sonderlich entzückt von Noah gewesen, aber viel mehr als der Zorn über sein Auftreten bewegte sie der Fall. Es war offensichtlich gewesen, dass Noah sehr viel mehr wusste, als er gesagt hatte. Eigentlich hat er gar nichts gesagt, dachte Carmen und nahm sich vor, sofort nachdem sie ausgeschlafen hatte, mehr über Noah und diese Spezialeinheit 3 des Innenministeriums herauszufinden.
»Ich werde gar nichts abwarten«, sagte Henri und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wir haben alles gemacht, was uns gesagt worden ist, und haben den Mann so gut es ging unterstützt, aber jetzt sind wir raus aus dem Fall. Du hast doch gehört, was der Kerl gesagt hat: ‚Vielen Dank für die Zusammenarbeit, aber ab hier übernehmen jetzt die großen Jungs‘. Das ist doch lächerlich. Soll er doch machen, was er will; ist mir egal.« Carmen wollte sich nicht damit zufrieden geben.
Sie wusste, dass Henri eigentlich Recht hatte und wahrscheinlich würde sie sich ein Menge Ärger einhandeln – was nicht das erste Mal gewesen wäre. Aber sie bekam Boris Nowak einfach nicht aus dem Kopf. So etwas hatte sie noch nicht gesehen und es hatte sie etwas gepackt, das Henri schon lange verloren hatte: beruflicher Ehrgeiz.
Als Carmen weiterfuhr, ging sie nochmals alle Bilder in Gedanken durch ebenso wie die wenigen Zeugenaussagen, die ihre Kollegen aufgenommen hatten. Wie lange genau Boris schon tot in seiner Wohnung gelegen hatte, wusste niemand. Der Arzt, der schlussendlich den Tod festgestellt hatte, war in dieser Hinsicht äußert vage gewesen. Jedenfalls hatte es nicht den Anschein gehabt, als ob den Toten irgendjemand vermissen würde.
»Das ist doch traurig, oder?«, meinte sie schließlich und erntete einen überraschten Blick von Henri.
»Was meinst du?«
»Na ja, Boris Nowak. Der lag schon mindestens zwei Tage in der Wohnung, bevor jemand aufmerksam wurde.«
»Ja«, antwortete Henri, »das gibt es leider immer wieder. Eine beschissene Welt.«
»Wie hieß noch mal die Frau, die angerufen hat?«
Henri schaute zu Carmen, die seinen Blick zuerst gar nicht bemerkte. Nach einer Weile, da sie keine Antwort bekam und sich deshalb kurz nach rechts drehte, sah sie in das Gesicht ihres Partners, der von ihrer Neugier wenig begeistert zu sein schien.
»Was ist los?« fragte Carmen.
»Du weißt ganz genau, was los ist«, sagte er. »Ich kenn› dich inzwischen lange genug, um zu wissen, wann dich etwas beschäftigt.«
»Ich versuche doch nur zu verstehen, was da passiert ist.«
»Genau wie letztes Jahr«, konterte Henri, »als du dich in den Mord dieser Prostituierten hineingesteigert hast.«
»Sie hatte auch einen Namen«, sagte Carmen.
»Natalie.«
»Ja.Und was hat es dir gebracht? Ein Disziplinarverfahren und ein Monat Suspendierung.«
»Das war was anderes.«
»War es nicht und das weißt du«, sagte Henri. »Du weißt einfach nicht, wann es gut ist. Immer noch eine Stufe weiter, bis du Leuten auf die Füße trittst, denen du besser aus dem Weg gehen solltest, wenn du ihnen schon nicht in den Hintern kriechen kannst.«
»Als ob du das könntest.«
»Nein, kann ich nicht, aber das ist auch der …«, begann Henri, brach dann aber mitten im Satz ab und machte eine abwehrende Handbewegung. »Ist aber auch egal. Was kümmert es mich, wenn du dich in die Scheiße reitest.«
Er begann damit, in seinen Aufzeichnungen – einem kleinen Schreibblock – nach den Informationen zu suchen, die er von der Zentrale bekommen hatte.
Dir ist es nicht egal, dachte Carmen und erinnerte sich an die zahllosen Momente, in denen Henri ihr zur Seite gestanden hatte. Egal ob es gegenüber ihrem Chef war oder vor dem Ausschuss der internen Ermittlung. Sie vermutete, dass es eher Resignation war, denn Henri wusste, dass er sie ohnehin nicht würde aufhalten können, sollte sie tiefer graben wollen.
»Wie sieht’s aus?«, fragte Noah und stand gemeinsam mit Dr. Singh vor dem fachmännisch sezierten Boris
Nowak. »Versüßen Sie mir den Tag!«
Dr. Singh – ein Inder mittleren Alters, der vor allem durch seinen orangenen Turban auffiel – war bei seinen Kollegen nicht gerade für seinen feinen Sinn für Humor bekannt und so dauerte es einige Sekunden, bevor er die Anmerkung Noahs richtig einordnen konnte.
»Der Mann ist vor etwa 72 Stunden gestorben und auch wenn es auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheint, war die Todesursache nicht die Öffnung der Bauchdecke und des Brustkorbs.«
»Nein?«
»Er ist vergiftet worden«, sagte Dr. Singh, dem es zunehmend schwerer fiel, die merkwürdige Art von Noah zu ignorieren. Er hatte das Gefühl, unabhängig von dem, was er sagte, von seinem Gegenüber nicht ernst genommen zu werden. Da seinem etwas zu spärlich ausgestatteten Sinn für Humor jedoch ein enormes Potenzial an Geduld und Gelassenheit gegenüberstand, konnte er dies weitaus länger aushalten als die meisten seiner Kollegen.
»Und bevor Sie fragen«, fuhr Dr. Singh fort, »nein, ich kann Ihnen noch nicht sagen, um welches Gift es sich gehandelt hat. Ich gehe jedoch davon aus, dass ich das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung spätestens morgen im Laufe des Tages erhalte.«
»Sie haben wohl an alles gedacht.«
»Ich gebe mir Mühe, meine Arbeit sorgfältig auszuführen«, erwiderte Dr. Singh, der ebenfalls nicht als Spürhund in Sachen Sarkasmus galt.
»Aber sagen Sie mir eins, Gandhi«, begann Noah und klopfte Dr. Singh auf die Schulter, »selbst wenn das Gift nicht gewesen wäre, hätte er wohl das Verschwinden seiner Organe kaum überlebt, oder?«
»Schwerlich.«
»Und das Gift hat doch auch sicherlich nicht dafür gesorgt, dass diese sich in Luft aufgelöst haben?«
»Davon ist nicht auszugehen.«
»Dann würde ich doch vorschlagen, dass Sie mir – anstatt mich stundenlang mit sinnlosem Zeug zuzuquatschen – erzählen, wo Teile seines Brustkorbs und seine verdammten Gedärme hin sind.«
»Ich kann das nicht mit Gewissheit sagen, es stehen auch noch einige Gewebeproben an«, sagte Dr. Singh, »aber ich habe eine Theorie.«
»Da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen.«
»Sehe Sie die Hautfetzen an der Wunde?«, fragte Dr. Singh und deutete mit seinem Zeigefinger den verschmorten Wundrand entlang.
»Ja«, sagte Noah, »sieht ziemlich verbrannt aus.«
»Das ist richtig«, sagte Dr. Singh und hielt nun seinen Zeigefinger nach oben, als hätte er just in diesem Moment eine Erleuchtung erfahren. »Das wirklich Bemerkenswerte ist aber die Richtung, in die sie zeigen.«
»Was für ein Kokolores …«, begann Noah, aber noch während er sich die Wunde genauer anschaute, blieben ihm die nachfolgenden Worte im Halse stecken. »Die zeigen ja nach außen.«
»Was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass diese Wunde von innen heraus verursacht wurde«, erklärte Dr. Singh, der sich nun ob der Verblüffung Noahs ein zaghaftes Grinsen nicht verkneifen konnte.
Noah stützte sich mit einer Hand am Untersuchungstisch ab, während er sich mit der anderen durch die Haare fuhr. Er ignorierte dabei das Ziepen und Reißen, das vor allem dadurch verursacht wurde, dass er sich seit drei Tagen nicht mehr gewaschen hatte. Es war nicht so, dass er sich sicher war, von nichts mehr überrascht werden zu können. Doch zumindest in diesem Fall war er sich recht sicher gewesen, bereits auf der richtigen Fährte zu sein. Jetzt wurde alles auf den Kopf gestellt.
»Darüber sind Sie offensichtlich sehr erstaunt«, stellte Dr. Singh fest. »Nun, wer wäre das nicht.«
Du hast ja keine Ahnung, dachte Noah und wünschte sich, dem Turban-Mann ein bisschen was von dem zu erzählen, was ihn in den letzten Jahren in Erstaunen versetzt hatte. Aber für eine derartige Dummheit war er bei Weitem noch nicht betrunken genug. Es war früher Nachmittag und er hatte erst drei Whiskys intus. Eine geradezu lächerliche Menge, die er nicht mal mehr im Ansatz spürte.
»So etwas ist in der Natur durchaus nicht unüblich«, monologisierte Dr. Singh. »Ein Leben ohne Parasiten ist
eigentlich kaum vorstellbar. Ein gutes Beispiel wäre die Schlupfwespe, die ihre Eier in Schmetterlingskokons ablegt. Ich meine, das hier war natürlich keine Schlupfwespe, und von einem Endoparasiten in dieser Größe habe ich auch noch nie gehört, aber …«
»Jetzt halten Sie mal die Luft an, Doc«, unterbrach Noah Dr. Singh. »Haben Sie noch was Konkretes für mich?«
»Meine Untersuchung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und ich muss noch auf die Ergebnisse aus dem Labor warten«, antwortete Dr. Singh und schüttelte den Kopf.
»Dann lassen Sie sich nicht aufhalten«, sagte Noah, reichte Dr. Singh seine Visitenkarte und verließ mit dem Kommentar den Raum, dass dieser sich melden solle, wenn es etwas Neues gäbe.