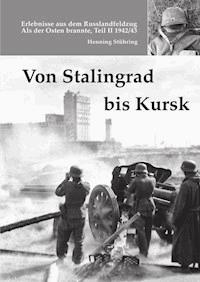
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stalingrad und Kursk – zwei der großen und blutigen Wegmarken für Wehrmacht und Rote Armee in den Jahren 1942/43. Sie symbolisieren die endgültige Wende an der Ostfront, des Zweiten Weltkriegs überhaupt. Bekannte Schlachtstätten, die aber immer noch manch Unbekannte offen gehalten haben, im Großen wie im Kleinen: Welche Optionen, Alternativen boten sich Hitler in den Jahren 1942/42 überhaupt noch? Wie war es tatsächlich bestellt um die vermeintliche Unterlegenheit der Wehrmacht in den berüchtigten Häuserkämpfen um Stalingrad, und wie hoch waren ihre Verluste in der Offensivphase wirklich? Und vor allem: Wie erlebten die Frontsoldaten das fürchterliche Gemetzel an der Wolga und die gewaltige Panzerschlacht bei Kursk? Intensiv beleuchtet werden allerdings nicht nur diese beiden alles überragenden Schlachtfelder an der Ostfront, sondern auch die weniger bekannten und oft stiefmütterlich behandelten Nebenkriegsschauplätze von Orel über Rschew bis hin zu Leningrad. Dort spielten sich im Windschatten der Stalingrader Front zahlreiche Dramen ab, die an Material- und Menscheneinsatz gleichfalls zu grauenhaften Schädelstätten für beide Seiten geworden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ostfront 1942/43
Erlebnisse aus dem Russlandfeldzug
Von Stalingrad bis Kursk
Impressum
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
Copyright: © 2014 Henning Stühring
ISBN 978-3-8442-8271-9
Cover: Bundesarchiv, Bild 101I-218-0529-07
Kartenskizzen: Dieter Weyand
Grafik & Gestaltung: Henning Stühring
Inhalt
Vorwort
I. Vorgeschichte
Frühjahr 1942
Weichenstellungen
II. Ouvertüren im Süden
08.05.1942-03.07.1942
Kertsch, Sewastopol, Charkow
III. Blutige Nebenfronten
06.05.1942-23.11.1942
Brennpunkte bei den Heeresgruppen Nord und Mitte
IV. „Fall Blau“
28.06.1942-25.07.1942
Vom Donez zum Don
V. Das Kaukasus-Abenteuer
26.07.1942-27.12.1942
Im Schatten des Elbrus
VI. Rattenkrieg an der Wolga
26.07.1942-18.11.1942
Angriff auf Stalingrad
VII. Operation „Uranus“
19.11.1942-02.02.1943
Die 6. Armee im Kessel
VIII. Schlagen aus der Nachhand
28.12.1942-18.03.1943
Mansteins große Stunde
IX. Abwehrschlachten im Norden
24.11.1942-04.07.1943
Von Rshew bis Leningrad
X. Die Kursker Schlacht
05.07.1943-18.07.1943
Operation „Zitadelle“
Nachwort
Anhang: Informationen/Hintergrund
Quellen, Literatur, Fotonachweis
Nach der Schlammperiode zeichnen sich noch die tiefen Einbrüche durch die Winteroffensive der Roten Armee ab. Fieberhaft versucht die Wehrmacht bis in den Sommer 1942 hinein, die daraus resultierenden Beulen und Einbuchtungen zu begradigen. Vor allem die Heeresgruppe Süd muss die Lage auf der Krim und den russischen Frontvorsprung bei Isjum bereinigen, bevor „Fall Blau“ (Ausschnitt Karte r.o.), die große deutsche Sommeroffensive zu den Ölquellen des Kaukaus, beginnen kann.
Vorwort
„Unter der großen Birke, da liegt er.“
Ein älterer Herr weist den Weg. Zu einer bestimmten Grabstelle auf dem Dorfmarker Friedhof in der Lüneburger Heide. Es ist ein drückend heißer Mittwochabend, dieser 14. Juli 2010 – der französische Nationalfeiertag. Noch ein paar Schritte, eine letzte Wegkreuzung. Und tatsächlich, da liegt er. Unter einer schweren Steinplatte. Er, der Generalfeldmarschall Erich von Lewinski, genannt von Manstein. Neben ihm ist seine Frau Jutta Sybille gebettet, und an der Ecke der Grabstelle steht noch ein schlichtes Holzkreuz. Für den Sohn Gero Erich Sylvester. Dessen Gebeine liegen allerdings in Russland begraben. Am Südufer des Ilmen-Sees. Gefallen am 29. Oktober 1942 im Nordabschnitt der Ostfront durch die Explosion einer Fliegerbombe. Als Leutnant, im Alter von 19 Jahren. Sein Vater, der berühmte Stratege der Wehrmacht und „gefährlichste Gegner der Alliierten“, durfte 85 werden.
Die Schatten werden länger. Es ist ein ausgesprochen ruhiger Abend. Eine geradezu friedliche Stimmung. Als stünde die Zeit still. Der passende Augenblick, sich auf die kleine Bank unter der mächtigen Birke zu setzen, eine Zigarre anzuzünden und in Gedanken zu versinken. Grübeln über ihn, den Generalfeldmarschall. Ironie der stillen Begegnung: Ausgerechnet heute feiern die Menschen in Frankreich ihren Nationalfeiertag! Laut und freudig. Vor 70 Jahren, im Mai 1940, versetzte die atemberaubend erfolgreiche Ausführung von Mansteins genialem „Sichelschnitt“-Plan, der die Grundlage zum phänomenalen Blitzsieg im Westen bildete, Frankreich plus die halbe Welt in Angst und Schrecken. Stalin soll laut Chruschtschow angesichts der unerhörten Niederlage der vermeintlich stärksten Landstreitmacht der Erde verzweifelt ausgerufen haben, dass Hitler nun auch die Sowjets „fertigmachen“ werde.
Ja, Mansteins Feinde verloren ob seiner brillanten Operationsideen schon mal die Fassung. Schlachten lenken, sich in den Gegner denken, konnte er wie kein Zweiter. Zwar wurde der vornehme Preuße bisweilen von Hitler als „Pinkelstratege“ verspottet. Aber ebenso bemerkte der Führer gegenüber Generaloberst Guderian, Manstein sei „vielleicht der beste Kopf, den der Generalstab hervorgebracht hat“. Davon konnte neben anderen auch der legendäre Marschall Schukow ein Klagelied singen. Noch im Frühjahr 1944 wurde der „Held der Sowjetunion“ von Manstein regelrecht vorgeführt, als ihm dieser in überragender Feldherrnkunst die schon sicher geglaubte Beute, die eingekesselte 1. Panzerarmee, entwand. Es sollte allerdings die letzte Großtat des blonden Strategen im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Hitler verabschiedete seinen fähigsten Feldmarschall am 30. März, da „im Osten die Zeit der Operationen größeren Stiles [...] abgeschlossen“ sei. Damit war Mansteins glänzende Karriere abrupt beendet. Geblieben sind viele Fragen. Bis heute. Zwar kann es keine Zweifel am operativen Genie Mansteins geben, aber dafür umso mehr an seiner Einstellung gegenüber dem NS-Regime und seiner charakterlichen Veranlagung. Der zweifellos überaus ehrgeizige Stratege, der 1942 für die sehr blutige Eroberung der Seefestung Sewastopol auf der Krim den Marschallstab erhielt, sah sich selbst als unpolitischen Soldaten; bezeichnend sein Ausspruch:
„Preußische Feldmarschälle meutern nicht!“
Untergebene wiederum nahmen Manstein gelegentlich als gefühlskalt wahr. Wer aber war dieser im persönlichen Umgang gewiss nicht einfache Mann, der zur zentralen Figur unter den deutschen Heerführern in einer schicksalhaften Kriegsphase, nämlich zwischen den historischen Wegmarken Stalingrad und Kursk, avancierte und ein atemberaubendes Kapitel an der Ostfront entscheidend mitschrieb?
Manstein ist tatsächlich Zeit seines Lebens vor allem Soldat gewesen. Wie ein roter Faden zieht sich das Militärische durch sein gesamtes Dasein – vom jugendlichen Kadetten über den Frontkämpfer im Ersten und Heerführer im Zweiten Weltkrieg bis hin zum Bundeswehr-Berater im Kalten Krieg. Das Soldatentum legte man dem Sprössling einer preußischen Offiziersfamilie quasi in die Wiege, und als Soldat ist er schließlich von der Bundeswehr ehrenhaft zu Grabe getragen worden.
Man wird Manstein und auch anderen Feldherrn seiner Generation nicht gerecht, indem fortlaufend der Grad seiner Zustimmung zum Nationalsozialismus oder Antisemitismus gemessen wird. Ob unter Kaiser, Führer oder Kanzler – dieser Mann wollte vor allem eines: Operationen auf dem Schlachtfeld lenken! Er war geschmeidig genug, seine überragenden Fähigkeiten den verschiedenen Systemen anzudienen. Solange er nur planen und operieren durfte. Dass er dabei auch kalt bis rücksichtslos wirkte beziehungsweise handelte, liegt in der Natur von militärischen Angelegenheiten. Unter Mansteins Führung starben gewiss Zigtausende Menschen. Soldaten wie Zivilisten. Man muss aber seine Biografie kennen, um die kriegerische Mentalität erfassen zu können. Was der eigenen Karriere nützte, goutierte Manstein. Einerseits. Andererseits denkt ein reinrassiger Soldat in anderen Kategorien als ein friedliebender Zivilist. Manstein hat als junger Oberleutnant im Ersten Weltkrieg für sein Vaterland geblutet und eine schwere Schussverletzung nur dank der Hilfe seiner Kameraden überlebt. Und er beerdigte seinen Sohn Gero an der Ostfront. Ein solcher Mann weiß, dass Leben und Sterben auf dem Schlachtfeld oft nur einen Schritt voneinander entfernt liegen. Er akzeptiert das Gesetz des Krieges. Es gehört einfach zum Soldatensein. Was der Feldmarschall von Manstein seinen Landsern befahl, hat er selbst an Leib und Seele erfahren. Daraus zog er wohl auch die Berechtigung, buchstäblich alles von den Untergebenen fordern zu dürfen. Nicht wenige Feldherren verschließen sich gegenüber sentimentalen Kategorien wie Mitleid – erst recht gegenüber dem Feind, Zivilisten eingenommen. Andernfalls zerbricht der militärische Führer an seiner Aufgabe, zumal einer solch übermenschlichen, wie sie zweifellos das Kommando über eine Heeresgruppe im Kriege darstellt. Besser man legt das Menschsein ab und sieht die Dinge rein vom militärischen Standpunkt her.
Dazu gehört, potentiellen Unruhen im Operationsgebiet vorzubeugen. Also lässt man die Einsatzgruppen der SS nicht nur gewähren, sondern unterstützt sie auch noch. Oder die Bekämpfung der Partisanenbewegung mit brutalen Repressalien. So geschehen 1941/42 im Herrschaftsbereich seiner 11. Armee. Man darf Manstein sicher nicht gleichsetzen mit einem Reichenau. Jener berüchtigte Nazi-General, der als leidenschaftlicher Juden- und Russenfresser galt. Mansteins Verhältnis zu Hitler war durchaus ambivalent. Der eher feine preußische Pinkelstratege und der öfter grobe ostmärkische Gefreite wurden nie richtig warm miteinander. Aber der eine brauchte eben den anderen, und beide wussten es. Ohne Hitler, der Aufrüstung und Krieg verhieß, konnte Manstein sein operatives Genie nicht endlich auch auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen. Und der im Anfangsstadium des Völkerringens in militärischen Fragen noch unsichere Führer war zunächst auf seinen besten Kopf angewiesen, vor allem um Frankreich vernichtend schlagen zu können. Wer weiß, welchen Lauf die Geschichte genommen hätte, wenn nicht Halder, sondern Manstein zum Generalstabschef des Heeres ernannt worden wäre. Das erschien damals durchaus eine reelle Option. Seinerzeit fungierte Manstein als Oberquartiermeister I im Generalstab des Heeres. Er galt in dieser Schlüsselposition als ein potentieller Nachfolger von Generalstabschef Beck, den Hitler 1938 aus dem militärischen Spitzenamt entfernte. Gesetzt diesen Fall: Wären die deutschen Panzer im Westfeldzug 1940 kurz vor Dünkirchen ebenfalls angehalten worden oder hätten sie das britische Expeditionskorps von diesem letzten Hafen für eine Evakuierung abgeschnitten und den Westalliierten damit die totale Niederlage bereitet? Vielleicht würde ein von Manstein, der Schöpfer des „Sichelschnitts“, bei Hitler mehr Gehör gefunden haben als eben Halder, der lange Zeit gegen den Plan intrigierte. Aber auf Dauer hätte Hitler wahrscheinlich den Preußen mit der Hakennase noch weniger ertragen als den Bayern mit dem Bürstenschnitt. Gut möglich, dass Mansteins größter Triumph zugleich auch sein letzter als OKH-Chef gewesen wäre. Aber immerhin hätte die Wehrmacht dann mit aller Macht die Rote Armee laut Stalin „fertigmachen“ können, statt den doppelt riskanten Zweifrontenkrieg, wie er 1941 ausbrach, wagen zu müssen. Zugegeben: Alles reine Hypothese im Großreich der Spekulation, wenngleich auch eine höchst interessante. Sicher dürfte allerdings sein, dass es viele Feldherrn – ob nun ein Patton, Montgomery, Schukow oder Manstein – mit dem Wort Wellingtons hielten: „Das Zweitschlimmste nach einer verlorenen Schlacht ist eine gewonnene Schlacht.“
Denn in beiden Fällen ist der Krieg, „die schönste Zeit“1für die Herren Generale, vorbei; der populäre US-Panzergeneral Patton schrieb während der Schlacht um die Normandie in sein Tagebuch: „Das zivile Leben wird stinklangweilig werden. Keine jubelnden Menschen, keine Blumen und keine Privatflugzeuge mehr. Ich bin überzeugt, das beste Ende für einen Offizier ist die letzte Kugel des Krieges.“
Dafür mag man sie verfluchen, die großen Marschälle, weil andere für ihren Lorbeer verbluteten. Man selbst kann es im Angesicht von Mansteins letzter Ruhestätte nicht. Trotz allem, was geschehen. Dazu muss man freilich bereit sein, die Menschen und die Zeit, in der sie lebten, emotional zu verstehen, statt sie allein aus nachträglicher Sicht „politically correct“ analysieren zu wollen. Man wird das Gefühl nicht los, dass gewisse der heutigen moralisierenden TV-Professoren damals wohl eher nicht nicht zu Bombenlegern, sondern „Hitlers Helfern“, Eliten des Dritten Reichs, getaugt hätten. Jedenfalls wird oft nur dieser zweite Schritt gesetzt. Wer sich aber die Mühe macht, die damalige Zeit unvoreingenommen zu betrachten, bleibt früher oder später an der unbequemen Frage hängen: Wie hätte man selbst als Angehöriger der Kriegsgeneration gehandelt? Zum lebensgefährlichen Widerstand in Diktaturen taugt bekanntlich nur eine mutige Minderheit. Das möge sich unsere Friedensgeneration vielleicht zuerst oder überhaupt mal fragen. Denn es waren jene, aus deren Blut und Fleisch wir entsprungen sind, nämlich unsere Väter und Großväter, Mütter und Großmütter; jene, an deren Gräbern wir trauern statt sie zu verfluchen, obwohl die meisten damals mitmachten. Wer von uns hätte die Hakenkreuzfahne verbrannt und nicht geschwenkt? Wäre man selbst damals wirklich klüger, mutiger gewesen?
Die Zigarre erlischt. In Frankreich wird weiter gefeiert. Aus Erbfeinden sind Partner, Motoren, Hauptantriebskräfte des europäischen Einigungsprozesses geworden. Der Sichelschnitt ist Geschichte, Manstein Legende lebendig. So wird er es wohl gewollt haben, auch wenn der viele Lorbeer auf ewig schmutzig blutbefleckt bleibt.
Fotos: Henning Stühring
Die Grabstelle der Familie Manstein auf dem Friedhof in Dorfmark. Das kleine Foto oben rechts zeigt das Kreuz des Sohnes Gero, der in Russland durch eine Fliegerbombe tödlich verwundet wurde. Seine Gebeine liegen bei Redja am Südufer des Ilmensees. Das Grabkreuz des Leutnants ist dem damaligen Original in Russland detailgetreu nachgebildet.
I. Vorgeschichte
Frühjahr 1942
„Wir wollen hoffen, dass es dieses Jahr zu Ende geht.
Ich glaube nicht daran.“2
Aus dem Brief eines Landsers der 211. Infanteriedivision, die im Verband der 2. Panzerarmee nordöstlich von Orel kämpft.
+++
„Wenn ich das Öl von Maikop und Grozny nicht bekomme, dann muß ich diesen Krieg liquidieren.“
Ausspruch Hitlers vor den versammelten Spitzenmillitärs der Heersgruppe Süd in Poltawa/Ukraine am 1. Juni 1942.
*
Prolog
Im Frühjahr 1942 bietet das gewaltige Geschehen an der Ostfront für den neutralen Beobachter ein undurchsichtiges Bild. Einerseits ist es der Wehrmacht gelungen, große Gebiete der Sowjetunion zu erobern. Andererseits sind die entscheidenden operativen Ziele, nämlich Leningrad und Moskau, sowie folglich auch das strategische Ziel Hitlers, „Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen“, verpasst worden. Die Rote Armee wiederum hat den ersten und gefährlichsten Ansturm der Wehrmacht pariert. Allerdings um den Preis ungeheurer Opfer. Zwar konnte die Winteroffensive die akute Bedrohung der russischen Hauptstadt beseitigen. Aber die angestrebte Vernichtung der Heeresgruppe Mitte ist nicht gelungen. Im Prinzip herrscht eine klassische Patt-Situation. Aber im unerbittlichen Kampf der Weltanschauungen bleibt kein Raum für einen Verhandlungsfrieden. Damit zeichnet sich für beide Seiten ab, dass der Kampf der Titanen noch lange dauern wird. Generalstabschef Franz Halder hat recht, wenn er vorausschauend für das Jahr 1942 notiert: „Krieg wird im Osten entschieden.“
Aber wo genau soll, kann auf deutscher Seite überhaupt noch einmal der Hebel für eine strategische Offensive angesetzt werden? Nach dem großen Aderlass des Winters kommt ein Generalangriff an der gesamten Ostfront nicht mehr in Frage. Die Kräfte reichen nur für eine Teiloffensive an einem Frontabschnitt. Nach dem Debakel vor Moskau schwebt Hitler diesmal der entscheidende Stoß im Süden der Sowjetunion vor, um endlich konsequent „seine“ kriegswirtschaftlichen Ziele zu verfolgen. Der Führer begehrt vor allem die Ölquellen des Kaukasus. Sie sollen die Autarkie des Reiches auf dem europäischen Kontinent langfristig sichern und der Sowjetunion kurzfristig entzogen werden. Und entgegen der Legendenbildung nach dem Krieg besteht auch in maßgeblichen Kreisen der hohen Generalität durchaus Einvernehmen über den Schwerpunkt bei der Heeresgruppe Süd. Halder bezeichnet das geplante Kaukasus-Unternehmen als „eine zwingende Notwendigkeit“. Die Region habe „etwa die gleiche Bedeutung wie die Provinz Schlesien für Preußen“.3
Auf der anderen Seite braucht die Rote Armee, die im Winter gegenüber der schlechter ausgerüsteten Wehrmacht dominieren konnte, eine Atempause, um neue Kräfte zu mobilisieren. Man ist sich im sowjetischen Oberkommando STAWKA der Tatsache bewusst, dass das russische Volk weiterhin die Hauptlast der Anti-Hitler-Koalition in den nächsten Monaten tragen muss. Zwar drängt Stalin unentwegt auf die Eröffnung einer zweiten Front in Westeuropa, aber Churchill sieht seine Streitkräfte noch nicht reif für eine große Invasion. Völlig zu Recht übrigens, wie die Ereignisse noch zeigen sollen ...
*
Zu den schweren Hypotheken des Winters auf deutscher Seite zählen die vielen Fronteinbuchtungen, die alsbald begradigt werden müssen. Dazu kommen Gesamtverluste in Höhe von 1,1 Millionen Mann vom 22. Juni 1941 bis Ende März 1942; davon allein 33.000 Offiziere (117 pro Tag!). Ein unersetzlicher Aderlass, der merklich an der Substanz der Truppe zehrt. Generalstabschef Halder konstertierte angesichts der gewaltigen Verluste bereits am 23. November 1941, dass „ein Heer, wie das bis Juni 1941 [...] uns künftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird“. Das Oberkommando des Heeres (OKH) meldet bis zum 1. Mai 625.000 Fehlstellen im Ostheer. Den gut 2,5 Millionen Landsern plus 950.000 verbündeten Soldaten stehen 5,4 Millionen Rotarmisten mit 3.900 Panzern, 45.000 Geschützen und 2.200 Flugzeugen gegenüber. Auf deutscher Seite wiegen zudem die materiellen Einbußen besonders schwer. Bis Ende März wird ein Fehlbestand von 2.097 Panzern gemeldet. In den Panzerdivisionen sind zu diesem Zeitpunkt noch neun bis 15 Kampfwagen, entlang der gesamten Ostfront 140 (!) Panzer und weniger als 1.000 Flugzeuge einsatzbereit. Anfang Februar heißt es in einem Bericht der 2. Armee an die vorgesetzte Heeresgruppe Süd: „Die Armee ist also für einen Bewegungskrieg nicht einsatzfähig.“
Feldmarschall von Bock sieht den Bericht beispielhaft auch für die anderen Armeen seiner Heeresgruppe und gibt ihn an das OKH weiter. Kein Zweifel, die Verbände müssen erst einmal aufgefrischt werden. Mit größter Anstrengung gelingt es in den nächsten Wochen, die für die Großoffensive vorgesehene Heeresgruppe Süd – zeitlich gestaffelt – aufzufüllen. Die Heeresgruppen Nord und Mitte müssen dagegen ein Fehl von 4.800 bis 6.900 Mann je Division hinnehmen. In der Folge sinkt die Zahl der Bataillone in den Infanteriedivisionen von neun auf sechs. Geschwächt wird auch die Artillerie. Fortan stehen nur noch drei Geschütze pro Batterie (von ehemals vier bis sechs) zur Verfügung. In den Panzerdivisionen, die 1941 mit drei Abteilungen dotiert gewesen sind, ist nur noch eine Abteilung einsatzbereit.
Zudem geht der Personalersatz für die Front auf Kosten der Wirtschaft, die entsprechende Freistellungen in den Betrieben vornehmen muss. Nicht zuletzt leidet die Ausbildung der Rekruten unter den beschleunigten Truppenaushebungen. Einen Rückgriff auf weibliche Arbeitskräfte lehnt Hitler aus politischen Gründen ab. Ganz im Gegensatz zu Stalin, der längst den Masseneinsatz von Frauen an der Rüstungsfront propagiert und praktiziert. Den totalen Kriegseinsatz wagt nur der rote Diktator, während der deutsche noch die negativen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg vor Augen hat und Unruhen durch zu große Belastungen in der Heimat fürchtet. Rückblickend darf man wohl behaupten: Während der Führer auf vielen anderen Gebieten den höchsten Einsatz wagte, unterschätzte er hier wohl die Opferbereitschaft der deutschen Volksgemeinschaft. Einen Vorgriff auf die Zukunft macht Hitler allerdings, indem er den kompletten Jahrgang 1922 einziehen lässt. Nachteilig macht sich auf deutscher Seite weiterhin der permanente Nachschubmangel bemerkbar. Darüber zeigt sich auch der Führer verärgert, als er zürnt:
„Damit kann ich mich nicht abfinden. Es gibt Probleme, die unbedingt gelöst werden müssen. Wo richtige Führer vorhanden sind, sind sie immer gelöst worden und werden auch immer gelöst werden.“
Nicht zuletzt deshalb wird Albert Speer am 8. Februar 1942 als Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt. Der in vielerlei Hinsicht begabte wie geschmeidige Architekt und Günstling Hitlers nimmt sich unter anderem der Logistik – und hier speziell der Steigerung der Transportkapazitäten – an, und zwar erfolgreich.
An der Ostfront flaut indes die Gefechtstätigkeit im Laufe des Frühjahrs spürbar ab. Dennoch fordert der Krieg seinen Tribut; es fließt auch im April noch Blut genug. Rund 23.000 Tote kostet der vergleichsweise ruhige Monat den ausgepowerten deutschen Verbänden. Derweil nutzen beide Parteien die mehr oder minder ausgeprägte Kampfpause, um sich für die nächsten großen Waffengänge zu rüsten und entsprechende Aufmarschanweisungen für die warme Jahreszeit auszuarbeiten.
*
Dem Beobachter stellt sich die Frage, ob es zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine echte Alternative gibt zu Hitlers Entschluss, in den Kaukasus zu marschieren. Warum wird nicht wieder der Kreml ins Visier genommen? Unstreitig ist zunächst einmal, dass dem Führer kaum eine andere Option bleibt, als sein Heil in der Offensive zu suchen. Für das Reich kommt 1942 alles darauf an, bis Jahresende eine Vorentscheidung im Osten herbeizuführen. Denn nach dieser Frist droht das strategisch wirksame Eingreifen der Westalliierten an einer der Landfronten. Dafür bieten sich Invasionen in Afrika, Norwegen oder Nordfrankreich an. Das „Aufklärungsunternehmen“ vom 19. August 1942 am Strand von Dieppe, wie es der Chef der Kombinierten Operationen im britischen Oberkommando, Admiral Lord Mountbatten, von vornherein verstanden wissen will, fällt gewiss nicht unter diese Kategorie.
Andererseits führt nicht zuletzt die vermeintlich akute Bedrohung der französischen Küsten zum Abzug verschiedener Divisionen von der Ostfront. Darunter so bewährte Verbände wie die 6., 7. und 10. Panzerdivision. Dafür ist Hitler viel kritisiert worden. Allerdings sind gerade die genannten Verbände im Frühjahr 1942 ausgebrannt und bedürfen dringend der Auffrischung, Erholung und Ruhe, die es im Osten kaum geben kann. Gerade das Prinzip der Rotation auf Seiten der Wehrmacht soll sich bewähren. Im Westen gelingt es am besten, den kampfunerfahrenen Ersatz mit den Ostfrontveteranen zu neuen schlagkräftigen Einheiten zu verschmelzen. In Russland wären dagegen die begehrten schnellen Divisionen von den Armeen als permanent greifbare Front-Feuerwehr vollends verheizt worden. Zum Beispiel, um die zahlreichen Fronteinbrüche bei der Heeresgruppe Mitte zu bereinigen.
Denn erst nach Beseitigung dieser Beulen aus der Winterschlacht kann Moskau ein verlockendes, buchstäblich nahe liegendes Operationsziel für Feldmarschall Kluges Streitmacht sein. Aber nur auf den ersten Blick. Denn vor der Hauptstadt konzentriert Stalin auch seine stärksten Kräfte. Dazu kommt das heikle Gelände. Wälder und Sümpfe würden Umgehungen großen Stils stark behindern. Ein Angriff in dieser Richtung müsste mehr oder minder frontal gegen die stark befestigten Verkehrsknotenpunkte geführt werden – wie es schon im Herbst des Vorjahres der Fall gewesen ist. Für den Angreifer ein schwerer Nachteil, für die Verteidiger ein glücklicher Umstand. Und in der Kunst der Geländeausnutzung, allen voran in der Defensive, gilt der Russe als Meister. Zumal die vergleichsweise günstigen Voraussetzungen von 1941 längst nicht mehr gegeben sind. Das sollen die begrenzten Angriffe der Heeresgruppe Mitte im Frühling und Sommer 1942 noch exemplarisch unter Beweis stellen. Statt blitzartiger Vorstöße entwickelt sich daraus vielerorts ein zähes, verlustreiches Durchfressen, bedingt durch das unübersichtliche Gelände und den hartnäckigen Feindwiderstand. Kein Zweifel, die Rote Armee gewinnt langsam, aber sicher an Kampfkraft, während die Leistungsfähigkeit der Wehrmacht ihren Höhepunkt bereits 1941 überschritten hat. Die 150 bis 200 Kilometer nach Moskau wären jedenfalls für die Heeresgruppe Mitte verdammt lang und blutig geworden! Will man wieder den Kreml ins Auge fassen, so bietet sich dafür schon eher ein tiefer Flankenstoß durch den Nordflügel der Heeresgruppe Süd an.
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Im Frühjahr 1942 spricht einiges dafür, den Hebel im Süden anzusetzen. Die Kräfte- und Geländekonstellation spielt dem Angreifer hier viel mehr Trümpfe in die Hand. Zumal die Heeresgruppe Süd in der Winterschlacht geringere Abgänge verzeichnet als ihre nördlichen Nachbarn, wie die Verluststatistiken von Dezember 1941 bis April 1942 zeigen:
Heeresgruppe Nord: 195.650 (Gefallene, Verwundete, Vermisste, Kranke)
Heeresgruppe Mitte: 483.100
Heeresgruppe Süd: 152.900
Dazu kommt das speziell für Panzer vorteilhafte Operationsgelände im Süden der Sowjetunion. Die ausgeprägten Steppengebiete begünstigen weiträumige Bewegungen motorisierter Großverbände ganz besonders. Und genau hierin liegt die unerreichte Stärke und Überlegenheit der Wehrmacht. Nicht zuletzt spielt die Dislozierung der russischen Kräfte den deutschen Absichten in die Hände …
Ihren Optimismus für die neue Großoffensive schöpfen Hitler und Halder aus der Hoffnung, dass die Sowjetunion an der Grenze ihrer militärischen und ökonomischen Leistungsfähigkeit angekommen sei. Eine grandiose Fehleinschätzung! Halders euphemistische Lagebeurteilung gipfelt bereits während der Winterschlacht in einer Aussage, die denn auch unverkennbare Züge von Zweckoptimismus trägt:
„Wir sind überlegen, der Russe macht es nur mit der Masse.“
Die sowjetischen Verbände „seien nicht mehr viel wert“, prognostiziert der OKH-Chef im Februar 1942.
Richtig daran ist, dass die quantitativ unterlegene Wehrmacht immer noch genug Kampfkraft besitzt, der zahlenmäßig überlegenen Roten Armee wuchtige Schläge zu versetzen, sofern Witterung und Gelände die Bewegungen der operativ entscheidenden Panzerkorps nicht nachhaltig einschränken. Andererseits ist die Masse natürlich auch ein strategischer Faktor ersten Ranges, der angesichts der gewaltigen Frontausdehnung in Russland auf Dauer zum Tragen kommen muss. Bei allen deutschen Qualitäten ist das Gesetz der Zahl natürlich auch Halder bewusst.
Tatsächlich muss man schon Optimist sein, um an eine erfolgreiche Umsetzung der Operationspläne im Süden zu glauben. Das Hauptziel, die Ölstadt Baku an der Küste des Kaspischen Meeres, liegt nicht weniger als 1.400 Kilometer Luftlinie von den Ausgangsstellungen entfernt. Zudem unterschätzen die deutschen Planer die wachsende Bedeutung der amerikanischen Hilfslieferungen im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes („Lend-Lease-Act“). Roosevelt lässt Stalin vor allem Öl und Nahrung zukommen. Der deutsche Generalstab dagegen behandelt wirtschaftliche Probleme stiefmütterlich, desgleichen die Feindaufklärung.
*
Und der große, unbekannte Gegner, wie schätzt er die deutschen Absichten ein? Am 28. März 1942 beschließt das Staatliche Verteidigungskomitee unter Vorsitz von Stalin grundsätzlich den Übergang zur strategischen Defensive. Ausgenommen von einigen Präventivschlägen, die der Diktator persönlich anregt. Zum Beispiel bei Charkow. Hier sieht der Amateur-Stratege im Angriff die beste Verteidigung. Er fürchtet, dass die Deutschen ihre geschwächten Verbände während des Frühlings ungestört auffrischen können. In der Folge rechnet Stalin mit feindlichen Großangriffen in zwei strategischen Richtungen: Den Hauptstoß auf Moskau plus eine Nebenoffensive im Süden, Richtung Kaukasus. Und wenn sich insbesondere die gefürchteten Panzerverbände der Wehrmacht erst reorganisiert haben, so sein Kalkül, treten sie 1942 aus der Tiefe des bereits 1941 gewonnenen und behaupteten sowjetischen Raumes an. Denn die Erfolge der russischen Winteroffensive können nicht die Tatsache überstrahlen, dass Moskau nicht allzu weit hinter der Front liegt. Die Spitzen der Heeresgruppe Mitte stehen kaum 200 Kilometer vom Kreml entfernt. Gefahr für Moskau kann indes ebenso vom Nordflügel der Heeresgruppe Süd drohen.
Stalin entscheidet sich de facto für die „aktive strategische Defensive“. Den Schwerpunkt seiner Kräfte belässt er konsequenterweise vor Moskau, wo freilich gar keine akute Gefährdung droht. Hier wirkt sich Hitlers viel kritisierter Haltebefehl im Hinblick auf die Verschleierung des deutschen Hauptangriffes im Süden positiv aus. Ein ganz entscheidender, verschiedentlich unterbewerteter Faktor, der zur strategischen Überraschung der Sowjets führen soll. Darauf muss ein an Zahl unterlegener Angreifer seine Hoffnungen bauen. Eine erneute Großoffensive der Heeresgruppe Mitte hätte dagegen einen wohl vorbereiteten Gegner gesehen und wäre vorwärts Moskau auf ungleich stärkere Gegenwehr gestoßen.
Ein Jahr später, im Rahmen der Operation „Zitadelle“, macht Hitler genau diesen Fehler, als er den Angriff ausgerechnet auf das stärkste Bollwerk der Roten Armee, den Kursker Frontbalkon, befiehlt. Nein, wenn der Führer 1942 sein Heil in der Offensive sucht, muss er den Hebel bei der Heeresgruppe Süd ansetzen. Aber bleibt hier wirklich nur der lange Marsch an die untere Wolga und in den Kaukasus? Bietet sich nicht viel eher die umgekehrte Richtung an, nämlich ein nördlich ausholender Schlag der Heeresgruppe Süd auf Moskau? Dafür scheint der Aufmarschraum Kursk prädestiniert, um nach erfolgtem Durchbruch in Anlehnung an den Don schließlich im Zusammenwirken mit dem Südflügel der Heeresgruppe Mitte, der Orel als Absprungbrett dienen kann, die Hauptstadtverteidigung aufzurollen. Doch genau diese südliche Flankierung Moskaus fürchtet, erwartet Stalin. Entsprechend starke Kräfte, darunter mehrere Panzerkorps, sind im Abschnitt der Brjansker Front disloziert. Auch in diesem Fall würde bald Schwerpunkt gegen Schwerpunkt stehen und den Angreifer ebenfalls in Ermangelung des Überraschungseffekts benachteiligen. Zumal der linke Flügel der Heeresgruppe Mitte aufgrund des ungünstigen Frontverlaufs und Kräftemangels als nördlicher Zangenarm ausfallen muss.
So viel zu den kursierenden Moskau-Spekulationen. Auf gesicherten Fundamenten steht dagegen eine ganz andere Erkenntnis: Das größte Plus der Sowjets und zugleich die böseste Überraschung für die Deutschen bilden die starken strategischen Reserven in Stärke von einem Dutzend Armeen, darunter zwei gepanzerte.
Ironie der Geschichte: An diesem schicksalhaften 28. März 1942, an dem Stalin großen Kriegsrat im Kreml hält, legen Hitler und Halder im rund 1.000 Kilometer entfernten ostpreußischen Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ die Grundzüge der Sommeroffensive fest. Aus dieser Besprechung resultiert die am 5. April diktierte Führerweisung Nr. 41, Deckname „Fall Blau“. Darin heißt es :
„Das Ziel ist es, die den Sowjets noch verbliebene lebendige Wehrkraft endgültig zu vernichten und ihnen die wichtigsten kriegswirtschaftlichen Kraftquellen so weit als möglich zu entziehen […]
Unter Festhalten an den ursprünglichen Grundsätzen des Ostfeldzuges kommt es darauf an, bei Verhalten der Heeresmitte [...] zunächst alle greifbaren Kräfte zu der Haupt-Operation im Süd-Abschnitt zu vereinigen, mit dem Ziel, den Feind vorwärts des Don zu vernichten, um sodann die Ölgebiete im kaukasischen Raum und den Übergang über den Kaukasus selbst zu gewinnen.“
Aus Mangel an deutschen Kräften verfügt Hitler die Flankensicherung durch ungarische, italienische und rumänische Verbände von zweifelhaftem Kampfwert. Weiter heißt es in der Weisung:
„Die nächsten Aufgaben sind es, auf der Krim die Halbinsel Kertsch zu säubern und Sewastopol zu Fall zu bringen.“
II. Ouvertüren im Süden
08.05.-03.07.1942
„Heute vor einem Jahr sind wir in Rußland hineingefahren. Ich kann Euch sagen, das war damals ein langer Tag. Um 9 Uhr fuhren wir über den Bug. Und jetzt sind wir nun schon 1 Jahr im Arbeiter-Paradies. Wer hatte das damals gedacht? Wie viele andere, hatte ich auf ca. 4 Wochen Krieg getippt. Und wie anders ist alles gekommen. Mit so einer militärischen Macht Rußland hatte keiner gerechnet. Ich glaube, wenn uns am 22.6. 41 jemand gesagt hätte: „Ihr seid in 1 Jahr noch in Rußland“, die hätten wir bestimmt für verrückt erklärt. Es ist nun einmal Wirklichkeit geworden. Wir stehen immer noch in Rußland. Und wer weiß, wie lange noch.“
Aus einem Feldpostbrief des Gefreiten Gustav Böker4, Angehöriger der Panzerjägerabteilung 111 der 111. Infanteriedivision, vom 22. Juni 1942, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion.
+++
„Diese Katastrophe, gemessen an ihrem ungünstigen Ergebnis, ist vergleichbar mit Rennenkampfs und Samsonows Katastrophe in Ostpreußen.“5
Stalin in einem Schreiben an die Südwestfront vom 26. Juni 1942. Den Hintergrund bildet der krachend gescheiterte Präventivschlag gegen die deutsche Heeresgruppe Süd.
+++
„Von der Härte des Kampfes zeugt das Schlachtfeld: An den Brennpunkten ist der Boden, soweit das Auge reicht, mit Kadavern von Menschen und Pferden so weit bedeckt, daß man nur mit Mühe eine Gasse für seinen PKW findet.“
Generaloberst Kleist am 29. Mai 1942 in Ergänzung zu einem Fernschreiben des III. Panzerkorps nach der Vernichtungsschlacht bei Charkow.
+++
„In einem Bunker, 2 km nordostwärts des »Stalin«, der sich zwei Tage hinter den deutschen Linien gehalten hatte, mußte die Besatzung buchstäblich einzeln erschlagen werden.“
Aus einem Gefechtsbericht des Infanterieregiments 47, das im Verband der 22. Division im Juni 1942 auf der Krim das Fort Stalin im Vorfeld der Seefestung Sewastopol stürmt.
*
Ausgangslage auf der Krim
Alea iacta est – die Würfel sind gefallen. Mit der Führerweisung Nr. 41 steht fest, dass die großen militärischen Entscheidungen an der russischen Südfront ausgefochten werden. Damit rückt zunächst ein Brennpunkt ins Blickfeld des Geschehens, an dem sich die Deutschen seit Monaten blutige Köpfe holen: die Krim. Die Festung Sewastopol an der Südwestspitze ist trotz Belagerung unbezwungen geblieben, die Halbinsel Kertsch im Osten gar von der Roten Armee Ende Dezember 1941 zurückerobert worden. Für die Sowjets manifestiert sich die geostrategische Bedeutung der Krim in dreierlei Hinsicht, nämlich als:
1. Stützpunkt der Schwarzmeerflotte;
2. Bedrohung der deutschen Südflanke;
3. „Flugzeugträger“ gegen die rumänischen Ölquellen.
Den Großteil des enormen Treibstoffbedarfs für seine Kriegsmaschine bezieht das Reich aus dem Fördergebiet im Raum Ploesti. Für die Wehrmacht bildet die Krim das natürliche Sprungbrett zum Kaukasus, nämlich über die Straße von Kertsch. Jene Meerenge, die an ihrer schmalsten Stelle nur vier Kilometer breit ist. Dort führt die Straße von Kertsch hinüber zur Taman-Halbinsel, ins Vorfeld des Kaukasus.
Die deutschen Streitkräfte auf der Krim führt Generaloberst von Manstein. Der geniale operative Kopf muss mit seiner 11. Armee eine harte Nuss knacken. Es gilt, einen im Verhältnis 3:1 überlegenen Gegner, noch dazu verschanzt in stärksten Befestigungen, aus dem Feld zu schlagen. Aufgrund seiner limitierten Kräfte bleibt Manstein von Anfang an nur die Möglichkeit, beide Ziele, die Eroberung von Kertsch und Sewastopol, nacheinander anzugehen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Um die Seefestung mit aller Macht angreifen zu können, muss zuerst Rückenfreiheit gewonnen werden. Vor allem aber ist Eile geboten. Die Operationen auf der Krim müssen zu einer Entscheidung gebracht sein, bevor die deutsche Südfront nördlich des Asowschen Meeres zum Hauptschlag ausholt. Nicht zuletzt deshalb, weil die 1942 bereits stark limitierten Kräfte der Luftwaffe nur ausreichen, um das Heer an einem Teilabschnitt der Heeresgruppe Süd wirksam zu unterstützen.
Aus dieser strategisch brenzligen Lage entwickelt Manstein seinen Schlachtplan. Den Auftakt soll die Operation „Trappenjagd“ bilden. Der Deckname bezeichnet den deutschen Angriffsplan zur Vernichtung der sowjetischen Deckungskräfte auf Kertsch und anschließenden Eroberung der Halbinsel. Als Voraussetzung werden die Luftstreitkräfte schwerpunktmäßig für Mansteins Großoffensive zusammengezogen. Das VIII. Fliegerkorps unter Generaloberst Wolfram von Richthofen soll mit seinen 460 Maschinen das schützende Dach für die Angreifer bilden und Vernichtung über die Verteidiger auf Kertsch bringen.
Mansteins Plan sieht vor, im Norden zu täuschen und im Süden zu schlagen. Eine richtige Beurteilung der eigenen Möglichkeiten und ebenso korrekte Einschätzung der feindlichen Absichten. Denn rund zwei Drittel der sowjetischen Streitkräfte stehen im Norden der kaum 20 Kilometer schmalen Parpatsch-Stellung, die von drei Armeen der Krimfront, der 47., 51. und 44., verteidigt sowie vom Asowschen Meer im Norden und Schwarzem Meer im Süden begrenzt wird. Genau hier erwartet Generalleutnant Koslow den Angriff von Mansteins 11. Armee plus rumänischen Unterstützungstruppen. Ein Stoß in die Flanke der nördlichen Ausbuchtung der Parpatsch-Stellung scheint die nahe liegende Option zu sein. So würden es die Russen selbst gemacht haben. Aber Manstein denkt überhaupt nicht daran, ausgerechnet an der Stelle des stärksten Widerstandes, ebendort wo ihn der Gegner erwartet, anzugreifen. Noch dazu mit zahlenmäßig unterlegenen Kräften. Nein, der überragende operative Kopf des Zweiten Weltkriegs, richtet seinen scharfen Blick nach Süden. Zwar muss der Kampf hier mehr oder minder frontal geführt werden, aber dafür gegen einen wesentlich schwächeren Feind. Schließlich disloziert das Oberkommando der Krimfront an diesem Abschnitt der Parpatsch-Stellung nur ein Drittel seiner Streitmacht. Damit hat Koslow bereits den ersten falschen Zug gemacht, noch bevor der erste Schuss der Operation „Trappenjagd“ gefallen ist.
Die Verteidiger haben sich in den vorangegangenen Wochen hinter einem zehn Meter breiten und fünf Meter tiefen Panzergraben verschanzt. Dazu kommen starke Feldbefestigungen. Als angriffsführenden Großverband bestimmt Manstein das XXX. Armeekorps unter Generalleutnant Fretter-Pico. Der Kommandierende befehligt über die 28. leichte, 50. und 132. Infanteriedivision. Den Durchbruch in die Tiefe des feindlichen Verteidigungssystems soll schließlich die 22. Panzerdivision unter Generalmajor Wilhelm erzwingen. Die Weichen für die Eröffnung der Schlacht um Kertsch sind gestellt. Und wenn die Halbinsel im Rücken der Krim fällt, wird der Endkampf um Sewastopol unweigerlich folgen. Ein hoher Einsatz für die Herren Strategen. Den Preis zahlen Iwan und Fritz auf dem Schlachtfeld.
Operation „Trappenjagd“ – der deutsche Angriff auf Kertsch
Die Operation „Trappenjagd“ beginnt am 8. Mai um 3 Uhr 30. Eine Batterie der Sturmgeschützabteilung 1976 soll zusammen mit dem II.Bataillon/Infanterieregiment 121 der 50. Division den Durchbruch erzwingen. Kurzes, aber heftiges Artillerie- und Werferfeuer leitet den Angriff ein. Im Dämmerlicht des frühen Morgens rasselt das Batterieführer-Geschütz auf eine Minensperre. Zwei der Sprengladungen detonieren unter dem Kampfwagen. Als der Chef vom fahruntüchtigen Sturmgeschütz klettert, kommt eine Handgranate geflogen. Die Explosion reißt dem Batterieführer das linke Bein am Oberschenkel ab. Als der Unteroffizier Drohne ausbootet, knallt eine Panzerabwehrkanone (Pak). Die rasante Granate zischt dem Deutschen in den Rücken. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Aber den schwerverwundeten Chef will der Unterwachtmeister Burde unbedingt aus dem Feuer tragen. Da trifft ihn das glühende Eisen eines Granatsplitters. Der messerscharfe Zacken reißt seinen Unterleib auf. Schließlich knallt noch ein Panzerbüchsentreffer aus nächster Nähe. Das Geschoss durchschlägt die Panzerung des Kampfwagens. Dabei werden der Wachtmeister Reydt tödlich und der Gefreite Andree, der als Fahrer fungiert, am Arm verwundet. Das kleine, schlimme Schicksal einer Sturmgeschützbesatzung gleich zu Beginn der Großoffensive. Dennoch wird bis zum Abend das Tagesziel der Batterie, die Höhe 63,8, genommen.
Der Unteroffizier Josef Wimmer7 von der 50. Infanteriedivision berichtet über das gefürchtete deutsche Nebelwerferfeuer: „Allein schon die psychologische Wirkung dieser so grässlich heulenden Geschosse muss für den Gegener schrecklich gewesen sein. Die Einschläge liegen gut, und der Erdboden bebte unter unserer Brust.“
Mit dem ersten Artilleriefeuerschlag stürmen der gebürtige Oberschlesier und seine Kameraden von der 3. Kompanie/Pionier-Bataillon 71 Richtung Niemandsland, um der nachfolgenden Infanterie Gassen durch Stacheldrahtverhaue und andere Sperren zu sprengen. Inmitten des Schlachtenlärms sieht Wimmer „zwischen den aufspritzenden Erdfontänen plötzlich in nicht allzu weiter Entfernung einen Russen, der mit seinem Gewehr in meine Richtung zielte – und schoss. Fast gleichzeitig spürte ich einen stechenden Schmerz im rechten Oberarm.“ Der Pionier-Unteroffzier hat Glück im Unglück, es ist nur ein „Durchschuss“. Auf Fortune und Wagemut baut auch der Oberbefehlshaber der 11. Armee seinen Schlachtplan zur Eroberung Kertschs auf.
Um den Hauptstoß im Süden der Parpatsch-Stellung nicht rein frontal zu führen, hat Manstein eine besondere Überraschung ausgeheckt. Ein Bataillon des Infanterieregiments 436 der bayerischen 132. Division fährt mit Sturmbooten vom Schwarzen Meer her in den Panzergraben. Mit diesem Manöver haben die Verteidiger nicht gerechnet! Die taktische Überraschung glückt vollkommen.
Am nächsten Tag rollt die 22. Panzerdivision in die geschlagene Bresche. Schwerer als der Feinwiderstand macht den Angreifern ein Gewitter zu schaffen. Doch der Durchbruch gelingt. Die 44. Armee wird geworfen. In der Folge schwenken die motorisierten Verbände nach Norden, in den Rücken der Verteidiger, dem Dauerregen und morastigen Gelände zum Trotz. Damit sind zehn Sowjetdivisionen eingeschlossen. Bereits am 21. Mai hat die 11. Armee, nicht zuletzt dank überlegener Führung und totaler Luftherrschaft, die Schlacht gewonnen. Wenigen gegnerischen Einheiten gelingt die Flucht auf dem Seeweg über die Straße von Kertsch. Aber der leuchtende Sieg Mansteins wirft auch dunkle Schatten, nicht nur auf dem Schlachtfeld. Noch während der Kampfhandlungen um die Stadt Kertsch im Osten der Halbinsel rückt ein Teilkommando der Einsatzgruppe D ein, um die Juden zu ermorden. Die SS „nahm sofort die Arbeit auf“, heißt es in einem Bericht.
Auf dem Schlachtfeld ist das blutige Handwerk indes getan. Die Bilanz fällt eindeutig aus: Fast 170.000 Rotarmisten geraten in Gefangenschaft, rund 28.000 bezahlen die Fehler ihrer Vorgesetzten mit dem Leben. Der Verteidigung ermangelte es nicht zuletzt an Tiefe. Nach dem Durchbruch der Deutschen fehlten den Russen befestigte rückwärtige Stellungen, auf die sich die ausmanövrierten Truppen hätten absetzen, wieder Front machen und festbeißen können. Im offenen Steppengelände der Halbinsel, die kaum natürliche Hindernisse bietet, waren Koslows Armeen dagegen den schweren Schlägen des VIII. Fliegerkorps mehr oder minder schutzlos ausgeliefert. So gelang Manstein mit zahlenmäßig bescheidenen schnellen Verbänden, der 22. Panzerdivision und einer motorisierten Vorausabteilung unter Oberst Groddeck, die erfolgreiche Verfolgung und schließlich Überflügelung des Gegners. Das XXX. Armeekorps gewann das Wettrennen auf die Hafenstadt Kertsch und verhinderte ein „russisches Dünkirchen“.
Daneben büßen die Sowjets 258 Panzer und 1.133 Geschütze ein. Von Januar bis April verliert Generalleutnant Koswlows Krimfront 352.000 Mann. Nur Schukows Westfront erleidet in dieser Zeitspanne höhere Verluste. Für Koslow hat das Fiasko auf Kertsch auch persönliche Folgen. Er wird zum Generalmajor degradiert.
Über die Verluste der siegreichen 11. Armee kursieren widersprüchliche Angaben. Sie reichen von 600 bis zu den 7.588 (!) Gefallenen, die das werk „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“8 ausweist. Sollte letztgenannte Zahl tatsächlich stimmen, erscheint es umso bemerkenswerter, dass die Divisionen der 11. Armee nur zweieinhalb Wochen nach diesem fürchterlichen Aderlass schon wieder gegen Sewastopol antreten! Wahrscheinlicher sind allerdings Gesamtverluste in Höhe zwischen 7.000 und 8.000 Mann, also inklusive der Verwundeten. Diese wohl berechtigte Annahme stützt auch Feldmarschall Bock, seinerzeit Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd. Sein Kriegstagebuch weist einen „blutigen Gesamtverlust“ von „rund 7000 Mann“ aus, also Gefallene plus Verwundete. Fest steht, dass Manstein die erste Runde im Kampf um die Krim klar gewonnen hat. Ein bemerkenswerter Triumph, den die 11. Armee in nicht einmal zwei Wochen erringen konnte.
Operation „Störfang“ – Mansteins 11. Armee erobert Sewastopol
Viel Zeit zum Feiern bleibt den Siegern nicht. Schon läuft das Räderwerk zur nächsten, noch gewaltigeren Angriffsschlacht an. Operation „Störfang“ soll Sewastopol zu Fall bringen. Die Festung hält General Petrows Küstenarmee mit sieben Schützendivisionen in einer Gesamtstärke von über 100.000 Mann. Im Schlachtverlauf werden noch Verstärkungen auf dem Seeweg zugeführt. Den Verteidigern stehen gut 600 Geschütze, über 1.000 Granatwerfer, aber nur ein paar Dutzend Panzer und kaum mehr als 50 Flugzeuge zur Verfügung. Ihr gegenüber ist die 11. Armee mit siebeneinhalb deutschen und eineinhalb rumänischen Divisionen, zusammen rund 200.000 Mann, aufmarschiert. Dazu kommen überlegene Flieger- und Artilleriekräfte. Insgesamt warten 1.300 Geschütze auf den Feuerbefehl, darunter 600 großkalibrige Rohre. Auf deutscher Seite ist es die stärkste Konzentration an Artillerie während des gesamten Zweiten Weltkriegs. Ein unglaublicher Aufwand, zu dem der Gegner gezwungen hat. Die Russen haben die Zugänge zur Stadt massiv befestigt. Zahllose Bollwerke im Vorfeld müssen erst sturmreif geschossen werden. Manstein erkennt: Dafür reicht das übliche Vorbereitungsfeuer von Stunden oder gar Minuten nicht aus. Der Oberbefehlshaber der 11. Armee setzt vielmehr auf die Wirkung einer tagelangen Kanonade. Geplant ist eine nachhaltige Zerstörung.
So beginnt die Operation „Trappenjagd“ am 2. Juni mit einem fünftägigen Artilleriebeschuss und Luftbombardement. Richthofens Geschwadern stehen insgesamt 600 Maschinen zur Verfügung. Die totale Luftherrschaft der Deutschen bleibt auch in den Tagen des „Störfang“ unangefochten. Das VIII. Fliegerkorps fliegt bis zu 1.200 Einsätze pro Tag. Mit der überwältigenden Feuerkraft, die Heer und Luftwaffe entfesseln, sollen Hunderte Betonwerke, bestückt mit schwersten Batterien, breite Bunkergürtel und 350 Kilometer Schützengräben systematisch eingeebnet werden.
Unter den deutschen Geschützen wirken drei einzigartige Riesenrohre: der Gamma-Mörser im Kaliber 42,7 Zentimeter. Aus dem 6,72 Meter langen Rohr können 923 Kilo schwere Geschosse bis zu 14,25 Kilometer weit verschossen werden. Der Mörser „Karl“, auch „Thor“ genannt, hat ein Kaliber von 61,5 Zentimeter. Er verfeuert aus seinem fünf Meter langen Rohr 2.200 Kilo schwere Granaten auf Entfernungen bis zu fünf Kilometer. Die Geschosse durchschlagen zweieinhalb Meter dicken Beton beziehungsweise 45 Zentimeter starken Stahl. Noch weitaus monströser wirkt das Eisenbahngeschütz „Dora“. Das Ungetüm ist 43 Meter lang, sieben Meter breit, 12 Meter hoch und 1.350 Tonnen schwer. Dieses größte Geschütz der Welt, Kaliber 80 Zentimeter, verschießt Riesengeschosse im Gewicht von 4.800 beziehungsweise 7.000 Kilo. Die 7,80 Meter langen Granaten erzielen, je nach Art der Munition, Reichweiten von 38 bis 47 Kilometern. Zur Bedienung gehören nicht weniger als 4.120 Mann, die drei Schuss pro Stunde abfeuern können. Das Megageschütz durchschlägt bis zu acht Meter dicken Eisenbeton respektive 32 Meter gewachsenen Boden. Eine wahnsinnige Schöpfung durchgeknallter Rüstungsfachleute.
Der Luftwaffensoldat Kurt Kull9, Angehöriger der Flakbatterie 293, wird Zeuge der monströsen Veranstaltung. Seine Zwei-Zentimeter-Flak ist zum Schutz des Eisenbahngeschützes „Dora“ eingesetzt. Der blutjunge Frankfurter berichtet über den großen Knall:
„Der Schuss war ein umwerfendes Erlebnis: Die Detonation war so gewaltig, dass es uns zu Boden riss. Die zurücksausende Lafette konnte durch elastische Puffer erst nach mehreren Hundert Metern aufgefangen werden.“
Kull und seine Kameraden können sogar den „Austritt des Geschosses aus dem Riesenrohr“ genau verfolgen. Die einschlagenden Granaten reißen Löcher von der Größe eines Wohnhauses.
Während seines Einsatzes auf der Krim wird Kull allerdings auch Zeuge eines anderen niederschmetternden Ereignisses. Als die Flak-Kanoniere neue Stellungen schanzen, stoßen sie auf ein Massengrab mit männlichen Leichen. Kull und seine Kameraden erhalten Befehl, die Toten wieder mit Erde zu bedecken und sich ihre Deckungslöcher woanders zu graben …
Im Herbst 1942 soll die düstere Ahnung aus dem Sommer durch ein weiteres Vorkommnis indirekt bestätigt werden. Diesmal kann Kull durchs Fernrohr beobachten, wie SS-Angehörige 30 bis 40 kniende Männer durch Genickschuss liquidieren. Als der Frankfurter seinem Hauptmann Reichert gutgläubig Meldung über die Exekution macht, antwortet dieser schroff:
„Kull, vergessen Sie, was Sie gesehen haben!“
Aber der 20-jährige mit dem Bubi-Gesicht kann das Verbrechen nicht so einfach verdrängen, leidet seither unter Albträumen.
Derweil zermürbt das tagelange Trommelfeuer die Verteidiger Sewastopols. Allein die 8,8-Batterien des Flakregiments 18 verschießen im Laufe der 27-tägigen Schlacht 181.787 Granaten. Und das Artillerieregiment 22 der 22. Infanteriedivision verfeuert über 100.000 Granaten. Kann sich da überhaupt noch wer zur Gegenwehr erheben, wenn die deutsche Infanterie zum Sturm antritt?
*
Am 7. Juni beginnt der Vorstoß der 11. Armee auf Sewastopol. Den Hauptschlag führt das LIV. Armeekorps unter General der Artillerie Hansen mit der 22., 24., 50. und 132. Infanteriedivision von Nordosten her. Aber trotz des tagelangen Vernichtungsfeuers gibt es erbitterte Gegenwehr – erst im waldigen Berggelände, dann in den Festungswerken. Mörderischer Hitze liegt über dem rauchgeschwängerten Schlachtfeld. Am 13. Juni zeigt das Thermometer 38 Grad Celsius. In den Sturmgeschützen, die den vorgehenden Stoßtrupps zugeteilt sind, herrschen über 50 Grad. Schweiß fließt in Strömen, und bald auch Blut. Ein Mitkämpfer der Infanterie beschreibt seine Eindrücke der Schlacht:
„In einer kleinen Senke plötzlich ein feindliches MG-Nest. Auf unser Feuer hin stehen drei Mann auf und heben die Hände. Als wir langsam näher gehen, schießen zwei andere, die noch in Deckung liegen, mit dem MG auf uns. Ein weiterer stellt sich tot. Als wir vorbei sind, flitzt er hoch und will uns in den Rücken fallen. Das ist die bolschewistische Kampfmethode. Sie alle sprechen sich ihr Urteil selbst. Auf dem Boden Minen über Minen. Neben mir fliegt ein Kompanieführer in die Luft, fällt zurück und – steht, beinahe unverletzt wieder auf den Füßen. Aber nicht alle haben solches Glück.“10
Und wer meint, dass rumänische Offiziere nur Sonderrechte gegenüber der ihnen anvertrauten Truppe besitzen, Untergebene schlagen, sich gar feige vor dem Feinde zeigen, erlebt bei Sewastopol auch die andere Seite der Verbündeten. Die Männer der Sturmgeschützabteilung 197 bezeugen, wie todesmutige Führer aufrecht gegen die russischen Bunker vorgehen und ihre Soldaten durch das persönliche Beispiel mitreißen. Tapfere Offiziere und Männer braucht es unter diesen heiklen Kampfbedingungen ganz gewiss. Da sind zum Beispiel diese bis zu drei Meter tiefen russischen Laufgräben, die gegen Beschuss ziemlich unempfindlich und nur schwer aufzurollen sind. Zumal sie von entschlossenen, fanatisch kämpfenden Gegnern geschickt verteidigt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die sowjetischen Batterien an den Schwerpunkten der deutschen Stoßgruppierungen auf den Meter genau eingeschossen sind. Ihr Sperrfeuer kostet Blut und Zeit. Beides ist knapp auf deutscher Seite.
Der von seinem Oberarm-Durchschuss schnell wiedergenesene Pionier-Unteroffizier Josef Wimmer von der 50. Infanteriedivision erzählt von erbitterten Nahkämpfen gegen einen „sich zäh verteidigenden Iwan“ und erwähnt angesichts der eigenen blutige Verluste „unsere aufwallende Wut“ sowie die anschließende „brutale Reaktion. Wir machten sechs Gefangene, und fünf andere Russen wurden erschossen.“11
Im Vorfeld des Alten Forts sieht Wimmer plötzlich einen russischen Stahlhelm blitzen – „in etwa einhundertfünzig Meter Entfernung. Ich ließ mir rasch einen Karabiner reichen, entsicherte, zielte und schoss. Der Helm flog durch die Luft; man konnte es gut sehen.“ Der Unteroffizier vermutet, einen Späher getroffen zu haben. Kurz darauf wird Josef Wimmer durch 33 Granatsplitter schwer verwundet.
Bis zum 17. Juni toben die schweren, verlustreichen Kämpfe. Dann endlich gelingt die Wegnahme von sechs Festungswerken. Im Gefechtsbericht der 22. Division heißt es über die Kämpfe des Infanterieregiments 16 um das Fort Stalin: „Der »Andrejew-Hügel« war nur besetzt von Mitgliedern der kommunistischen Partei, dem wohl zähesten Feind, den wir je erlebt haben. Ein Bunker wurde von der Pak beschossen, ein Treffer in die Scharte verursachte 30 Tote, aber die überlebenden Russen wehrten sich weiter! Endlich, um 15 Uhr, kam der Gegner aus den Trümmern heraus. Die eigenen Offiziere waren sämtlich ausgefallen. Leutnant Zwiebler aus der Führerreserve erhielt die gesamten Teile des I. und III. Bataillons zur Führung. Ein Schwerverwundeter sagte, auf seinen zersplitterten Arm und verbundenen Kopf deutend: »Das ist nicht so schlimm – wir haben den Stalin!« Das war der Geist der Besessenheit, ein Ziel erreichen zu wollen. Erbarmungslos brannte die Sonne auf die Stahlhelme. Leichengestank lag über dem wüsten Schlachtfeld. Eine unbeschreibliche Menge Fliegen verekelte die reichliche Verpflegung.“
Beim Schwesterregiment 47 sind am 18. Juni noch 17 Offiziere, 50 Unteroffiziere und 372 Mann einsatzfähig. Damit hat nur jeder sechste Angreifer dieses im Schwerpunkt eingesetzten Verbands die ersten 12 Tage der Großoffensive auf Sewastopol unversehrt überstanden. Für Manstein „scheint das Schicksal des Angriffs in diesen Tagen auf des Messers Schneide zu stehen“.12 Neben den hohen Verlusten ist es vor allem der Zeitdruck, der dem Oberbefehlshaber der 11. Armee Kopfzerbrechen bereitet. Das OKH drängt bereits auf den Abzug des VIII. Fliegerkorps vom Nebenkriegsschauplatz Sewastopol an den Nordflügel der Heeresgruppe Süd ...
Viele Opfer fordert auch das Ringen der 132. Infanteriedivision um das mit überschweren Geschützen vom Kaliber 30,5 Zentimeter bestückte Fort „Maxim Gorki“. Immer wieder müssen Artillerie und Bomber der festliegenden Infanterie den Weg frei schlagen. Ein Mitkämpfer berichtet:
„Wiederum bot sich das ungeheuerliche Schauspiel eines fast dreiviertelstündigen Stuka-Angriffs auf den felsigen Berg. Turmhoch standen die Rauch- und Staubsäulen über dem Werk und verdichteten sich allmählich zu einer gewaltigen Wolke, deren langsamer Abzug für das gesamte Schlachtfeld das hervorstechendste Merkmal war.“13
Von den 1.000 Mann Besatzung des „Maxim Gorki“ ergeben sich schließlich noch ganze 40 Rotarmisten, allesamt verwundet – der Rest ist gefallen.
Am 21. Juni nimmt der Infanterist Walter Winkler14 an der Erstürmung der Bunker des Nordforts teil. Der Angehörige der 11. Armee berichtet:
„Die Zugänge zu den Stollen und Berghallen waren durch Panzertore gesichert […] Der wohlgemeinte Versuch, mit Hilfe von Gefangenen die Besatzungen zur Aufgabe zu bewegen – schon wegen der vielen Zivilisten in den Stollen – schlug fehl […] Ein junger Freiwilliger eines Pionierbataillons ließ sich schließlich vom Felsrand abseilen, um mit einer geballten Ladung einen der Eingänge aufzusprengen. Doch noch während er am Seil hing, ereignete sich eine gewaltige Explosion: Die Besatzung dieses Stollens hatte sich mit, wie sich später herausstellte, 1.400 Zivilpersonen in die Luft gesprengt.“
*
Der tiefe deutsche Einbruch an der Nordfront wird schließlich sechs Tage später zum Durchbruch auf die Sewernaja-Bucht erweitert. Pulverdampf und Staub, Hitze und Verwesungsgestank liegen über dem infernalischen Schlachtfeld. Der Kampf um die Seefestung auf der Krim geht in die letzte Runde.
Inzwischen ist auch Bewegung in die Südostfront von Sewastopol gekommen. Bis zum 25. Juni rückt das XXX. Armeekorps unter General der Artillerie Fretter-Pico mit der 72. und 170. Infanterie- sowie der 28. Jägerdivision auf die beherrschenden Sapun-Höhen vor. Die Hirschberger Jäger erzwingen den entscheidenden Durchbruch. In der Chronik der 28. Jägerdivision heißt es:
„Die Härte des Kampfes zeigen die vielen Verwundeten, die durch Bajonettstiche und Handgranatensplitter verletzt sind. Ein Gegenangriff auf die Höhe bricht bereits im Sperrfeuer der Artillerie zusammen.“
In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni herrscht reger Betrieb am Nordufer der Sewernaja-Bucht. 100 prall gefüllte Sturmboote setzen auf die andere Seite über. Die angelandeten Stoßtrupps nehmen das befestigte Steilufer. Damit ist die Schlacht entschieden, wenngleich bis zur endgültigen Einnahme der Stadt am 5. Juli noch fast eine Woche vergehen soll.
Hauptmann der Luftwaffe Werner Pabst15 beschreibt den apokalyptischen Endkampf um die Festung: „Das ganze Land mußte mit Bomben und Granaten buchstäblich erst umgepflügt werden, ehe sie ein Stück zurückwichen.“
Die schier unglaubliche Opferbereitschaft vieler Rotarmisten nötigt nicht wenigen Landsern höchsten Respekt ab. Der Vertreter des Auswärtigen Amts beim Armeeoberkommando (AOK) 11, Hentig, berichtet am 6. Juli 1942 über Iwans Tapferkeit:
„Daß die Leistungen ungeheuerlich waren, wird gerade von Frontsoldaten anerkannt. Wie oft habe ich nicht voll Staunen gehört: ,Das hätte kein Franzose und kein Engländer, das hätten wir nicht einmal ausgehalten.‘ [...] Nur von der äußersten Front, kaum je von der deutschen Presse, ist das Draufgängertum und der in vielen Fällen unerhörte Mut nicht nur des Soldaten, sondern auch des Kommissars und Politruks anerkannt worden.“
Am Ende taumeln 95.000 zu Tode erschöpfter Rotarmisten in Gefangenschaft. Eine erstaunlich hohe Anzahl Überlebender angesichts des massiven deutschen Beschusses und Bombardements. Und ein Indiz für die enorme Stärke der sowjetischen Befestigungen. Beleg auch dafür, wie begrenzt die tatsächliche Wirkung von Trommelfeuer vielfach ist. Iwan versteht es eben vortrefflich, sich tief in die schützende Erde einzugraben. Nichtsdestotrotz bedecken Zehntausende Leichen das „umgepflügte“ Schlachtfeld. Davon sollen sich bis zu 5.000 der Gefangennahme durch Suizid entzogen haben. Von ehemals 200.000 Einwohnern hausen noch gut 30.000 in den Ruinen der leidgeprüften Stadt.
Neuneinhalb Monate ist die 11. Armee auf der Krim gebunden gewesen. Während dieser Zeit sind schwere Blutopfer erbracht worden. Seit Beginn des Ostfeldzuges hat der Großverband 70.000 Mann verloren, im Schnitt 10.000 pro Division! Überproportional hohe Verluste. Bis zu 25.000 deutsche Soldaten sollen im Kampf um die Krim gefallen sein.16 Auf Seiten der Roten Armee ist von annähernd 160.000 Toten in dem quälend langen Ringen auszugehen. Laut Feldmarschall Bock trägt nichtsdestotrotz Mansteins Feldherrnkunst wesentlich zur Bereinigung der Lage bei.
Verbrechen hinter der Front
Zahllose Opfer sind auch abseits des Kampfgeschehens zu beklagen. Im Jahr 1942 gilt unter anderem die Nordukraine als Partisanengebiet. Überfälle der Freischärler häufen sich. Die deutschen Einsatzgruppen der SS, unterstützt von einheimischer Miliz und ungarischer Infanterie, unternehmen brutale Razzien als Vergeltungsmaßnahme. Der später populäre Journalist Peter von Zahn17 erlebt als Kriegsberichterstatter eine dieser Aktionen. Überfallartig durchkämmen die Partisanenjäger einen Ort. Während die ukrainische Miliz nach Gutdünken Verdächtige aussondert, übernimmt die SS das Erschießen. Anschließend werden die Häuser der Opfer niedergebrannt. Von Zahn kommentiert die Aktion Jahrzehnte danach so:
„Es war reiner Terror auf dem Rücken der Bevölkerung. Ein Krieg, der Sinn und Zweck völlig verloren hatte.“
In einem anderen Fall kommen SS-Männer, als Partisanen getarnt, der Anführer mit rotem Stern auf der Mütze und russisch parlierend, in ein Dorf. Jene Bewohner, die Sympathie für die vermeintlichen Landsleute bekunden – oft genug aus purer Angst vor den nicht selten auch gegenüber der Zivilbevölkerung brutal vorgehenden Freischärler – werden kurzhand erschossen.
Kurt L.18, gebürtiger Berliner des Jahrgangs 1908, ist während des Sommers 1942 im rückwärtigen Heeresgebiet zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. Der gelernte Bankkaufmann schreibt seiner Mutter am 26. Juni:
„Neulich wurde eine Panjepferde-Transportstaffel, (Pferde, die laufend aus Polen geholt werden) bestehend aus 200 armseligen unterernährten Gäulen, von denen meist ein Teil auf dem langen Marsch zurückbleibt, und 50 russ. Pferdeknechte und 25 deutschen Soldaten von den Partisanen überfallen. Das kostete 2 Tote u. 5 Verletzte. Als Folge wurden von uns 3 Dörfer, in denen sich die Partisanen aufgehalten haben, vollkommen niedergebrannt, und die männliche Bevölkerung erschossen. Das ist dann die notwendige unerbittliche Vergeltung, bei der natürlich Unschuldige mit den Schuldigen leiden müssen.“
Nicht minder brutal sind die Aktionen der Partisanen. Wehrmachtsangehörige, die lebend in die Hände der Freischärler fallen, müssen mit einem fürchterlichen Ende rechnen. Herbert Veigel19, Soldat bei der Luftabwehr, erlebt im Sommer 1942 eine Partisanen-Attacke auf einen deutschen LKW. Der Augenzeuge berichtet über die schockierenden Szenen und ihre Folgen:
„Auf der Ladefläche lagen die Leichen der fünf Männer, nackt, zerstückelt wie geschlachtete Tiere. Den Geruch des frischen Blutes werde ich nie vergessen. Ist es dann nicht verständlich, daß sich nichts mehr in mir rührte, wenn ich auf unserem Weg Partisanen an den Bäumen baumeln sah, Schilder um den Hals, auf denen stand: ,Ich habe als Partisan deutsche Soldaten überfallen‘?“
Nur vordergründig, denn Vergeltungsaktionen im Krieg sind nur selten gerecht. Und der anfangs schwachen Partisanenbewegung verschafft die Eskalation der Gewalt wachsenden Zulauf. Die Zahl der Freischärler steigt im Laufe des Jahres 1942 von rund 25.000 auf 150.000. Dessen ungeachtet betont der Führer in der ostpreußischen Wolfsschanze am Abend des 10. Mai, dass er die letzte Kuh aus der Ukraine wegschaffen werde, bevor die Heimat hungern müsse.20
Dazu kommen die 1942 von Hitler persönlich befohlenen Zwangsdeportationen von Arbeitssklaven. Davon sind vor allem Frauen aus der Ukraine im Alter zwischen 18 und 35 Jahren betroffen. Sie werden ins Reich verschleppt, um knochenharte Zwangsarbeit zu leisten. Ihre Zahl geht in die Hunderttausende.
Und auch die Judenmorde haben im zweiten Kriegsjahr an der Ostfront noch kein Ende gefunden. In einem Feldpostbrief heißt es:
„Über die Ereignisse im Osten betr. der Juden könnte man ein Buch schreiben. Dafür ist das Papier zu schade. Ihr dürft Euch sicher sein, sie kommen an einen richtigen Ort, da unterdrücken sie keine Völker mehr.“
Der Memoirenschreiber Manstein findet in seinem Buch „Verlorene Siege“ auch nachträglich noch keine Worte für den Völkermord, die mindestens 33.000 Juden, die im Befehlsbereich der 11. Armee „an einen richtigen Ort“ gekommen sind. Hätte er gar während der Jahre 1941/42 gegen den Holocaust auf der Krim und damit gegen Hitler opponiert, wäre die militärische Karriere beendet gewesen. Die eiskalte Gleichung lautete: Ohne Unterstützung oder zumindest Duldung der Verbrechen keine glänzenden Operationen mehr und kein Marschallstab für die Erstürmung der Seefestung Sewastopol. Ein hoher Preis, den Manstein zu zahlen bereit gewesen ist. Wie die meisten deutschen Offiziere in höchster Verantwortung.
Dieser Tage werfen die dunklen Schatten der Vergangenheit ein düsteres Licht auch auf vermeintlich couragierte Generale, die bis dato gar dem Widerstand zugeordnet worden sind. Hans Graf von Sponeck, der als Kommandierender General des XXXXII. Armeekorps im Dezember 1941 entgegen Mansteins und Hitlers Haltebefehl die Halbinsel Kertsch auf eigene Faust räumte und damit Tausende seiner Soldaten gerettet haben mag, soll den Holocaust auf der Krim aktiv unterstützt haben.21 Doch nur wer den Geist dieser hohen Offiziere, ihre Herkunft, Sozialisation und Motivation ausblendet, darf ernsthaft überrascht über diese neue Enthüllung sein. Es werden wohl bald wieder einige bundesrepublikanische Straßen- und Kasernenschilder, die den Namen Sponeck tragen, umbenannt werden müssen ...
Die Kesselschlacht bei Charkow
Im Frühling 1942 kreisen die Gedanken im Führerhauptquartier vor allem um den sowjetischen Frontvorsprung bei Isjum, südlich Charkow. Ein gefährliches Relikt aus der Winterschlacht, entstanden durch einen russischen Einbruch in die deutschen Linien am Donez. Der weit nach Südwesten ragende Balkon ist 100 Kilometer breit und tief. In den Stäben der Heeresgruppe Süd sieht man klar: Bevor die große Sommeroffensive, der „Fall Blau“, hier den Ausgangspunkt nehmen kann, muss erst einmal diese russische „Beule“ eingedrückt werden. Die Operation erhält den Decknamen „Fridericus“. Sie sieht einen konzentrischen Angriff gegen die sowjetische 6. und 57. Armee vor. Von Norden soll General Paulus 6. Armee, von Süden die Armeegruppe Kleist mit Teilen der 1. Panzer- und 17. Armee antreten. Gelingt die Operation, wäre nicht nur eine gewaltige Kesselschlacht geschlagen, sondern auch eine günstige Basis für den „Fall Blau“ gewonnen. „Fridericus“ soll am 18. Mai starten.
Aber nicht nur Hitler, Halder und Bock befassen sich mit Angriffsoperationen. Auf der Gegenseite plant Marschall Timoschenko, der Oberbefehlshaber der Südwestfront, eine konzentrische Offensive gegen die wichtige Etappenstadt Charkow, um die 6. Armee einzuschließen. Nach Vernichtung der eingekesselten Verbände soll weiter auf Dnjepropetrowsk vorgestoßen werden. Über diesen Knotenpunkt am Dnjepr rollt ein Großteil des Nachschubs für die deutschen Großverbände im Donezgebiet und auf der Krim. Die Operation geht auf die persönliche Initiative Stalins zurück, und sie ist überaus gewagt! Immerhin richtet sich der Stoß gegen einen kampfkräftigen und erfahrenen Gegner, der selbst zur Großoffensive rüstet. Ein kompetenter Chronist der Frühjahrsschlacht um Charkow, der US-Militärhistoriker und -schriftsteller David M. Glantz, schreibt: „Unlike their Soviet counterparts, in spring 1942 German combat formations were still led and manned by battle-hardened and experienced combat veterans.“22 („Im Gegensatz zu ihren sowjetischen Gegnern, wurden die deutschen Kampfverbände im Frühling 1942 geführt von und besetzt mit schlachtgestählten und erfahrenen Kriegsveteranen.“)
In der Tat: Unter diesen Umständen droht Timoschenkos kühner Stoß zu einem gefährlichen Stich ins Wespennest zu werden …
Zwar befürwortet Armeegeneral Schukow ebenfalls Präventivschläge gegen die deutsche Front. Doch fasst der bullige Stratege dafür eher den Mittelabschnitt, deren Westfront er selbst kommandiert, ins Auge. Aber Stalin lässt sich von seinem Präventivschlag in der Ukraine nicht abbringen. Daran können auch die Bedenken seiner wichtigsten militärischen Ratgeber nichts mehr ändern. Die schweren Bedenken von Generalstabschef Schaposchnikow und seines strategisch begabten Zöglings Wassiljewski wischt Stalin beiseite.
Die Frage ist nur: Wer schlägt als Erster los – die Deutschen oder die Russen? Der 12. Mai liefert die Antwort. Aus der „Pestbeule“, wie Feldmarschall von Bock, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd, den Donez-Brückenkopf bei Woltschansk nennt, tritt die 28. Sowjetarmee mit 16 Schützen- und Kavalleriedivisionen sowie drei Panzer- und zwei mechanisierten Brigaden gegen den Nordflügel der 6. Armee an. Nach einstündiger Artillerie- und bis zu 20-minütiger Luftvorbereitung. Der Stoß richtet sich gegen Seydlitz-Kurzbachs LI. und Hollidts XVII. Armeekorps.
Wie kritisch sich die Lage vorn bei den betroffenen Einheiten entwickelt, erlebt der Soldat Hans-Jürgen Hartmann23 von der 294. Infanteriedivision. Sein schonungsloser Bericht offenbart Entschlossenheit und Verzweiflung gleichermaßen sowie teils krasse Unterschiede in der Mentalität, Ausstattung und Versorgung der beteiligten Großverbände. Hartmann, Angehöriger einer 14. (Pak) Kompanie, blickt neidvoll auf eine benachbarte Panzerdivision, für deren Angehörige es unter anderem „Schokolade und Zigaretten satt, herrlichen Käse“ gibt. Vor allem aber ist es das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber den massiven russischen Panzerangriffen im Raum Nepokrytaja, die an der Moral der Infanterie nagen. Mancherorts geraten die Landser sogar in Panik. Hartmann schreibt über die dramatischen Ereignisse, die sich Mitte Mai ostwärts Charkow zugetragen haben:
„Aus den riesigen Staub- und Pulverwolken brachen dann die Panzer hervor, die braunen Infanterierudel gleich dahinter, und dann gab es kein Halten mehr. Weg, ab nach hinten, Kanonen sprengen – rette sich, wer kann! Dazu oben in Massen die russischen Schlachter.“24
In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai entern einzelne Landser vorbeirollende Panzer, um oben aufsitzend mitzufahren. Entsetzt erkennen die Infanteristen dann aber rote Sterne an den Türmen. Sofort springen sie wieder herunter und flüchten sich schließlich doch lieber zu Fuß nach Westen. Laut Hartmann wirkt der verlorene Haufen wie „ein jammervoll zerfledderter, entnervter Verein, den Panzerschreck in den Knochen, verkommener Lanseradel, hin- und hergeschubst als Lückenbüßer, ohne Kanonen und Handgranaten, und wie zum Hohn bestückt mit russischen Beuteflinten.“
Noch brenzliger entwickelt sich die Lage am Südflügel der 6. Armee. General der Panzertruppe Friedrich Paulus sieht seine Offensivplanungen jäh über den Haufen geworfen. Statt selbst anzugreifen, muss sich der im Felde noch unerfahrene Kommandeur mit seinem Großverband dem überwältigenden Ansturm von zwei sowjetischen Armeen, der 6. und 57., erwehren. Nicht weniger als 26 Schützen- und 18 Kavalleriedivisionen sowie 14 Panzerbrigaden überrennen die sechs Divisionen des deutschen VIII. und rumänischen VI. Korps. Insgesamt führen die Russen 640.000 Mann, 1.200 Panzer und über 900 Flugzeuge in die große Frühjahrsschlacht um Charkow. Werden Timoschenkos Greifer nicht schleunigst angepackt, sind alle Planungen für den „Fall Blau“ obsolet.
Erst 20 Kilometer vor Charkow gelingt es General Paulus, mit der 3. und 23. Panzerdivision den ungestümen Vorwärtsdrang der russischen Nordzange durch Flankenstöße zu lähmen. Das infanteristische Rückgrat bildet die 71. Divison. Generalmajor Hartmanns Großverband ist im Herbst 1941, nach der Kesselschlacht um Kiew und den hohen Verlusten, von der Ostfront abgezogen und zur Wiederauffrischung nach Belgien verlegt worden. Der zweite Russlandeinsatz sieht die voll kampfkräftige Infanteriedivision in der Schlacht um Charkow.
Leutnant Wigand Wüster25 von der 10. Batterie/Artillerieregiment 171 erlebt die wechselvollen Gefechte. Eine seiner schweren Feldhaubitzen, Kaliber 15 Zentimeter, fällt durch Rohrkrepierer aus. Der starke Detonationsdruck hat die beiden Kanoniere auf der Lafette betäubt, Gefäße in ihrem Gesicht sind geplatzt. Aber die erlittenen Verletzungen erweisen sich als halb so schlimm. Lebensgefährlich ist dagegen die starke sowjetische Artillerie, laut Leutnant Wüsters Bericht liegt die Hauptkampflinie (HKL) „unter ständigem schweren Beschuss“. Zu allem Überfluss greifen auch noch Panzer plus Begleitinfanterie an. Im direkten Richten nehmen die Artilleristen mit ihren schweren Feldhaubitzen von einer Vorderhangstellung aus die anrollenden T 34 unter Feuer. Distanz 1.500 Meter. Dann rollt die Kanonade über das wellige Gelände. Und es gelingt tatsächlich, Wirkung zu erzielen, obwohl die Haubitzen nicht sonderlich für den Panzerabwehrkampf geeignet sind. Der erste Volltreffer reißt einem T 34 gleich den ganzen Turm herunter. An anderer Stelle genügt der Naheinschlag einer 15-Zentimeter-Granate, um einen Tank bewegungsunfähig auf die Seite zu werfen oder ihm die Ketten abzureißen. Fünf Russenpanzer kann die 10. Batterie schließlich vernichten, dann ist der Feindangriff abgeschlagen.
Hans Jürgen Hartmann von der 294. Infanteriedivision beschreibt die gefallenen Gegner in seinem Gefechtsabschnitt: „Die meisten Toten waren Mongolen mit gelben, vor Schmerz und Angst und Hitze grässlich verzerrten Gesichtern, die uns mit starren Augen und bleckenden Zähnen immer von neuem erschreckten.“26





























