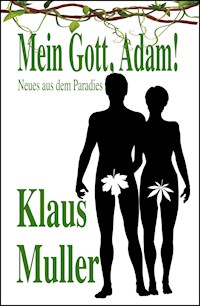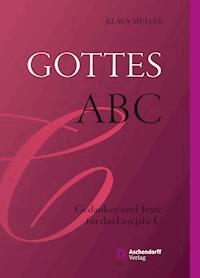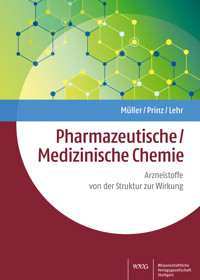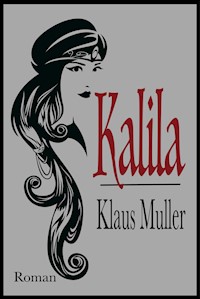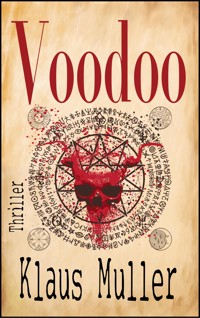
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lieutenant Lumen Phoenix ist vieles gewohnt – doch der Fund einer ausgebluteten, verstümmelten Frauenleiche am Jachthafen von New Orleans konfrontiert sie mit einem besonders rätselhaften Fall. Eine groteske Stoffpuppe im Brustkorb des Opfers wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Als eine zweite Tote auftaucht – ebenfalls ohne Herz, ebenfalls mit entstelltem Körper – verdichten sich die Hinweise auf einen Serientäter. Doch die Motive bleiben im Dunkeln. Gemeinsam mit dem jungen Officer Tyler Felix beginnt Phoenix in einem Umfeld zu ermitteln, in dem Glaube, Aberglaube und alte Rituale bis heute zum Alltag gehören. Die Spur führt tief in die feucht-heißen Sümpfe Louisianas – dorthin, wo moderne Polizeiarbeit an ihre Grenzen stößt und die Vergangenheit noch immer in den Schatten lebt. Für Lumen Phoenix wird der Fall zur Belastungsprobe, dessen Aufklärung alles von ihr abverlangt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Klaus Muller
Voodoo
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
Fussnoten:
Impressum neobooks
Titel
Voodoo
von
Klaus Muller
Prolog
Wenn Nächte nicht nur Nächte sind
Und Seelen nicht mehr sind als Wind
Weil alte Egos Ängste schüren
Und selbst Dämonen Furcht verspüren
Wenn durch jedes Licht, das schwindet
Die Hoffnung keinen Halt mehr findet
Weil Schlächter schon die Messer schärfen
Und Schattenwesen Schatten werfen
Wenn nichts mehr bleibt in dieser Zeit
Als Angst vor tiefer Dunkelheit
Weil Hunde Blut vom Boden lecken
Und Mütter nachts ihr Kind verstecken
Wenn sich nichts mehr zum Guten wendet
Und euer Leben endlich endet
Weil ihr vergeblich Hilfe sucht
Dann senkt das Haupt, ihr seid verflucht!
Kapitel 1
Es war die lange Nacht des Fiebers.
Ein Fieber, das wie eine mächtige Welle des Zorns über alles hinwegrollte und jeden, der ihm zu nahe kam, mit sich in einen schwarzen, bodenlosen Abgrund zog.
Rosi Rosas leise Gebete an jeden Gott, der zuhörte, und ihr Flehen, endlich sterben zu dürfen, blieben ungehört. Sie war verflucht – verflucht dazu, zu leben!
Ihr schweißbedeckter Körper lag gekrümmt auf einer schmutzigen Matratze, deren zahllose Flecken nicht alle von ihr stammten.
In kurzen Abständen wurde ihre magere Gestalt immer wieder von heftigen Krämpfen geschüttelt. Und obwohl jede Hoffnung auf Linderung der Qualen längst in ihr erloschen war, klammerte sie sich an den letzten, flüchtigen Hauch von Leben, der sich noch tief in ihr dem Unvermeidlichen entgegenstellte.
Trotz allem, was ihr widerfahren war, schien es, als wäre ihr das Leben letztlich doch noch so viel wert, dass es sich lohnte, darum zu kämpfen.
Gleichwohl wusste sie mit erschreckender Gewissheit, dass ihr Licht noch in dieser Nacht erlöschen würde.
Es war beschlossene Sache.
Kein Medikament der Welt hätte das Brennen in ihrer Seele mildern können.
Kein Kraut wäre stark genug gewesen, um gegen die Wesen der Finsternis anzukommen, die schon mit dürren Fingern nach ihr griffen. Es waren jene Mächte, die sie selbst gerufen hatte, lange bevor sie in einem stillen Gebet Gott um Erlösung und einen schnellen Tod angefleht hatte.
Vergeblich, wie es mit jeder verstrichenen Minute deutlicher wurde.
Auch er hatte sie verlassen. Die Sünden ihres kurzen Lebens, das sie in dieser Stunde schmerzlich erkannte, waren zu groß, als dass ihre Gebete noch erhört werden konnten – nicht einmal von Göttern.
Für sie bestand keine Hoffnung auf Erlösung.
Offensichtlich gab es selbst im Himmel eine Grenze für das, was vergeben werden konnte.
Langsam öffnete Rosi ihre Augen und blickte auf das kleine Fenster, das hoch über ihr in der Wand glimmte.
Es schien ihr, als könne sie die heiße Luft der Nacht spüren, die durch die Öffnung hereinströmte und sich über sie legte wie ein feuchtes Tuch.
Mag sein, dass es nur Einbildung war oder der Hunger ihr einen Streich spielte, doch sie war sich sicher, den Geruch von Meerwasser und Zimt wahrzunehmen.
„Zimt“, dachte sie und erinnerte sich wehmütig an dessen geliebten Duft – wie sie ihn als Kind mit Zucker vermischte und über warmen Reis streute, den ihre Mutter zuvor in Milch gekocht hatte.
Es waren angenehme Gedanken, die sie ein wenig ruhiger werden ließen.
Manchmal nutzte das Mondlicht die Gelegenheit und erzeugte einen schwachen, gelben Fleck auf dem groben Steinboden neben ihr.
Das kleine Fenster in der Wand hoch über ihr war die einzige Abwechslung, die es in diesem Raum für ihre Augen gab. Tagsüber, wenn der Himmel klar war, bildete es ein kleines, blaues Rechteck. Nachts schauten einige matte Sterne hindurch, als wollten sie sich davon überzeugen, dass sie wirklich noch da war.
Wenn jedoch ein Sturm genügend Wolken vor sich hertrieb, wurde das Fenster so schwarz wie die Wände ihres Gefängnisses.
Und doch war diese Öffnung, so klein sie auch war, etwas, das ihr eine gewisse Hoffnung gab – zumindest für einen kurzen Moment. Solange sie erkennen konnte, ob es außerhalb ihrer Mauern Tag oder Nacht war, fühlte sie sich als Teil der Welt – jener Welt, die so nah und dennoch unerreichbar jenseits dieser Mauern lag.
Ihr richtiger Name war Rosalinda. Ro-sa-lin-da! Doch nicht einmal ihre Mutter hatte sie jemals so gerufen. Sie nannte sie, wie viele Freier später auch, immer nur ›Rosi‹.
Das Fieber ließ sie jetzt sogar nach ihrer Mutter rufen – nach der Frau, die sie das erste Mal einem fremden Mann vorgestellt hatte.
Eines Tages, als sie gerade vierzehn geworden war und von der Schule nach Hause kam, saß er mit ihrer Mutter am Küchentisch und betrachtete ihre hagere Gestalt mit einem seltsam prüfenden Blick.
„Rosi, Schätzchen“, hatte ihre Mutter beiläufig gesagt und etwas warmen Reis auf den Teller gefüllt, „Ezio Garrido ist zu Besuch gekommen. Er ist ein sehr freundlicher Mann. Tu mir den Gefallen und sei ein wenig nett zu ihm. Kannst du das für deine liebe Mama machen, meine kleine Rosi?“
Die Frage war nie wirklich eine Frage gewesen, und so blieb es nicht bei Ezio – er war lediglich der Erste in einer langen Reihe von Männern, die sie alle auf dieselbe Weise anschauten, wie er es getan hatte.
Bedauerlicherweise stimmte es, was Rosalinda inzwischen schmerzhaft herausgefunden hatte: Eine Frau vergisst ihren ersten Liebhaber nie. Auch sie hatte Ezio Garrido nie vergessen – weder seine Hände noch seine Stimme noch seinen Geruch nach Tabak und Tequila.
Ihm folgten viele andere, zu denen sie ebenfalls nett sein sollte.
Sie lernte schnell, dass es besser war, folgsam zu sein, um ein paar Dollar mehr und das zufriedene Lächeln ihrer Mutter zu bekommen.
Was wusste sie damals schon vom Leben, wo sie doch selbst kaum eines gehabt hatte?
Also tat Rosi das, was von ihr erwartet wurde.
Und weil sie es nicht besser wusste und es vielleicht der Lauf der Dinge war, blieb sie dabei und verkaufte fortan ihren mageren Körper an jeden, der dafür zahlte.
Als ihre Mutter starb und sie das Dorf verließ, war Rosalinda noch jung genug, um schnell genug Männer zu finden, die bereitwillig ein paar Geldscheine neben das Bett legten.
Es machte sie nicht reich, war aber genug, um davon leben zu können.
Was wollte sie mehr?
Die ganze Stadt glühte noch immer unter der Hitze des Tages.
Wer in dieser Nacht auf Abkühlung gehofft hatte, wurde enttäuscht.
Es war warm und stickig in der Zelle, und dennoch fror Rosi, während ihr gleichzeitig der Schweiß über den Körper lief.
Immer wieder schüttelte das Fieber ihren Körper und versetzte sie in einen Zustand, der ihr vorkam, als wäre sie in einem endlosen, drückenden Traum gefangen. Doch es war nicht die Sorte Traum, von der sie oft mit offenen Augen geträumt hatte – wie jener, in dem sie in einem kleinen, glänzenden Auto durch das Land fuhr, um all die schönen Orte zu sehen, von denen die Touristen ihr immer berichteten.
Dieser Traum, der sie jetzt quälte, war dunkler, formloser, ohne greifbare Bilder, die sie lächeln ließen.
Schlaf und Erwachen vermischten sich in ihren Gedanken zu einer neuen, dritten, bisher unbekannten Realität.
Rosalinda hatte sofort gespürt, dass etwas in dem Saft gewesen war, den man ihr gebracht hatte, und wollte ihn aus Furcht nicht trinken – doch der Durst war groß, und der Tag war lang und heiß gewesen.
Saft war ungewöhnlich – sonst gab es immer nur einfaches Wasser.
Wasser und etwas Reis. Manchmal sogar, vielleicht weil es ein Sonntag war, eine Frucht.
Letztlich wurde ihr Durst stärker als die Angst, und sie griff nach dem Glas.
„Mango“, bemerkte sie erfreut, als das Getränk sich angenehm kühl in ihrem Bauch ausbreitete.
Es war ein wohliges Gefühl, das sie seit … wie lange eigentlich nicht mehr gespürt hatte? So sehr sie sich auch in den vergangenen Tagen angestrengt hatte, Rosalinda konnte sich nicht erinnern, wie lange sie schon in diesem Verlies verbracht hatte.
Die Tage waren eintönig und zu unbedeutend, um ihr einen Anhaltspunkt zu bieten. Waren es nur wenige Tage oder schon Wochen, die ereignislos vergangen waren und sich in steter Monotonie aneinanderfügten? Alles verschwamm in der Dunkelheit ihres Gefängnisses und hatte nach einer Weile keinen Anfang und kein Ende mehr.
In den ersten Tagen hatte sie noch versucht, die Nächte zu zählen. Doch dann gab sie es auf – denn nach ihr, da war sie sich ganz sicher, würde ohnehin niemand suchen. Egal, wie lange sie auch verschwunden war: Ihre Freier würden sie nicht vermissen.
Rosi konnte sich nur noch schwach an den Tag erinnern, als dieser große, dunkelhäutige Mann mit dem schwarzen Zylinder, an dessen Seite eine auffällige Hahnenfeder steckte, plötzlich auf der Straße am Hafen vor ihr stand.
Während er beide Hände auf einen Gehstock stützte, beugte er sich leicht vor und verzog seinen Mund zu einem beängstigenden Grinsen.
„Wie ist dein Name?“, fragte er sie.
Als Rosi geantwortet hatte, richtete er sich auf, schaute von oben herab in ihr Gesicht und ließ seine auffallend dünnen Finger unter ihr Kinn gleiten.
„Ich bin Mister Grand T. Bone“, flüsterte er und drückte ihren Kopf leicht nach oben. Dann deutete er mit dem silbernen Knauf seines Gehstocks nach vorn. „Ich bin gekommen, um dich zu holen“, bemerkte er und ging voraus, als wüsste er genau, wo ihre Wohnung war.
Rosalinda wunderte sich über die merkwürdige Formulierung, folgte ihm aber – der Kunde war König, das hatte ihre Mutter ihr schon früh beigebracht.
Wer zahlte, hatte recht. Sonderwünsche kosteten extra – so einfach konnte das Leben sein.
Sie verspürte ein ungutes Gefühl, als er mit fast tänzelnden Schritten vor ihr herging, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen, um zu sehen, ob sie ihm folgte. Er hatte weder gehandelt noch irgendwelche sonderbaren Wünsche geäußert – nur schwach genickt, als sie ihren Preis nannte.
Rosis Gespür riet ihr zur Vorsicht – aber das war bei jedem anderen auch nicht anders. Angst gehörte zum Geschäft und wurde nicht extra berechnet.
Es lag eine tiefe Leere in seinem Blick, eine unerklärliche Bodenlosigkeit. Sie spürte seine prüfenden Augen, als sein Blick, intensiver als gewöhnlich, über ihren Körper glitt.
Mister Grand T. Bone drückte sie mit einer Hand kraftvoll auf den Stuhl, der in der Mitte des Raums stand. Die flackernde Kerze, die Rosi zuvor angezündet hatte, ließ die schwarze Hahnenfeder an seinem Hut schillern. Und obwohl sie im Schatten lagen, nahmen seine Augen im Schein der Flamme ein geheimnisvolles Leuchten an, als er mit langsamen Schritten um sie herumging.
Die knochigen Finger seiner linken Hand strichen dabei sanft über ihren Nacken und ließen Rosi schaudern.
Mit seinem Gehstock drückte er ihren Arm bestimmend nach unten, als sie versuchte, ihr Kleid auszuziehen. Sie hätte gerne alles schnell hinter sich gebracht, blieb aber still vor ihm sitzen. Die Spitze seines Stocks glitt langsam über ihren Kopf hinweg, ohne sie dabei zu berühren. Von einer Schulter zur anderen schwang er ihn wie einen unnachgiebigen Taktstock.
Rosalinda spürte, wie sich etwas, langsam aber stetig, um ihren Hals legte und sie am Sprechen hinderte – am Sprechen und am Schreien!
Aber warum hätte sie schreien sollen? Er hatte sie noch nicht einmal berührt – nur reglos angestarrt.
War es nur eine Einbildung, oder begann der Rum, den sie vor einer Weile getrunken hatte, jetzt seine Wirkung zu entfalten?
Rosi bemerkte die bunten Ketten, die er trug, und ihr Blick glitt an den Perlen hoch zu seinem Hals, wo sie direkt über dem Kehlkopf ein kleines, vernarbtes Zeichen entdeckte – einen verschlungenen Pfeil, der nach oben auf sein Gesicht deutete.
Ein Gesicht, dessen Züge sich deutlich veränderten, je länger sie es betrachtete und je näher er ihr kam.
Langsam öffneten sich seine auffälligen, vollen Lippen und gaben den Blick auf große, makellose Zähne frei.
Es erschien ihr, als grinse er zufrieden, und sein weißes Gebiss hob sich deutlich von seiner dunklen Haut ab.
Rosalinda hatte das Gefühl, direkt in den gierigen Rachen eines hungrigen Tieres zu blicken.
Er streckte die Zunge heraus und fuhr sich damit genüsslich über die Zähne und Lippen. Dann schnellte sie nach vorn und glitt feucht über ihre Nase.
Unfähig, sich zu bewegen, bog Rosi instinktiv ihren Körper so weit wie möglich nach hinten. Sofort spürte sie den Griff seiner festen Hand in ihrem Nacken. Ihr Kopf wurde unmissverständlich wieder dicht vor sein Gesicht gedrückt.
Das beengende Gefühl, das sie schon vorher in ihrer Kehle gespürt hatte und das ihr das Atmen erschwerte, wurde noch intensiver.
Zu ihrer Verwunderung glaubte sie, in seinen Augen Freude zu erkennen, die sich zu engen, feixenden Schlitzen verengten.
Auffällig langsam stülpte er – als würde er einen Kuss von ihr erwarten – die Lippen nach vorn und blies ihr seinen Atem ins Gesicht.
Rosi konnte sich noch genau an den Geruch von frischem Chili erinnern, bevor alles um sie herum schmolz und schwarz wurde.
Wie in einem Traum hörte sie noch seine leise Stimme dicht an ihrem Ohr – und zugleich aus weiter Ferne:
„Du bist meine Gabe für ›Marinette Pye Sèch‹1. Erweise dich ihrer würdig!“
Rosalinda öffnete die Augen.
Dunkle Schatten huschten über die Wände ihrer Zelle, in der sie die letzten Wochen verbracht hatte.
Während all dieser Zeit hatte sie keinen anderen Menschen zu Gesicht bekommen. Niemals hatte jemand diesen Raum betreten oder nach ihr geschaut.
Essen und Wasser wurden, während sie schlief, in kleinen Metallschüsseln neben dem Bett abgestellt.
Reis und Wasser, Wasser und Reis – es wiederholte sich immer wieder, tagein, tagaus.
Gleichzeitig wurde der Eimer mit ihrer Notdurft von einem unsichtbaren Geist regelmäßig entleert.
Mehrmals hatte sie versucht, wach zu bleiben, um vielleicht jemanden zu sehen, mit dem sie hätte sprechen können – vergeblich.
Solange sie wach war, betrat niemand ihr Gefängnis. Das konnte nur bedeuten, dass man sie ständig beobachtete, um immer den richtigen Zeitpunkt für ihre Versorgung abzupassen.
Was hätte sie eine solche Person, wenn sie denn jemals eine getroffen hätte, überhaupt fragen wollen? Sie konnte es nicht sagen.
Würde Flehen helfen?
Hätten ihre Tränen womöglich eine gewisse Milde oder gar Mitleid bei Mister Grand T. Bone bewirkt?
„Wohl kaum“, stellte sie niedergeschlagen fest und begrub die Hoffnung auf Gnade. „Sonst wäre ich wohl nicht mehr hier.“
Die Tage machten sie müde, und die Nächte boten wenig Erholung.
Rosi empfand fast so etwas wie Dankbarkeit für die Drogen, die man ihr offensichtlich in den Saft gemischt hatte. Sie milderten ihre rastlosen Gedanken ein wenig und ließen sie schlafen, schlafen, schlafen.
Aber auch im Schlaf wurde sie von wilden Träumen gejagt.
Zeit war für sie längst bedeutungslos geworden.
Ihre anfängliche, große Angst, das Opfer abartiger Spielchen zu werden, von denen andere Mädchen auf der Straße immer wieder erzählt hatten, war schnell verflogen.
Niemand rührte sie an.
Wasser zum Waschen gab es immer – mehr als Essen. Sogar Seife hatte man ihr gegeben und einen kleinen Lappen. Beides roch intensiv nach fremden Gewürzen.
Doch sie benutzte diese Dinge, weil es die einzige sinnvolle Tätigkeit war, der sie nachgehen konnte.
Sie war sehr dünn geworden, spürte aber dennoch keinen Hunger.
Nur ihre Erinnerungen machten sie traurig – Erinnerungen an das warme Gefühl, das sie immer empfunden hatte, wenn sie mit anderen beim Essen zusammengesessen hatte.
Immer wieder tauchten dieselben Fragen in ihrem Kopf auf. Es waren Fragen, auf die sie, egal wie sehr sie sich bemühte, nie eine Antwort fand.
„Eine Gabe sei sie“, hatte der schwarze Mann gesagt. Für wen sie bestimmt war, hatte Rosi vergessen – ebenso den Namen, den er ihr ins Ohr geflüstert hatte.
Sie wusste nur noch, dass ein kalter Schauer über ihren Körper lief, als sie ihn hörte.
Doch seitdem war Mister Grand T. Bone nie wieder aufgetaucht.
Rosi fürchtete sich vor seinem Anblick.
Dass sie ihn seit jenem Tag nicht mehr gesehen hatte, beruhigte sie anfangs, doch dann verwandelte sich ihre Ruhe bald in Unruhe, weil ihr die Sinnhaftigkeit ihrer Gefangenschaft immer obskurer erschien.
Auch die unübersehbaren Spuren an den Wänden, die eindeutig nicht von ihr stammten, trugen nicht dazu bei, dass sie sich besser fühlte.
Es waren die dunklen Flecken auf den Steinen, die sie beunruhigten. Sie sahen im Zwielicht aus wie getrocknetes Blut – rostbraun, matt und klebrig.
Rosalinda wusste, dass es kein Rost war, doch sie vermied es, weiter darüber nachzudenken, weil sie sich vor der Wahrheit fürchtete.
War sie nicht die Erste in diesem Verlies? Waren die Spuren von jenen, die schon vor ihr versucht hatten, sich den Weg nach draußen mit ihren Nägeln freizukratzen?
Deutlich hörte sie eines Tages, wie Schlüssel im Schloss kratzten.
Die Tür sprang auf, und gelbliches Licht strömte in den Raum.
Es blendete sie, und Rosi hielt sich schützend die Hand vor die Augen.
Zwischen ihren gespreizten Fingern sah sie zwei schemenhafte Gestalten hereintreten. Sie stellten sich neben ihre Liege, packten sie, und zogen sie grob hoch.
Rosi hatte Mühe, aufrecht zu stehen. Ihre geschwächten Beine waren kraftlos und knickten immer wieder ein.
Unablässig zerrten ihr die beiden Gestalten die Arme nach oben, bis sie schließlich, gekrümmt und zitternd, zwischen ihnen in der Mitte des Raumes stand.
Ihr Kopf schmerzte. Er fühlte sich schwer an und kippte immer wieder schlaff zur Seite.
Dann spürte sie den festen Griff einer Hand unter ihrem Kinn – und wusste sofort: Er war wieder da!
Rosi öffnete erschrocken die brennenden Augen.
Wie durch einen wabernden, grauen Schleier aus Tränen erblickte sie das breite Gesicht von Mister Grand T. Bone direkt vor sich.
Er drehte ihren Kopf spielerisch in seiner Hand und zog sie nach vorn, sodass ihr Gesicht ganz nah vor seinem war.
Obwohl sie es erwartet hatte, erschrak sie, als er zu ihr sprach. Wieder konnte sie – wie bei ihrer ersten Begegnung – seinen scharfen Atem riechen.
„Die ›Mambo‹2 erwartet dich“, grinste er und stieß ihren Kopf mit einer kleinen Handbewegung von sich weg.
„Wascht sie und bereitet sie vor“, rief er den beiden Frauen zu, die Rosalinda immer noch festhielten. „Es muss alles perfekt sein!“, befahl er, diesmal lauter.
Mister Grand T. Bone drehte sich um und verließ mit tänzelnden Schritten den Raum.
Rosi schaute ihm ausdruckslos nach.
Die Drogen hatten ihren Körper, für den Männer sonst bereitwillig bezahlt hatten, in eine leere Hülle verwandelt – ein Gefäß, das nun verfügbar war, um neu befüllt zu werden.
Sie spürte, wie die beiden Frauen sie langsam auf den Boden gleiten ließen.
„Zwei Frauen“, dachte sie und wunderte sich, dass diese Erkenntnis sie überhaupt erstaunte.
Unter ihrem Rücken fühlte sie die kühlen, unebenen Steine, während man ihr die schmutzige, stinkende Kleidung auszog.
Sie wuschen sie gründlich mit einem Schwamm, übergossen sie mit kaltem Wasser, rieben ihre Haut mit Öl ein und kleideten sie schließlich in ein dünnes, fast transparentes, weißes Nachthemd, das bis zu ihren Knöcheln reichte.
Danach stützten sie Rosalinda wieder und steckten ihr mehrere schwarze Federn ins Haar.
Zum Abschluss hielt ihr eine der Frauen einen Becher dicht vor das Gesicht.
„Trink!“, forderte sie schroff.
Rosalinda hatte keinen Willen mehr zu kämpfen und trank.
Es war kein süßer Mangosaft wie beim letzten Mal. Dieses Mal war der Geschmack stechend scharf, und es brannte bei jedem Schluck auf ihrer Zunge und in ihrer Kehle.
Sie spürte sofort die große Hitze, die sich augenblicklich in ihrem Bauch ausbreitete und von dort aus ihren ganzen Körper erfasste.
Rosi hatte das Gefühl, von innen heraus zu glühen. Es war, als würde etwas in ihr brennen, ohne wirklich Wärme zu spenden.
Ihr Blick blieb auf den winzigen Schweißperlen haften, die ihre Haut glänzen ließen. Als sie versuchte, sie mit den Fingern zu berühren, griff ihre Hand ins Leere. Erst nach mehreren Versuchen gelang es ihr, sich die Fingernägel so tief ins eigene Fleisch zu pressen, dass sie die weißen Abdrücke sehen konnte – ohne dabei den geringsten Schmerz zu empfinden.
Zeit hatte für sie keine Bedeutung mehr, während sie sich bewegungslos mit der Hand fest in den eigenen Unterarm krallte. Es hätte eine Sekunde oder auch tausend Jahre sein können – es war ohne Belang.
„Es ist so weit“, riss sie die Stimme einer der Frauen plötzlich zurück in die Realität.
Dann griffen Hände nach ihr, um sie hinauszuführen.
„Endlich“, dachte Rosi erleichtert, als sie mit dem erlösenden fünften Schritt durch die Tür ihres Gefängnisses nach draußen trat. „Endlich darf ich wieder nach Hause.“
Dunkelheit umhüllte sie, als sie durch eine weitere Tür in einen großen Innenhof geführt wurde.
Rosi hatte inständig gehofft, dass es Tag wäre – dass nach all der Zeit ohne Licht die Sonne wieder scheinen würde. Nur ein paar wärmende Strahlen hätten ihr schon genügt. Doch die Nacht war so schwarz, dass selbst die Sterne sich zu fürchten schienen.
Dichte Wolken dämpften das fahle Licht des Mondes. Nur wenn der Wind es schaffte, eine kleine Lücke zwischen ihnen zu reißen, konnte man ihn in seiner ganzen Schönheit sehen.
Wie ein rundes Goldstück auf schwarzem Samt hing er über ihr am Nachthimmel.
Rosi blieb stehen, schaute hinauf und bewunderte ihn, als sähe sie den Mond zum ersten Mal in ihrem Leben.
Der große Garten vor ihr war von einer hohen, weißen Mauer umgeben. Sie schien dazu da zu sein, etwas zu schützen und gleichzeitig alles andere draußen zu halten. Drohende Glassplitter auf ihrer oberen Kante funkelten im Mondlicht wie kleine Dolche und unterstrichen eindrucksvoll ihre Funktion.
Rosi nahm es gleichgültig zur Kenntnis. Solche Mauern waren in diesem Land normal. Sie sollten diejenigen fernhalten, die im Leben weniger Glück oder Ehrgeiz gehabt hatten, und verwehrten selbst den Blick nach innen.
Ein Raunen ging durch die Reihen der Menschen, die sich rechts und links in regelmäßigen Abständen an zwei langen Tischen gegenübersaßen. Rosi zählte sie nicht, bemerkte aber die erwartungsvollen Gesichter, die sie anstarrten.
Doch was folgte, war nicht das freudige Aufspringen einer Überraschungsparty mit dem Ruf: „Überraschung!“
Ihre Gesichter waren ernst und angespannt.
Wie auf ein geheimes Kommando erhoben sich alle, als sie Rosi sahen. Sie fassten sich an den Händen, murmelten Unverständliches und stimmten einen monotonen Singsang an, der wie ein Gebet in einer alten Kirche klang. Dumpfe Trommeln begleiteten das Ritual rhythmisch im Hintergrund.
Die großen Feuerschalen am Ende jedes Tisches warfen flackerndes Licht, das die Gesichter im Halbdunkel ließ, während die Palmen hinter ihnen wie Finger in den Himmel wiesen.
Zwischen den beiden Tischen stand ein massiver, länglicher Altar mit einer dicken Holzplatte; in seiner Mitte ruhte ein schmuckloses Trinkgefäß.
Rosi war nicht in der Lage, ihre Gedanken zu ordnen. Sie spürte deutlich die Wirkung des scharfen Getränks, das man ihr kurz zuvor gegeben hatte.
Doch mehr noch als alles andere spürte sie einen unerträglichen Durst in ihrer trockenen Kehle.
Die Hände ihrer beiden Begleiterinnen drängten sie unnachgiebig vorwärts, bis ihre Schenkel gegen die Holzplatte des Tisches stießen. Beide Frauen lösten ihren Griff, traten zur Seite und stellten sich zu den anderen an die seitlichen Tische, die wie für ein gemeinsames Mahl vorbereitet wirkten.
Zum ersten Mal seit Langem spürte Rosalinda wieder Hunger. Sie stützte sich nach vorn gegen die Tischplatte, denn ihre Beine begannen unkontrolliert zu zittern.
Sie konnte die Wärme des Feuers auf ihrer Haut fühlen, gefolgt von dem angenehmen Duft der Blumen und Gewürze, der ihr in die Nase stieg.
Rosi schloss die Augen und erinnerte sich plötzlich wieder an den Geruch der Blumentöpfe vor ihrem Haus, zwischen denen sie als Kind gespielt hatte. Es war schon früh ihre Aufgabe gewesen, sie jeden Abend nach Sonnenuntergang zu gießen und dafür zu sorgen, dass alle Pflanzen genügend Wasser bekamen. – Wasser! Deutlich erinnerte sie sich auch an den Geruch der Ziege des Nachbarn, der immer dann herüberwehte, wenn der Wind richtig stand.
Dieser vertraute Geruch, den sie nie vergessen hatte, ließ sie die Augen wieder öffnen.
Direkt vor ihr, auf der anderen Seite des Tisches, erkannte sie Mister Grand T. Bone im flackernden Feuerschein.
Sein schwarzer Ledermantel und der Zylinder mit der schillernden Feder an der Seite waren unverkennbar. Selbst als bloße Silhouette im Zwielicht reichte sein Anblick aus, sie erschaudern zu lassen.
Genau wie damals auf der Straße am Hafen, als er mit ihr aufs Zimmer gegangen war, war er wie aus dem Nichts aufgetaucht.
Die Flammen der Feuerschalen loderten hell auf, als jemand eine Flüssigkeit hineingoss. Der Geruch von Benzin erfüllte die Luft – scharf und stechend wie ein unheilvolles Parfüm.
Ein kleiner Schritt nach vorn entfernte die letzten Schatten aus dem Gesicht von Mister Grand T. Bone, dessen schwarze Haut mit der Nacht zu verschmelzen schien.
Mit zufriedener Miene ließ er seinen Blick über die Gäste schweifen, die hinter ihren Tischen saßen.
Ein Mann mit einer Schüssel stellte sich neben ihn.
Mister T. Bone griff in das Gefäß hinein, ließ etwas, das wie Salz aussah, prüfend durch seine Finger rieseln, bevor er es mit einer kurzen Bewegung in die Feuerschalen warf.
Das züngelnde, gelbe Licht der auflodernden Flammen und sein effektvoller Auftritt verstärkten die Bedrohung, die von ihm ausging, ohne dass er viel tun musste.
Rosi konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Sie starrte gebannt auf seine Lippen, die monoton etwas in einer fremden Sprache rezitierten.
Ein Gebet? – Vielleicht.
Rosi hatte nie gebetet und kannte sich mit solchen Dingen nicht aus.
„Hoffe nicht auf Gott, mein Kind“, hatte ihre Mutter immer wieder verbittert gesagt, wenn sie abends ihre ›Medizin‹ trank. „Er ist nicht für die da, die ihn brauchen. Sein Platz ist immer an der Seite der Mächtigen. Wenn du reich bist, dann erhört er dich. Wenn nicht, vertraue lieber auf deine eigene Kraft.“
„Aber Reiche kommen nicht in den Himmel“, hatte Rosalinda stets versucht, einen Widerspruch zu finden. „Das hat Pater Fernando uns in der letzten Sonntagsschule gesagt …“
„Er ist ein Hirte seines Herrn“, entgegnete ihre Mutter. „Seine Aufgabe ist es, die Herde so lange zu beruhigen und zusammenzuhalten, bis die Wölfe kommen.“
„Aber was ist mit Jesus?“, hatte Rosi in ihrer Kindlichkeit hoffnungsvoll gefragt und keine Ruhe gegeben. „Er hilft doch den Schwachen.“
„Niemand hilft den Schwachen“, hatte die Mutter schroff geantwortet und die aufkommenden Fragen ihrer Tochter mit einer Handbewegung beiseitegewischt.
Trotzdem hatte Rosalinda nie verstanden, was ihre Mutter meinte, und damals auch nicht weiter darüber nachgedacht. Doch obwohl sie zweifelte, hatte sie jedes Jahr am ›Día de los Muertos‹3 auf dem Friedhof eine Kerze für die Toten angezündet und eine kleine Blume daneben gestellt.
„Man kann nie wissen“, hatte sie mit einem Rest Hoffnung gedacht und ihrer schlichten Gläubigkeit damit Genüge getan.
Jetzt, das spürte sie, hätte sie einen Gott gut gebrauchen können.
Einen Gott, der an der Seite seiner schwachen Kinder steht – einen Gott an ihrer Seite.
Ein bedeutungsvoller, aber auch bedrohlicher Chor begleitete das Erscheinen von Mister T. Bone.
Verstärkt wurde sein Auftritt durch eine zappelnde, schwarze Ziege, die er an einer kurzen Leine dicht neben sich führte.
Das Tier versuchte vergeblich, sich loszureißen, doch es hatte der massiven Kraft von Mister T. Bone nichts entgegenzusetzen.
Unheilvoll schillerten die Federn an seinem Zylinder im Feuerschein, wie Öl auf einer Pfütze.
Erst jetzt bemerkte Rosalinda die zerzausten Hühner, die auf sechs hohen Pfählen rings um den Tisch aufgespießt waren.
Die leblosen Köpfe und Flügel dieser bedauernswerten Kreaturen hingen schlaff herab.
Ihr Gefieder war so schwarz wie die Feder am Hut von Mister T. Bone.
Blut tropfte aus ihren Schnäbeln, rann an den Holzstangen hinab, die ihre Körper durchbohrten, und sammelte sich in kleinen Pfützen auf dem Boden.
Ein großer Hund leckte gierig daran.
„Freunde!“, hörte Rosi Mister T. Bone rufen, während er seinen Stock in die Höhe reckte.
Augenblicklich verstummte der Gesang, und alle setzten sich.
„Freunde!“, wiederholte er theatralisch und ließ seinen Blick unheilvoll über die Menge schweifen.
„In dieser Nacht wollen wir ›Marinette Pye Sèch‹ ehren und ihr ein angemessenes Opfer bringen – auf dass ihre dürren Knochen uns gewogen sind und noch stärker werden!“
Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte es Rosi, als sie den Namen erkannte – den Namen, den sie vergessen hatte.
Es war jener Name, den Mister T. Bone ihr bei ihrer ersten Begegnung ins Ohr geflüstert hatte – damals, als er in ihrem Zimmer um sie herumschlich, sie das Bewusstsein verlor … und erst im Verlies wieder erwachte.
Sie drehte den Kopf in seine Richtung und bemerkte, dass auch er sie nun ansah – während er weitersprach:
„Ich habe euch zu diesem ›Bizango‹4 geladen, um unsere auserwählte ›Loa‹5zu stärken – für die Aufgaben, bei denen wir ihre Unterstützung brauchen. Wir wollen sie mit unseren Opfergaben nähren, um die Wünsche unserer mächtigen Mambo zu erfüllen. Sie selbst kann heute Nacht nicht bei uns sein, doch sie wacht im Geiste über uns und hat mir – ihrem treuen Diener – aufgetragen, das Ritual in ihrem Namen durchzuführen.“
„So soll es sein!“, rief ein Mann inbrünstig von der Seite, und alle stimmten in seinen Jubelruf ein.
„Wir sind deine Diener, Mambo!“, skandierten sie, unterstützt durch die wieder einsetzenden Trommeln. „Wir sind deine Diener!“
Mister T. Bone hob erneut die Hand, und die Rufe verstummten schlagartig.
„Wir haben diese Messe mit Blut begonnen“, rief er und deutete auf die aufgespießten Hühner, „und wir werden sie auch mit Blut beenden!“
Bei seinen letzten Worten übergab er den Stock einer Frau, die neben ihn getreten war, und erhielt von ihr im Tausch ein langes Messer. Triumphierend hielt er es unter dem anfeuernden Klatschen der Gäste in die Höhe.
Augenblicklich setzten die Trommeln und der dumpfe, rituelle Gesang wieder ein – ein Gesang, dessen Bedeutung nur Eingeweihte verstanden.
Rosi wusste nicht, welchem Zweck er diente, und nahm nur verschwommen wahr, wie sich Mister T. Bone rittlings über die eingeschüchterte Ziege stellte und sie fest zwischen seinen Beinen fixierte.
Mit der Hand, die zuvor die Leine gehalten hatte, griff er unter ihren Kopf – und ließ, ohne zu zögern, die scharfe Klinge des Messers durch die Kehle des Tieres gleiten.
Der Schnitt war präzise und tief. Blut spritzte in alle Richtungen, und das tödlich verwundete Tier bäumte sich ein letztes Mal auf. Es stieß einen kläglichen, röchelnden Laut aus, bevor ihm die Beine versagten und sein Körper kraftlos zusammensackte.
Mister T. Bone packte den sterbenden Bock mit festem Griff bei den Hörnern und zog dessen Kopf in die Höhe.
Es war das wortlose Signal für eine Frau, die bis dahin reglos an seiner Seite gestanden hatte, sich vorzubeugen und das Blut, das aus der Wunde des Tieres strömte, in einer Schüssel aufzufangen.
Mit klopfendem Herzen beobachtete Rosi die unfassbare Szene vor ihren Augen – als würde sie durch eine verengte Linse blicken.
Es war nicht das erste Mal, dass sie ein Tier sterben sah – das gehörte zum Leben und war für sie bisher immer eine Notwendigkeit gewesen. Doch das hier war anders. Mit jeder Faser ihres dünnen Körpers spürte sie, dass es hier um mehr ging als nur um Nahrung.
Die bedrohliche Prozedur hatte etwas zutiefst Sakrales und wirkte zugleich abstoßend – wie eine bizarre, lebendig gewordene Szene aus einem Albtraum.
Das blutige Geschehen wurde begleitet von erregten, aufmunternden Rufen der Gäste, die entweder an den Tischen saßen oder hinter ihren Stühlen rhythmisch tanzten und klatschten.
Es schien nicht das erste Mal zu sein, dass sie einem Ritual dieser Art beiwohnten – einem Ritual, das offensichtlich einem festgelegten Ablauf folgte.
Die Frau, die das Blut der Ziege in einer Schale aufgefangen hatte, schritt langsam an den aufgespießten Hühnern vorbei und hielt das gefüllte Gefäß für alle sichtbar in die Höhe.
Mister T. Bone folgte ihr mit beschwingten, tänzelnden Schritten.
Jedes Mal, wenn sie an einem der Pfähle anhielten, tauchte er einen breiten Pinsel in das noch warme Blut und bestrich ein totes Huhn, begleitet von unverständlichem Gemurmel.
Als schließlich alle sechs Hühner mit dem Blut der Ziege bestrichen waren, stellte die Frau die Schüssel auf den Holztisch und trat zurück.
Ihre Arbeit war getan.
Erst jetzt, da die Trommeln immer lauter wurden, nahm Rosi ihren betäubenden, aufdringlichen Rhythmus als Herzschlag der Zeremonie wahr.
Der dumpfe Klang riss sie aus ihren Gedanken zurück in den Garten.
Sie spürte das nahe Meer, hörte seine Brandung, roch die Blumen – und das Blut.
Ihre Apathie wich tiefer Furcht, als sie den rot schimmernden Mond auf dem Blut in der Schale tanzen sah.
Hätte sie gekonnt, wäre sie davongelaufen – doch sie konnte sich nicht bewegen.
Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, drehte sich Mister T. Bone mehrmals um seine eigene Achse.
Als er stehenblieb, traf sie sein Blick – und das diabolische Lächeln schnitt durch sie hindurch wie ein brennender Speer.
Rosi spürte, wie heißer Urin an ihren zitternden Beinen hinunterlief.
Angst schnürte ihr den Bauch zusammen und ließ sie schwer atmen. Ihr Herz trommelte ebenso laut wie die Instrumente der Gäste.
Dann hob der schwarze Mann erneut die Hand, und alle verstummten. Sein Blick blieb starr auf Rosi gerichtet.
„Bizango!“, rief er ihr entgegen, und die Menge an den Tischen johlte vor Vergnügen.
Wieder die erhobene Hand – wieder Stille.
„Ich möchte unsere Opfergaben brennen sehen“, befahl er. „Der Rauch ihrer dunklen Seelen soll heute Nacht den ›Loas‹ den Weg zu uns weisen!“
Mehrere Männer traten vor und setzten die Hühner in Flammen.
Wie sechs skurrile Fackeln säumten die brennenden Tiere den Tisch und tauchten alles in ein gespenstisches Licht.
Der Geruch von Benzin und verbranntem Fleisch vermischte sich mit dem Rauch, der über den Garten zog, und Rosi spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte.
Mister Grand T. Bones Blick wanderte zufrieden über die Gäste seiner obskuren Zeremonie.
„Wir wollen jetzt zu Ehren der ›Loa‹ trinken“, sagte er feierlich, umrundete den Tisch und trat an Rosalinda heran.
Auf dem Weg griff er nach dem Gefäß, das die ganze Zeit in der Mitte des Tisches gestanden hatte.
Rosi spürte erneut seinen scharfen Atem und vermied es, ihn anzusehen.
Wie bei ihrem ersten Treffen brachte er seine Lippen dicht an ihr Ohr.
„Trink“, befahl er, „und das Tor wird sich für dich öffnen.“
Er presste ihr den Becher an die Lippen und zog mit der anderen Hand ihren Kopf weit nach hinten, während er ihr die Flüssigkeit in den Mund goss.
„So ist es brav“, bemerkte er spöttisch, als er sah, dass Rosi schluckte.
Es schmeckte nach Rum und bitteren Kräutern. Ihr Durst wurde davon nicht gestillt, doch sofort spürte sie, wie sich ihr Gesichtsfeld verengte, die Konturen verschwammen und die Geräusche wie aus weiter Ferne klangen.
Rosalinda spürte eine tiefe, lähmende Müdigkeit aufsteigen und sehnte sich danach, endlich schlafen zu dürfen.
Nur verschwommen nahm sie noch wahr, wie Mister T. Bone die Schale mit dem restlichen Blut der Ziege über den Holztisch goss.
Dann spürte sie seinen festen Griff, als er sie mühelos hochhob und langsam auf den Tisch legte.
Rosi war froh, endlich liegen zu dürfen – ihre Angst war so groß geworden, dass ihre zitternden Beine sie ohnehin nicht mehr getragen hätten.
Jemand drehte sie auf den Rücken und drückte ihre Arme fest an die Seite ihres Körpers.
Vor lauter Ehrfurcht über das, was über ihr geschah, vergaß sie fast zu atmen.
Wie in einem lebendigen Gemälde von Van Gogh wirbelten die verrückten Sterne in leuchtenden Spiralen über den schwarzen Himmel, während die Welt um sie herum in einem unwirklichen Tanz versank.
Kapitel 2
Es war noch früh am Nachmittag, als das Handy von Lieutenant Lumen Phoenix klingelte.
Das aufdringliche Geräusch, das weder zur friedlichen Umgebung noch zu ihrer entspannten Stimmung passen wollte, riss sie aus ihren Gedanken zurück in die Realität.
Nur widerwillig öffnete sie die Augen. Ihr Blick wanderte über die hochgelegten Beine zu den Spitzen ihrer Motorradstiefel und weiter hinaus auf das ruhige, türkisfarbene Meer.
Ein warmer Wind, der nach Salz und Algen roch, strich ihr leicht durch das Haar und über das Gesicht.
Die Lederjacke, aus der das störende Klingeln drang, lag in Griffweite neben ihr auf einem Holzstuhl.
Oft hatte sie – wie an diesem Tag auch – die Gelegenheit genutzt, um in einem kleinen Café am Ufer des ›Lake Pontchartrain‹6 die hellen Silhouetten der Boote zu beobachten, die mit geblähten Segeln in Richtung ›Golf von Mexiko‹ glitten.
In der sonst so quirligen Stadt New Orleans fand sie hier, abseits der Touristenströme, eine willkommene Ruhe und Gelegenheit, für einen kurzen Moment zum Durchatmen. Es war ihr bescheidener Versuch, zwischen den Einsätzen wenigstens für kurze Zeit loszulassen und neue Energie zu tanken.
Den Kopf für ein paar Minuten abzuschalten, einen Kaffee zu genießen und die Batterien neu aufzuladen – das war der Plan.
Die Schönheit der Umgebung und die schier endlose Weite des Wassers halfen ihr dabei, unter den schattigen Palmen an nichts zu denken, was auch nur entfernt an die Arbeit erinnerte.
Sie genoss den Anblick der scheinbar endlosen Weite bis zum Horizont.
Ihre Kollegen kannten diese kleine Marotte und versuchten, sie während dieser Stunde möglichst nicht zu stören.
Doch Lumen war schon lange genug bei der Mordkommission, um zu wissen, dass es wirklich wichtig sein musste, wenn sich das Revier trotz ihrer heiligen Zeit meldete.
Und dass es nur das Department sein konnte, stand außer Zweifel – zumal es, zu ihrem Bedauern, momentan niemanden sonst in ihrem Leben gab, der sie tagsüber hätte anrufen wollen.
Der Aufnäher, der direkt unter dem Harley-Davidson-Logo auf ihrer Jacke angebracht war, stellte so etwas wie ihr unfreiwilliges Lebensmotto dar. Unübersehbar stand ›Lone Rider‹ in gestickten Buchstaben auf ihrem Ärmel.
Es lief zwar auf dasselbe hinaus, doch ›Lone‹ hörte sich für sie einfach besser an als ›Alone‹.
Alle im Dezernat kannten und respektierten ihre Angewohnheit, in diesem friedlichen Café, weitab vom Trubel, einfach in der Sonne zu sitzen, um in ungestörter Ruhe eine Zigarette und einen Kaffee zu genießen.
Lumen lehnte sich etwas zurück, griff nach der Tasse, nahm einen kleinen Schluck Cappuccino und zog, mit der anderen Hand das klingelnde Handy aus der Innentasche ihrer Motorradjacke.
Ein skeptischer Blick auf das Display bestätigte ihre Vermutung – der Anruf kam aus dem Revier.
„Ich hoffe, es ist wichtig“, murmelte sie und stellte die Tasse wieder ab.
„Entschuldigen Sie bitte die Störung, Lieutenant, aber es ist gerade eine wichtige Meldung hereingekommen …“
„Breakwater Park, sagen Sie? – Ja, ich weiß, wo das ist“, bestätigte Lumen und warf ihr zu einem dicken Zopf geflochtenes Haar zurück über die Schulter. „Was ist mit Sergeant Guerra? Warum ist er nicht hingefahren? – Okay, verstehe. Sagen Sie ihm, er soll dort auf mich warten. Ich komme direkt hin.“
Sie schob einen Geldschein unter die Tasse, stand auf und ging hinaus zum Parkplatz.
Lumen war nie in Eile – zumindest nicht an diesem Ort. Für sie war es eine kleine Insel der Ruhe. Doch der Anruf hatte die Situation verändert. Er fühlte sich an wie der Vorbote eines Sturms, der mehr mit sich bringen würde als nur Wind und Regen.
Einen Toten zu finden, war in New Orleans für einen Polizisten nichts Ungewöhnliches – schon gar nicht, wenn man im Morddezernat arbeitete. Aber gewöhnlich war es deshalb noch lange nicht.
Dieses Mal jedoch, ohne genau zu wissen warum, spürte Lumen ein Gefühl in ihrem Bauch, das über die übliche Anspannung hinausging. In der Vergangenheit hatte ihr Instinkt sie schon oft gewarnt – und er hatte sich selten geirrt.
Augenblicklich schaltete alles in ihr auf Alarm.
Einige Kollegen, so wurde ihr mitgeteilt, waren bereits vor Ort, um den Fundort zu sichern und Schaulustige fernzuhalten – unter ihnen auch Sergeant Travis Guerra. Ein guter Polizist, von dessen Fähigkeiten Lumen absolut überzeugt war. Sie selbst hatte ihn vor zwei Jahren, trotz einiger Bedenken ihres Captains, auf diesen Posten gesetzt. Guerra war jemand, der ruhig und unaufgeregt an eine Sache heranging, aber dennoch entschlossen genug war, um Ergebnisse zu liefern.
Manchen Kollegen erschien er zu ruhig – zumindest, wenn man ihrem Gerede Glauben schenkte. Lumen war nicht dieser Meinung. Denn sobald er eine Witterung aufgenommen hatte, hing er an einem Verdächtigen wie ein Terrier an seiner Beute und ließ erst dann wieder los, wenn alles geklärt war. Er war jemand, dem sie absolut vertraute – ein Umstand, der in diesem Job buchstäblich überlebenswichtig war. Außerdem, so gestand sie sich heimlich ein, war er der perfekte Ausgleich zu ihrer oft impulsiven Art.
Es wäre nicht nötig gewesen, dass sie selbst zum Fundort fuhr. Doch Lumen war bekannt dafür, sich lieber selbst ein Bild von einer Sache zu machen – einen Eindruck zu bekommen, der über die Berichte auf ihrem Schreibtisch hinausging.
Außeneinsätze waren schon immer ihre Leidenschaft gewesen, und auf die wollte sie auch als Lieutenant nicht verzichten.
Sie drückte auf den Startknopf ihrer Harley, und die beiden Zylinder der Maschine erwachten mit einem tiefen, vibrierenden Grollen zum Leben.
Lumen liebte ihre ›Fat Boy‹. Mit ihr war sie in der Stadt schneller als jeder Streifenwagen – und, was noch wichtiger war: Es machte einfach mehr Spaß.
Der Captain nannte ihre Maschine stets kopfschüttelnd ›den Besen, auf dem sie am Tatort angeflogen kommt‹. Letztlich hatte er, trotz einiger Bedenken, zähneknirschend zugestimmt, das Motorrad als Dienstfahrzeug zuzulassen.
Sie fuhr über den ›Lakeshore Drive‹ in Richtung des ›New Canal Lighthouse‹ und bog dann rechts in die ›Lake Marina Avenue‹ ein.
Vorbei am ›New Orleans Yacht Club‹ führte ihr Weg bis zum äußersten Zipfel des ›Breakwater Drive‹.
Schon von Weitem waren die rot-blau blinkenden Lichter der Streifenwagen zu sehen.
Lumen stellte ihr Motorrad ab, hängte den Helm über den Lenker und ging zur Absperrung, wo ihr bereits ein junger Officer entgegenkam.
„Hallo, Lieutenant“, grüßte er und hob das Absperrband für sie an. „Wieder den Wind um die Nase wehen lassen?“, bemerkte er mit einem leicht neidischen Blick auf ihre Harley. „Die Kollegen erwarten Sie schon. Da drüben auf der Mole“, fügte er hinzu und deutete auf zwei Personen, die etwas abseits auf einer Mole standen, am Geländer lehnten und hinunter auf das Wasser blickten. Einer von ihnen drehte sich kurz um und kam dann direkt auf sie zu.
„Hi, Lumen“, grüßte er sie knapp und deutete mit einer Kopfbewegung auf den wartenden Mann.
„Scheiße, Travis, ich hab nicht mal meinen Cappuccino austrinken können.“
„Tut mir ehrlich leid, Lieutenant“, sagte er mit einem schiefen Lächeln. „Vielleicht sollten wir die Leichen künftig bitten, sich vorher zu erkundigen, ob es in unseren Zeitplan passt. Ich werde das bei unserem nächsten Meeting ansprechen.“
„Klappe, Travis!“
Gemeinsam gingen sie auf den zweiten Mann zu.
Nach wenigen Schritten erkannte Lumen ihn: Jason Renner, den leitenden Rechtsmediziner des Distrikts.
Zum Glück baumelte sein Dienstausweis zwischen einem glänzenden Peace-Zeichen und einem stilisierten Cannabisblatt – sonst hätte man ihm seine Rolle wohl kaum abgenommen.
Inzwischen war er im Dezernat bekannt wie ein bunter Hund und wurde nicht mehr – wie anfangs – an jeder Absperrung von uniformierten Kollegen aufgehalten, die ihn für einen neugierigen Gaffer hielten.
Ein fähiger Mann – allerdings von seiner eigenwilligen, wenn auch attraktiven Erscheinung her nicht das, was man sich unter einem seriösen Forensiker vorstellte.
Für einen außenstehenden Betrachter hatte es den Anschein, als wäre er direkt einem Comic von Robert Crumb7 entsprungen.
Konsequenterweise kleidete er sich auch so, als hätte seine Zeitreise in Woodstock begonnen und er wäre nur versehentlich als unbeteiligter Zuschauer am Tatort gelandet.
Die bunten Klamotten, die Sandalen, die langen Haare und der kurz geschnittene Vollbart vervollständigten das Bild eines in die Jahre gekommenen Hippies.
Viele hatten ihn anfangs unterschätzt, doch Lumen wusste, dass hinter der schrägen Fassade ein scharfer Verstand steckte. Zwar dauerte es bei ihm manchmal etwas länger, bis er zu einem Ergebnis kam, aber wenn er eines präsentierte, stimmte es.
„Also, Jungs, was haben wir?“, begann Lumen ohne Umschweife.
Jason sah sie an, lächelte und schob seine runde ›John-Lennon‹-Brille auf der Nase zurecht.
„Nicht sehr viel“, antwortete er ebenso knapp und deutete auf eine Stelle unterhalb des Holzstegs.
Lumen trat an den Rand und blickte hinab auf eine Böschung, die zum Wasser hin abfiel und in einen nur etwa einen Meter breiten Sandstreifen überging.
Im dunklen Sand lag eine nackte, grotesk verkrümmte Gestalt – der Körper war auf den Bauch gedreht, die Gliedmaßen verschlungen, die Beine bis zu den Knien im Wasser. Die Wellen bewegten sie rhythmisch hin und her.
„Also, Mister Renner – was können Sie mir erzählen?“
Jason sah sie mit seinen grünen Augen gelassen, aber ohne erkennbaren Ausdruck an.
„Nur, dass sie tot ist“, erwiderte er trocken.
„Wow“, sagte Lumen, stellte sich direkt vor ihn und blies den Rauch ihrer Zigarette in seine Richtung. „Und dafür hat Ihre Mutter Sie studieren lassen?“
Jason Renner grinste unverfroren.
„Im Ernst, Lieutenant – was erwarten Sie?“
„Etwas mehr als das, dürfte es schon sein.“
„Ich kann im Moment nicht einmal sagen, welche Wunden relevant sind und welche nur von hungrigen Möwen stammen. Das Salzwasser, die Krokodile und die Fische haben ihr stark zugesetzt.“
„Ihr?“, hakte Lumen nach.
„Eine Frau – definitiv“, bestätigte der Forensiker.
„Okay“, sagte sie nachdenklich und warf einen Blick auf die Tote. „Haben wir schon einen Namen?“
Der Gerichtsmediziner sah sie belustigt über den Rand seiner Brille hinweg an.
„Oh ja“, antwortete er sarkastisch. „Ein kleiner, wasserfester Zettel mit Namen und Adresse hing an einem Bändchen um ihren Hals. Ihre Sozialversicherungsnummer war leider nur sehr undeutlich zu erkennen …“
Lumen sah ihn unbewegt an, nickte leicht und zündete sich ruhig eine neue Zigarette an.
„Habe ich Ihnen heute schon gesagt, dass ich Sie von allen Menschen, die ich kenne, am meisten hasse, Renner?“
Der Angesprochene grinste nur.
„Erstaunlicherweise nicht, Lieutenant“, erwiderte er gelassen.
„Dann wird’s höchste Zeit – immerhin ist es schon Nachmittag.“ Lumen blickte wieder auf die Leiche. „Wieso sagten Sie, die Fische hätten ihr stark …?“
„Na ja – für einen Hai wäre sie ein willkommener Snack.“
„Verstehe“, bestätigte Lumen knapp.
„Dann liegt sie also schon länger im Wasser. Lässt sich sagen, wie lange – ungefähr?“, wollte Sergeant Guerra wissen.
„Keine Ahnung – ein bis zwei Tage, höchstens.“
„Und die Todesursache?“
„Keine Ahnung.“
„Scheiße, Renner! Gibt es überhaupt irgendetwas, das Sie genauer sagen können?“, fauchte Travis Guerra ihn ungehalten an.
„Ja“, antwortete er ruhig, „dass ich die Tote erst auf meinem Tisch haben muss, um mehr sagen zu können.“
„Okay“, warf Lumen beschwichtigend ein, „damit müssen wir wohl leben. Aber Jason – Sie müssen mir bei Gelegenheit mal erklären, warum die Forensiker in den CSI-Serien im Fernsehen jedes Detail einer Leiche herunterbeten können, sobald sie sie gefunden haben – bis hin zur Schuhgröße“, meinte sie mit einem herausfordernden Lächeln. „Und von Ihnen höre ich immer nur: keine Ahnung.“
„Also, die Schuhgröße könnte ich Ihnen auch sagen, Lieutenant – wenn sie noch Füße hätte“, konterte der Gerichtsmediziner trocken und machte ein gespieltes, bedauerndes Gesicht.
„Scheiße“, sagte Lumen leise. „Meinen Sie, dass es sich hier wirklich um den Tatort handelt – oder wurde sie nur angeschwemmt?“
Jason Renner hob kurz den Blick von dem toten Körper und sah hinüber zum Jachthafen, der in einiger Entfernung zu sehen war.
„Würde mich wundern, wenn sie hier umgebracht worden ist“, sagte er ruhig. „Ich nehme eher an, dass die Flut sie angespült hat. Also – bei der Frage nach dem Tatort würde ich sagen: nein, eher nicht. Und ob sie zufällig hier liegt …“ – er zuckte mit den Schultern, ließ den Satz unvollendet in der Luft hängen.
Lumen schaute wieder auf die Leiche, die in diesem Moment von den Mitarbeitern auf eine Bahre gehoben wurde. Dann drehte sie den Kopf und blickte zu Sergeant Guerra hinüber.
„Wenn wir den Todeszeitpunkt kennen, brauchen wir eine Strömungskarte und einen Tidenkalender. Travis, kümmerst du dich bitte darum?“
„Geht klar, Lieutenant“, sagte er und machte sich eine Notiz.
„Warum ist sie nackt?“, fragte Lumen nach einer kurzen Pause gedankenverloren und blickte wieder zu dem Gerichtsmediziner.
„Halten Sie mich für den Mörder, Lieutenant?“, fragte Jason Renner zurück.
„Ich bin mir nicht sicher – warum fragen Sie?“
„Weil nur der Mörder das wissen könnte“, erwiderte Jason mit unbeirrbarer Ruhe.
„Ich meinte eigentlich“, ergänzte Lumen, „ob hier Kleidung von ihr gefunden wurde.“
„Nein, haben wir nicht“, sagte der Gerichtsmediziner. „Keine Kleidung, keine Schuhe, keine Handtasche – nichts.“
„Also kein Unfall.“
„Im Augenblick schließe ich gar nichts aus, Lieutenant. Aber ich halte es eher für einen Unfall, dass wir sie überhaupt gefunden haben. Ich glaube nicht, dass das so beabsichtigt war.“
„Hm“, murmelte Lumen und zog an ihrer Zigarette.
„Aufgrund der Haare und der noch sichtbaren Hautpartien tippe ich auf eine jüngere Latina. Das ist allerdings auch schon alles, was ich Ihnen im Moment sagen kann. Und selbst diese Annahme ist nur eine Spekulation. Tut mir leid – wie gesagt, später mehr. Vielleicht bei einem Kaffee?“, fragte er mit hochgezogenen Augenbrauen und provokantem Grinsen.
„Vergessen Sie’s“, reagierte Lumen kühl und blies ihm eine Wolke aus Tabakrauch ins Gesicht. „In die Kifferhöhlen, in denen Sie sich herumtreiben, setze ich keinen Fuß.“
„Ja dann …“
„Kann man von ihr noch Fingerabdrücke nehmen?“, brachte Lumen das Gespräch wieder auf die sachliche Ebene zurück.
Jason zuckte mit den Schultern.
„Also gut“, schloss Lieutenant Phoenix in der Annahme, dass sie vorerst keine weiteren Antworten bekommen würde. „Bringt sie weg. Und ich will sofort benachrichtigt werden, wenn Sie etwas Neues haben.“
„Sehr wohl, mein Führer und Lenker“, witzelte Jason und verneigte sich theatralisch.
Kapitel 3
Lumen drückte sich den Motorradhelm unwillkürlich noch etwas fester gegen die Hüfte, als sie auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch den lauten und unmissverständlichen Ruf vernahm: „Lieutenant, in mein Büro!“
Diese in ihrer Deutlichkeit kaum zu übertreffende Aufforderung war – und das sicherlich nicht ohne Absicht – schwer zu überhören. Sie war ebenso unüberhörbar, wie der Mann, der sie ausgesprochen hatte, schwer zu übersehen war.
Rodolfo Checo!
„Verdammt“, zischte Lumen.
Sie hatte inständig gehofft, wenigstens heute einmal unbemerkt an der Tür ihres Vorgesetzten vorbeizukommen. Nur widerwillig blieb sie stehen, wandte sich um und steuerte auf sein offenes Büro zu.
Das goldene Schild an der Tür machte nur allzu deutlich, wessen Territorium sie betrat.
›Captain Rodolfo Checo‹ stand in geschwungenen Buchstaben darauf.
Obwohl die Tür offen stand, beugte sich Lumen etwas vor und klopfte leicht gegen den Rahmen.
Wie eine dicke Kröte saß ihr Vorgesetzter hinter seinem Schreibtisch und nebelte den ganzen Raum mit dem Rauch seiner obligatorischen Zigarre ein. Seine auffällige, dunkle Hornbrille war ihm auf der Nase nach vorn gerutscht, und er musterte sie über deren oberen Rand hinweg.
Für Lumen wäre es kaum verwunderlich gewesen, wenn aus seinem breiten Mund plötzlich eine klebrige Zunge hervorschnellen und sie in den Raum hineinziehen würde.
Sie hätte nur zu gern vermieden, jetzt schon Auskunft über einen Fall geben zu müssen, zu dem sie selbst noch keine relevanten Informationen hatte. Zumal sie sich bis jetzt nicht einmal sicher war, ob er überhaupt in den Zuständigkeitsbereich der Mordkommission fiel.
„Kommen Sie rein, Lieutenant“, empfing Checo sie mit einem verdächtig milden Tonfall und unterstrich seine Worte mit einer einladenden Handbewegung.
Er lehnte sich hinter dem ausladenden Schreibtisch in seinem Stuhl zurück. Dabei führte er mit der rechten Hand die halb aufgerauchte Zigarre an die Lippen und ließ den linken Daumen unter seinen Hosenträger gleiten, während er Lumen schweigend in die Augen blickte.
„Captain, ich kann zu dem Fall …“, begann sie, um seinen Fragen zuvorzukommen. „– Es gibt noch keine …“
Checo hob abwehrend die Hand, blies eine dichte Rauchwolke über den Tisch, beugte sich etwas vor und unterbrach ihren Redeschwall.
„Geschenkt, Phoenix – geschenkt“, wehrte er ab und ließ sich weiter in seinen Stuhl sinken.
„Geschenkt?“, fragte Lumen irritiert.
„Ja, vergessen Sie mal den Fall. Ich habe Sie wegen etwas ganz anderem gerufen, Lieutenant.“
Es fiel Lumen schwer, ihren erstaunten Gesichtsausdruck zu verbergen, und sie blickte verunsichert über die Schulter zur Tür.
Erst jetzt bemerkte sie den jungen Mann, der fast unsichtbar in seiner makellosen, dunklen Uniform in der Ecke des Raumes saß und scheinbar wie ein Chamäleon mit dem Bücherregal verschmolz.
Nur sein helles, angespanntes Gesicht hob sich deutlich vor dem hinter ihm hängenden, schon leicht vergilbten Bild des Captains mit dem Bürgermeister ab.
Als sie ihn ansah, erhob er sich, klemmte seine Mütze unter den linken Arm, nahm Haltung an und lächelte ihr stumm entgegen.
„Lumen“, begann der Captain in einem etwas zu vertraulichen Ton, wie sie fand, „bitte setzen Sie sich doch einen Augenblick.“
„Sir, ich habe …“, versuchte sie einen letzten Fluchtversuch.
„Lumen, bitte“, beharrte er und deutete erneut auf den freien Stuhl,vor seinem Schreibtisch.
Seine einladende Geste erlaubte keinen weiteren Widerspruch – ein Alarmsignal, wie Lieutenant Phoenix nur allzu gut wusste.
Denn Rodolfo Checo pflegte seine Anweisungen gewöhnlich kurz, unmissverständlich und im Stehen zu geben. Einmal soll er sogar behauptet haben, dass sowohl vor einem Erschießungskommando als auch vor ihm jeder gefälligst zu stehen habe.
So war die Aufforderung, Platz zu nehmen, verbunden mit seinem befremdlich sanften Tonfall, für Lumen gleichermaßen beunruhigend wie verdächtig.
Erwartungsvoll heftete sie ihren Blick auf den rauchenden Vorgesetzten, während sie sich zögerlich setzte.
„Captain?“
Checo klopfte nachdenklich und betont langsam die Asche von seiner Zigarre ab.
Lumen war dieses theatralische Rauchverhalten von ihrem Vater nur allzu vertraut – etwas, das er sich bewahrt hatte, seit er mit ihrer Mutter von Haiti in die Vereinigten Staaten gekommen war.
Für ihn war es ein Stück Nostalgie, eine Erinnerung an das Leben auf der Insel. Bei ihm war es Lumen vertraut, obwohl sie die Heimat ihrer Eltern selbst nie betreten hatte.
Aber Checo war kein Haitianer. Für ihn war das Rauchen, so vermutete sie, nichts weiter als eine Gewohnheit.
„Lieutenant“, begann er schließlich und zeigte auf den jungen Mann, der nun seitlich neben seinem Schreibtisch Haltung angenommen hatte. „Ich möchte Ihnen Officer Tyler Felix vorstellen. Er wird in den nächsten Wochen in unserem Dezernat mitarbeiten – sozusagen ein wenig reinschnuppern.“
„Okay“, bemerkte Lumen misstrauisch, während sie den jungen Mann prüfend aus dem Augenwinkel musterte.
Sie spürte deutlich, dass Checo noch nicht am Ende seiner Mission war – er befand sich erst mitten in der Ouvertüre.
„Er hat den Wunsch“, fuhr der Captain fort, „die Laufbahn zum Detective einzuschlagen. Und da Sie mein bester Lieutenant sind …“
Seine Zigarre glühte unheilvoll auf.
„Oh nein!“, fuhr Lumen dazwischen und vollendete den Satz ihres Vorgesetzten gedanklich, noch bevor er ihn aussprach. „Auf keinen Fall – kommt gar nicht infrage!“
Der Rauch, der über den Tisch auf sie zukam, wurde zunehmend dichter.
„Lieutenant, ich fürchte …“
„Sir“, unterbrach sie und versuchte, ihren Standpunkt zu verdeutlichen, „ich habe genug zu tun. Da kann ich mich nicht auch noch um einen Anfänger kümmern.“ Ihr Blick glitt zu dem stehenden Mann neben dem Schreibtisch. „Nichts für ungut, Officer, aber ich habe keine Zeit dafür. Gerade eben habe ich einen neuen Fall …“
„Einen neuen Fall?“, fragte der Captain mit gespieltem Interesse.
„Ja, eine Tote am Jachthafen.“
„Am Jachthafen?“
„So ist es, Sir. Und ich habe wirklich nicht …“
„Aber dann können Sie doch sicher jede Hilfe gebrauchen, Lieutenant.“
„Gewiss, aber …“
„Ich weiß, ich weiß, Lumen“, versuchte der Captain nun, einen vertraulicheren Ton anzuschlagen. „Aber Sie würden mir damit einen persönlichen Gefallen tun …“
„Einen Gefallen, Sir?“
Lumen blickte zu dem jungen Mann in der Uniform.
„Officer, könnten Sie uns bitte für einen Moment allein lassen?“, bat sie ruhig.
Der Angesprochene sah unsicher zu Checo, bis dieser zustimmend nickte. Dann verließ Tyler wortlos den Raum.
„Einen Gefallen, Sir?“, wiederholte Lumen ungläubig, nachdem sich die Tür geschlossen hatte.
„Nennen Sie es meinetwegen so“, entgegnete Checo. „Ich wollte es Ihnen nur freundlich vorschlagen. Als Ihr Vorgesetzter könnte ich es auch einfach anordnen – das wissen Sie.“
Lumen legte den Helm auf den Schreibtisch.
„Scheiße, Sir. Ich habe wirklich keine Zeit, mich auch noch um einen Frischling zu kümmern. Und warum nennen Sie das einen ›Gefallen‹? Wo liegt Ihr Interesse an der Sache?“
Der Captain sog bedächtig an seiner Zigarre.
„Na ja …“, stammelte er verhalten, „seine Mutter …“
„Soll das ein Witz sein?“, fuhr Lumen auf.
Checo hob beschwichtigend die Hände.
„Nun regen Sie sich nicht gleich auf. Ich habe zusammen mit seinem Vater bei der Polizei angefangen – das ist schon ein paar Jahre her. Ein enger Freund“, fügte er hinzu und blickte versonnen auf die Glut seiner Zigarre. „Aber er ist inzwischen verstorben, und seine Mutter hat mich jetzt gebeten …“
„Scheiße, Captain!“
„Stellen Sie sich nicht so an, Lieutenant. Er soll wirklich gut sein – ich habe mich erkundigt. Alle beschreiben ihn als sehr zuverlässig und kompetent.“
„Das ist mein Motorrad auch.“
„Ich scheiß auf Ihren Besen, Lumen“, konterte der Captain scharf. „Ich habe der Mutter mein Wort gegeben …“
„Muss ja ’ne tolle Frau sein“, spottete Lumen.
„Ja, ja“, überging Checo die Bemerkung. „Er will Detective werden – irgendwo muss er anfangen.“
„Kann er ja meinetwegen auch – aber warum muss dieses ›Irgendwo‹ ausgerechnet bei mir sein?“
„Weil“, grinste Rodolfo Checo, „Sie nun einmal die Beste sind und er bei Ihnen am meisten lernen kann.“
„Sparen Sie sich Ihren Schleim“, wehrte Lumen ab.
„Dann lassen Sie es mich anders ausdrücken“, entgegnete der Captain kampfeslustig, löschte seine Zigarre im Aschenbecher und richtete sich auf. „Entweder der Officer rutscht hier rein, oder jemand anderes rutscht hier raus – haben wir uns verstanden, Lieutenant?“
Kapitel 4
„Also gut, Officer Felix. Das Sie so heißen, habe ich trotz meiner akuten Schockstarre noch mitbekommen. Gibt es sonst noch etwas, das ich dringend über Sie wissen sollte?“
„Ähm, ich weiß nicht …“, stammelte er.
Wie eine Rektorin, die einen Schüler zum Nachsitzen zitiert, musterte Lumen den jungen Mann und betrachtete skeptisch sein noch recht kindliches Gesicht.
„Großer Gott, sind Sie überhaupt schon volljährig?“, fragte sie trocken und konnte sich ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen.
Tyler Felix richtete sich demonstrativ auf, als müsse er seine Antwort nicht nur verbal, sondern auch körperlich bekräftigen.
„Ich bin achtundzwanzig, Ma’am“, erwiderte er mit einem frechen Grinsen, „und ja, ich rasiere mich sogar schon.“
Lumen trat näher an ihn heran.
„Haben Sie gerade tatsächlich ›Ma’am‹ zu mir gesagt?“, fragte sie gefährlich ruhig.
„Ja, Ma’am“, antwortete Tyler, wobei in seiner Stimme ein deutliches Unbehagen mitschwang. „Es schien mir angemessen“, fügte er mit einem unerwarteten Anflug von Selbstbewusstsein hinzu.
Lumen drehte sich abrupt um, hängte ihre Lederjacke an den Kleiderständer und setzte sich hinter ihren Schreibtisch, ohne Tyler aus den Augen zu lassen.
„Verdammte Scheiße, hören Sie mit dem ›Ma’am‹ auf“, forderte sie scharf und warf ihren Zopf schwungvoll über die Schulter. „Was glauben Sie eigentlich, wie alt ich bin?“, fragte sie mit einem gefährlichen Funkeln in den Augen.
Tyler wusste sofort, dass die Antwort auf diese Frage Fingerspitzengefühl verlangte – besonders bei einer Frau, die offensichtlich älter als fünfzehn war.
„Nun, ähm …“, stammelte er verlegen.
„Für Sie bin ich Lieutenant Phoenix“, stellte sie klar. „Und merken Sie sich eins: Ihr Lieutenant hat kein Alter.“
„Wie Sie wünschen, Ma … – ich meinte, Lieutenant“, korrigierte er sich hastig.
„Achtundzwanzig also?“, fragte Lumen beiläufig.
„Ja, Lieutenant, so steht’s in meinem Ausweis.“
„Und Sie wollen unbedingt Detective werden?“
„Das ist mein Ziel, Ma … äh, Sir“, brachte er zögerlich hervor.
Lumens zusammengezogene Augenbrauen ließen ihn augenblicklich verstummen.
„Sir?“
„Entschuldigung, Ma’am – ist mir nur so herausgerutscht. Ich meinte natürlich Lieutenant … Sir – nein, Lieutenant … Lieutenant“, stammelte er sichtlich verwirrt.
Lumen lehnte sich zurück und schaute amüsiert auf den jungen Mann, der vor ihrem Schreibtisch stand und sich offenbar nichts sehnlicher wünschte, als endlich seine Krawatte lockern zu dürfen.
„Schon gut, schon gut“, sagte sie schließlich, zündete sich eine Zigarette an und grinste. „Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Es gefällt mir – ›Sir‹ ist ab sofort genehmigt.“
Tyler atmete hörbar auf, als die Spannung von ihm abfiel.
„Das macht vieles einfacher, Lieutenant“, sagte er erleichtert.
„Zurück zu meiner Frage“, fuhr sie fort, „Sie wollen also Detective werden?“
„Ja, Sir. Das ist mein größter Wunsch. Sobald ich so weit bin, würde ich gerne die Prüfung dafür ablegen.“
„Ist das Ihr Wunsch oder der Ihrer Mutter?“
„Meiner, Lieutenant. Ganz allein meiner“, antwortete er leicht verunsichert, aber dennoch überzeugend.
„Ich sehe schon“, bemerkte Lumen mit einem amüsierten Unterton, „wir haben noch einiges vor uns. – Sagen Sie mal, Officer, sprechen Sie eigentlich Spanisch?“
„Leider nicht, Lieutenant“, antwortete Tyler zögerlich und fügte entschuldigend hinzu: „Ich komme aus New York.“
„Ach, ein New Yorker?“
„Ja, dort geboren und aufgewachsen.“
„Und in New York spricht man kein Spanisch, oder wie?“, fragte Lumen mit einem leicht sarkastischen Unterton.
„Doch, natürlich. Aber in Queens ergibt sich die Notwendigkeit nicht so häufig wie hier.“
„Hier?“
„Ich meinte hier in New Orleans, Lieutenant“, korrigierte er hastig.