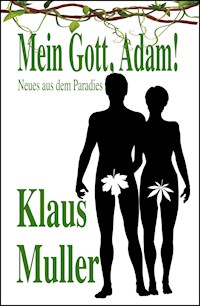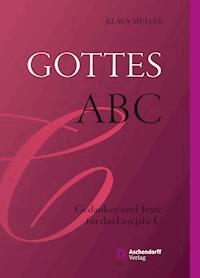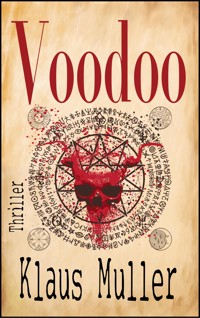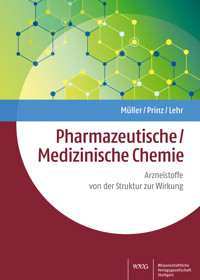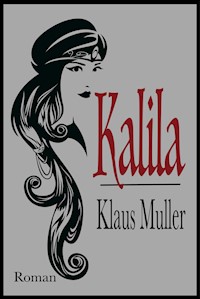Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Campus Einführungen
- Sprache: Deutsch
Die neunziger Jahre gelten als die Dekade der Globalisierung. Kaum ein bedeutendes politisches Thema wird heute noch ohne Bezug auf seine globalen Dimensionen diskutiert. Während man sich rasch auf gängige Definitionsmerkmale der Globalisierung einigen kann - Liberalisierung der Finanzmärkte, grenzüberschreitende ökologische Gefahren, transnationale Fusionen, massenmediale Verbreitung westlicher (Konsum-)Leitbilder, anschwellende Migrationsströme, abnehmende Effektivität nationaler Politik, ist doch ihre Bewertung für Gegenwart und Zukunft höchst vielfältig und kontrovers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2002
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Müller, Klaus
Globalisierung
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2002. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40016-7
Einleitung
Der Begriff der Globalisierung charakterisiert jene rasanten Veränderungen, denen sich die Welt seit zwei Jahrzehnten ausgesetzt sieht. Kein relevantes Thema aus Wirtschaft, Politik und Kultur scheint heute mehr ohne seine weltweiten Bezüge diskussionsfähig. Eine dichte Folge von Weltkonferenzen hat seit den 90er Jahren bewusst gemacht, dass Umweltzerstörung, Armut und Bevölkerungswachstum, die Lage von Frauen und Kindern in vielen Ländern des Südens, die Menschenrechtssituation und der Zustand der schnell wachsenden Megastädte, aber auch die Bedrohung liebgewordener Lebensverhältnisse in den westlichen Ländern verschiedene Dimensionen einer umfassenden Problematik darstellen, die man als Aufgabenfeld einer »Weltinnenpolitik« begreift. Umgekehrt müssen traditionelle Politiker und Parteien erkennen, dass sie ihre innenpolitischen Ziele nicht mehr ohne Rücksicht auf internationale Konstellationen formulieren können. So präsentierte die Sozialdemokratie ihren »Dritten Weg« jenseits deregulierter Märkte und staatlicher Bürokratien als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung, während konservative Parteien die Chance zur Befreiung des Markts aus dem Würgegriff des Steuerstaats gekommen sehen. Jenseits der etablierten Parteien ist eine neue Protestkultur entstanden, die sich als Gegenströmung zum elitären Globalismus von Weltwirtschaftsgipfeln |8|versteht. Grenzübergreifend vernetzte globalisierungskritische Bewegungen, die sich moderner Kommunikationstechniken und Medienstrategien bedienen, haben in kürzester Zeit den öffentlichen Raum repolitisiert.
Jenseits politischer Stellungnahmen lässt sich Globalisierung als die raum-zeitliche Ausdehnung sozialer Praktiken über staatliche Grenzen, die Entstehung transnationaler Institutionen und Diffusion kultureller Muster beschreiben – ein Prozess, der sich durch seinen Tiefgang, seine Geschwindigkeit und seine Reichweite von konventionellen Formen der Modernisierung unterscheidet. Die Dynamik der Globalisierung wird gewöhnlich mehreren sich wechselseitig verstärkenden Faktoren zugeschrieben, insbesondere einer durch Satellitennetzwerke und das Internet bereitgestellten kommunikativen Infrastruktur, sinkenden Transportkosten, der Intensivierung grenzüberschreitender Kontakte sowie exponentiell zunehmenden Finanztransaktionen. Im Vordergrund der jüngeren Literatur zum Thema steht die in den späten 70er Jahren einsetzende Deregulierung der Weltwirtschaft. Expandierende Handelsbeziehungen, die Liberalisierung der Devisen- und Kapitalmärkte, steigende Auslandsinvestitionen und grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse gelten als Indikatoren einer Globalisierungsdynamik, die ein Denken in nationalökonomischen und nationalstaatlichen Kategorien anachronistisch erscheinen lässt.
Zu einer Dynamik von globaler Reichweite konnten sich diese Tendenzen freilich erst in einer radikal veränderten politischen Weltlage zusammenschließen. Die Desintegration des Kommunismus und das »Ende der Dritten Welt« haben die ideologischen Demarkationslinien der Ära des Kalten Kriegs aufgehoben; nationale Entwicklungsmodelle und Sonderwege jenseits des Kapitalismus verloren ihre Überzeugungskraft. Das überragende Weltproblem des letzten Jahrhunderts, die wechselseitige atomare Vernichtungsdrohung, schien einstweilen entschärft|9|. Fast alle postkommunistischen Gesellschaften stimmten in den frühen 90er Jahren in einen »One World Consensus« (Waelbroek 1998) über Prioritäten und Institutionen einer marktfreundlichen Politik ein, der im Jahrzehnt zuvor von Großbritannien und den USA ausgehend zur intellektuellen Leitkultur der Internationalen Finanzinstitutionen und des politischen Establishments avanciert war. Vor diesem Hintergrund überrascht nicht, dass die vorherrschende Sicht die Vorteile der Globalisierung in den Vordergrund rückt: die wohlfahrtssteigernden Wirkungen liberalisierter Märkte, den freien Fluss von Ideen und das Schwinden unversöhnlicher Konflikte in einer immer enger zusammenrückenden Welt.
Die Bereitschaft zur Globalisierung erscheint jetzt als das Kriterium, nach dem die Welt erneut in drei Lager zerfällt: in die reichen Länder, in eine Gruppe von 24 neuen Globalisierern, in der drei Milliarden Menschen leben, und in den nicht globalisierten Rest der Welt mit zwei Milliarden Bewohnern. Während man den neuen Globalisierern vor allem in Asien ein beschleunigtes Wachstum bescheinigt, das seit den 90er Jahren deutlich über dem der traditionellen Industrieländer liegt, bleiben die hauptsächlich afrikanischen Nichtglobalisierer ebenso deutlich hinter beiden zurück (Dollar/Kray 2001).
Die gegenwärtige Globalisierungswelle steht demnach unter dem Vorzeichen eines Politikmusters, das Märkte und wirtschaftliches Wachstum zu universellen Lösungsformeln für gesellschaftliche Entwicklung, für die Überwindung von Armut und Unfreiheit erhebt. Gleichwohl ist sie kein spontanes Resultat anonymer Marktkräfte, sondern Folge einer Kette »politischer Entscheidungen« (IMF 2002b, S. 1). Gerade dadurch lenkt sie die Aufmerksamkeit weit über wirtschaftliche Prozesse hinaus auf die Frage nach der politischen Zuständigkeit für eine neue Kategorie von Weltproblemen (Opitz 2001). Vier Problemgruppen stehen im Mittelpunkt der jüngeren Globalisierungsliteratur:
|10|Umwelt: Ökologische Bedrohungen, die ungleiche Vernutzung knapper Ressourcen und grenzüberschreitende Umweltschäden wurden seit den 70er Jahren thematisiert, ihre desaströsen Langzeitfolgen in verschiedenen Generationen von Weltmodellen simuliert. Heute erscheint die Klimakatastrophe als das natürliche Symbol für jahrzehntelang kaum spürbar voranschreitende Veränderungen, die ohne Gegenmaßnahmen nicht kalkulierbare Gefahren für spätere Generationen nach sich ziehen.
Armut und globale Ungleichheit: Auch ein zweites Problemfeld, nämlich Armut, Ungleichheit und Ohnmacht, ist seit langem bekannt, gewinnt durch die höhere Vergleichbarkeit der Lebenslagen in einer enger zusammengerückten Welt jedoch neue Brisanz: Beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung verfügt über weniger als 2 Dollar pro Tag; einem Drittel der Bevölkerung in den postkommunistischen Ländern hat die kapitalistische Revolution zunächst Verarmung und Unsicherheit eingebracht. Global ist Ungleichheit schärfer ausgeprägt als die im notorisch zerrissenen Brasilien: In einer »Weltgesellschaft« würden 78 Prozent der Bevölkerung zu den Armen, 11 Prozent zur Mittelklasse und 11 Prozent zu den Reichen zählen (Milanovic/Yitzaki 2001, S. 35).
Globale Finanzmärkte: Neu hinzugekommen sind zum dritten systemische Risiken, die in der Funktionsweise deregulierter Finanzmärkte angelegt sind: Auch Länder mit soliden Fundamentaldaten können durch sich selbst erfüllende Krisenerwartungen in einen Abwärtsstrudel gerissen werden, der vom monetären Bereich auf das Wachstum, die Beschäftigung und die innenpolitische Stabilität übergreifen kann. Die »Kollateralschäden« (Maurice Obstfeld) solcher Krisen, die seit den 80er Jahren gehäuft registriert werden, können die Modernisierungserfolge mehrerer Jahre zunichte machen.
|11|Migration: Ein viertes Syndrom resultiert aus Staatszerfall, Informalisierung und gesellschaftlicher Desintegration. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas und der postkommunistischen Region ist die elementare Voraussetzung für gesellschaftliche Integration, nämlich innerer Frieden, nicht gewährleistet. In anderen reagiert die Bevölkerung auf Armut, Ungleichheit und Krisen mit Abwanderung. Zurück bleiben Gesellschaftsruinen, gleichsam die Homelands der globalisierten Zentren, die auf die Überweisungen ihrer Exilanten angewiesen sind.
Ihren gemeinsamen Bezug gewinnen diese Probleme aus dem Missverhältnis zwischen einer staatlich zentrierten Politik und global verzweigten Produktionsbeziehungen, das Immanuel Wallerstein als Definitionsmerkmal des modernen Weltsystems ausmacht. Ihre Dramatik folgt aus einem komplementären Politik- und Marktversagen, das in eine noch weitgehend unbekannte Welt überleitet (Wallerstein 1999, hier S. 73f.): Weder die herkömmlichen Formen der Politik noch die den Märkten zugeschriebene Rationalität haben Lösungen für sie parat. Selbst ein prominenter neoliberaler Beobachter räumt ein, dass »die Mängel der gegenwärtigen Strategie der Globalisierung schmerzlich evident sind« (Sachs 2000, S. 101).
Die sozialwissenschaftliche Debatte zur Globalisierung ist nicht von ungefähr kontrovers und eher durch ein Nebeneinander verschiedener Ansätze als durch theoretisch integrierte Diskussionen gekennzeichnet (s. Held/McGrew 2000). Die Gründe hierfür liegen zum einen in der Komplexität des Forschungsbereichs, in dem sich Entwicklungen verschiedensten Ursprungs überlagern, verstärken oder begrenzen. Diese Komplexität eröffnet Spielräume für unterschiedliche, wenn nicht gegensätzliche Interpretationen, die »Globalisierung« wahlweise als Folge (von ökologischen Schäden, deregulierten Märkten, Unternehmensstrategien, Medien, Internet, Tourismus, Migration) oder als Ursache (von Finanzkrisen, Ungleichheit, Lohnsenkungen, |12|Sozialabbau, Rechtsradikalismus, Fundamentalismus, Demokratieverlust) präsentieren. Strittig ist, ob »Globalisierung« einen Sammelbegriff für mehr oder weniger weit fortgeschrittene Trends abgibt oder aber den Eintritt in ein neues Zeitalter signalisiert, das sich konventionellen sozialwissenschaftlichen Kategorien entzieht. In der einschlägigen Literatur lassen sich zwei konkurrierende Argumentationen ausmachen.
In den Politikwissenschaften und der Soziologie ist ein Globalismus zu beobachten, demzufolge wir uns inmitten einer radikalen Transformation befinden, die mit der »altmodernen Vorstellung von Gesellschaft« aufräumt. Innenpolitische Fragen der Haushaltspolitik und der Besteuerung, der sozialen Sicherheit, Gerechtigkeit und Demokratisierung verlangen radikale Revisionen. Wir sind mit nicht weniger als der Auflösung von Volkswirtschaften, Staaten und der uns bekannten Sozialstruktur, kurz: mit der »Erosion der Moderne« konfrontiert. So stellt die Globalisierung »nicht nur ein weiteres Stadium einer sich stetig weiterentwickelnden Moderne, sondern deren direkte Herausforderung [dar], da sie auf eine neue Form von Gesellschaft verweist« (Albrow 1998, S. 411ff.). Staaten verlieren ihre Souveränität, ortlose Funktionssysteme unterlaufen territoriale Grenzen; der Komfort europäischer Wohlfahrtstaaten ist unter dem kombinierten Druck von Deregulierungswettbewerb und Immigration nicht mehr zu halten. In der »nichtintegrierten Vielfalt der grenzenlosen Welt« werden soziale Klassen und nationalstaatliche Institutionen von ortsungebundenen Identitäten, transnationalen Akteuren und den Netzwerken einer transnationalen Zivilgesellschaft abgelöst (Beck 1998, S. 52ff.). In einer »globalen kosmopolitischen Gesellschaft«, die nationale Feindschaften begräbt, werden die traditionellen weltpolitischen Formen und Strategien obsolet. Transnationales Regieren, das man in der Europäischen Union verwirklicht sieht, wird als Vorschein einer kosmopolitischen Demokratie interpretiert (Giddens 2001, S. 30f.).
|13|Solche »großen Theorien der Globalisierung« (Goldthorpe 2001) haben die Aufmerksamkeit für globale Probleme geschärft und sind über Anthony Giddens in die allgemeine Gesellschaftstheorie eingezogen. In dem Anspruch, die traditionelle Sozialwissenschaft hinter sich zu lassen, laufen sie freilich Gefahr, den Anschluss an die vergleichende Demokratieforschung und Sozialstrukturanalyse und nicht zuletzt an die seit längerem vorliegenden Beiträge zur Weltwirtschaft und Weltpolitik zu verlieren. Zur Analyse der Globalisierungsdynamik werden häufig nur pauschale Vermutungen, Metaphern und Fallbeispiele angeboten. Über die Kausalitäten der Globalisierung herrscht denn auch keine Einigkeit. Während Giddens neben deregulierten Finanzströmen technologische Innovationen, kulturellen Austausch und Regierungsentscheidungen anführt, nehmen andere die neoliberale Utopie freier Märkte für bare Münze oder hängen dem einst Marxisten vorgehaltenen Determinismus an, dass »die globale Ökonomie einen Strukturwandel von Märkten, Institutionen, sozialer Integration und Kultur [erzwingt]« (Münch 2001, S. 68; vgl. Willke 2001, S. 14ff.). Nicht von ungefähr beklagt Niklas Luhmann, dass angesichts der »heterogenen Quellen der ›Globalisierung‹ [...] ein einheitlicher Gesellschaftsbegriff [fehlt]«. Das von ihm angebotene Konzept der Weltgesellschaft, das sich ausdrücklich den regionalen Disparitäten des Erdballs stellen will, begreift als deren Zentren gleichwohl »vor allem natürlich die internationalen Finanzmärkte«. Globale Rationalität konzentriert sich demnach in den altbekannten Ländern des Westens. Der Rest der Welt wird definitionsgemäß unter »regionalen Besonderheiten« verbucht und verschwindet im terminologischen Nebel einer Systemtheorie, die sich an Kausalitäten demonstrativ desinteressiert zeigt (Luhmann 1997, S. 171, 808 u. 163).
Demgegenüber rekonstruiert eine zweite Strömung der einschlägigen Literatur, die sich als Politische Ökonomie der Globalisierung |14|bezeichnen lässt, die Dynamik fortschreitender internationaler Verflechtung aus den Konflikten zwischen politischer Machterhaltung und wirtschaftlichen Interessen an Markterweiterung. Die in sie einfließenden Beiträge sind unterschiedlich motiviert und kommen aus verschiedenen Richtungen: von Wirtschaftshistorikern, aus der Analyse internationaler Währungs- und Handelsbeziehungen, der vergleichenden Kapitalismuskritik und Theorien internationaler Politik.1 Die Interaktion von Staaten und Märkten erfordert diesen Ansätzen zufolge einen dreifachen Blick: Zum Ersten ist zu untersuchen, wie Staaten und politische Akteure die Produktion und Verteilung von Wohlstand und Investitionsstandorten beeinflussen und sich dafür zugleich hinreichende Loyalität in der Bevölkerung sichern. Des Weiteren ist zu fragen, wie sich globalisierte Marktprozesse auf die Verteilung von Macht und Wohlstand zwischen den Staaten und gesellschaftlichen Gruppen auswirken. Ein dritter Aspekt betrifft die politischen Strategien, mit denen Staaten durch Kooperation, die Unterstützung internationaler Institutionen oder durch regionale Integration ihren Aktionsradius ausweiten. »Globalisierung« beschreibt unter diesen Voraussetzungen weder eine kohärente Logik noch einen irreversiblen Zustand. Sie ist ein kontingentes Ergebnis von Marktprozessen, geopolitischen Konstellationen und staatlichen Entscheidungen, die international operierenden Banken und Unternehmen erweiterte Betätigungsfelder eröffnen. Moderne globale Finanzmärkte wären weder aus sich |15|heraus entstanden, noch hätten sie ohne fortwährende politische Interventionen Bestand. Umgekehrt sind die Entscheidungsprozesse erklärungsbedürftig, die Staaten zu Liberalisierungen bewegen, obwohl sie damit ihre politischen Spielräume enger ziehen und Legitimationsentzug riskieren. Die europäische Integration verdankt sich unter diesen Voraussetzungen einer historisch einzigartigen Konstellation, deren Übertragbarkeit auf andere Weltregionen keineswegs sicher ist. Die eilfertige Diagnose der Transnationalisierung von Politik und Gesellschaft wäre demnach alles andere als »kosmopolitisch«, nämlich ein Eurozentrismus, der die funktionalistischen Thesen zur europäischen Integration aus den 60er Jahren allgemein setzt. Einer »Weltgesellschaft« aber fehlen die soziologischen Attribute einer Vergesellschaftung, die immer auch klar definierte Bürgerrechte und sozialintegrative Institutionen voraussetzen würde. Bisher jedenfalls existiert sie wohl nur als »ein reales psychologisches Bedürfnis vieler Autoren, an ihre Möglichkeit zu glauben« (Sklair 1999, S. 150).
Die Komplexität von Globalisierungsprozessen erfordert differenziertere Theorien und Methoden zur Erforschung ihrer häufig nur unterstellten Auswirkungen auf Wachstum, Einkommensverteilung, Steuerbasis, Sozialsysteme und Demokratie. Und es liegt auf der Hand, dass politische und ökonomische Macht eng miteinander verknüpft sind. Die Liberalisierung der Finanzmärkte während der letzten Jahrzehnte war durchaus mit protektionistischer Handelspolitik und ökonomischem Nationalismus vereinbar. Auch gegenüber multinationalen Konzernen, zweifellos eine treibende Kraft der Globalisierung, bleiben Staaten handlungsfähig: US-Gerichte belegen die Tabakindustrie mit Milliardenbußen, die Europäische Kommission kann die Fusionen zwischen Weltkonzernen verhindern. Unternehmen verfügen über keine autonome Macht: Sie müssen sich zur Realisierung ihrer Globalisierungsstrategien auf politische Vorleistungen und internationale Verträge verlassen|16|, die ihnen Rechtssicherheit, Eigentumsgarantien, technologische Standards, eine Infrastruktur und wohlausgebildetes »Humankapital« verschaffen. Allerdings waren und sind Staaten nicht gleichermaßen handlungsmächtig. Eine erfolgreiche Teilnahme an Globalisierungsprozessen beruht auf »komparativen institutionellen Vorteilen« (Soskice 1999, S. 102) und politischen Kapazitäten, die seit je höchst ungleich verteilt sind. Die Risiken der Globalisierung und die Verwundbarkeit durch externe Schocks häufen sich in schwachen oder gescheiterten Staaten. Strukturelle Macht, das heißt die Fähigkeit, die Verlaufsform, die Infrastrukturen und die institutionelle Einbettung von Globalisierungsprozessen zu beeinflussen, konzentriert sich dagegen in den wirtschaftlich führenden Ländern. Angesichts dieser Asymmetrie trifft Alain Touraines Kritik eines entpolitisierten Globalisierungsbegriffs auch den Glaubenssatz eines generellen staatlichen Souveränitätsverlusts: »Er verschleiert die Beziehungen zwischen Macht und Herrschaft« (Touraine 2001, S. 57).
Soviel zur theoretischen Debatte – was aber ist neu an der gegenwärtigen Globalisierung? Beträchtliche Kapitalexporte, ein expandierender Welthandel, transnationale Unternehmen und Bankhäuser, weltumspannende Finanzkrisen und Migrationsströme sind für Wirtschaftshistoriker gewiss keine neuen Erscheinungen. Seit Fernand Braudels Geschichte des Alltagslebens im historischen Kapitalismus ist bekannt, wie die weltweite Arbeitsteilung seit Jahrhunderten auf die Ernährung, Bekleidung und Technologien der europäischen Gesellschaften einwirkte. Bereits Karl Marx erhoffte sich von der Einführung des Telegraphen und dem Ausbau von Eisenbahn und ozeanischer Dampfschifffahrt eine Überwindung gesellschaftlicher Rückständigkeit.
Die signifikanten Unterschiede zwischen früheren und der gegenwärtigen Globalisierungswelle liegen in den politischen Innovationen des 20. Jahrhunderts, an denen sich die folgende |17|Einführung in die Globalisierungsthematik orientiert: in der Universalisierung von Demokratie zum einzig noch tragfähigen Prinzip legitimer Herrschaft und in der Etablierung eines Systems Internationaler Institutionen mit universaler Mitgliedschaft. Dass Globalisierung heute als Bedrohung von Demokratie wahrgenommen wird, zeugt von dem in Teil I dargestellten Dilemma: Einerseits besteht die reale Gefahr, dass Demokratie durch die »Tyrannei der Finanzmärkte« (Barry Eichengreen) und andere tatsächliche oder inszenierte Globalisierungszwänge ausgehöhlt wird (Dahrendorf 2002). Andererseits ist Globalisierung, anders als vor einem Jahrhundert, prinzipiell legitimationsbedürftig: Die jüngste Welle der Globalisierung wird von einer beispiellosen Ausbreitung demokratischer Prinzipien begleitet, so dass die Politik weltweit einem verstärkten Legitimationsdruck ausgesetzt ist. Anders als der neoliberale Common Sense propagiert, sind nicht entfesselte Märkte, sondern die Diffusion von Demokratie und deren prekäre institutionelle Voraussetzungen der Angelpunkt für erfolgreiche Teilnahme an Globalisierungsprozessen.
In Teil II wird der zweite signifikante Unterschied zu früheren Wellen der Globalisierung diskutiert, die sich im Rahmen von historischen Weltreichen, Kolonialreichen und Imperien abspielten. Heute setzt politische Handlungsfähigkeit die Bereitschaft und Fähigkeit zu multilateraler Kooperation voraus. Zahlenmäßig rasch zunehmende internationale Organisationen mit spezifischer Zweckbestimmung wie der Weltpostverein oder partikulare Gemeinschaften wie die Gruppe der sieben großen Industrieländer (G7) können diese Aufgaben nur teilweise ausfüllen. Die Definition und Bereitstellung globaler öffentlicher Güter setzen einen allgemeinen Zugang zu Entscheidungsprozessen voraus, den nur die Universalorganisationen der Mitte des letzten Jahrhunderts gegründeten Vereinten Nationen gewährleisten können. Allerdings wurden die einflussreichsten dieser Institutionen, wie man jüngst selbstkritisch |18|einräumte, »von reichen Ländern für reiche Länder geschaffen« (World Bank 2002, S. 121). Daraus resultiert das zweite große Legitimationsproblem der Globalisierung. Der Weltwährungsfonds und die Weltbank sind satzungsgemäß auf den Wohlstand und die Entwicklungsfähigkeit all ihrer Mitglieder verpflichtet; die wirtschaftspolitische Operationalisierung dieser Ziele aber wird in westlichen Regierungszirkeln festgelegt und zu eigenen Zwecken instrumentalisiert.
I Globalisierung, Staat und Demokratie
1 Demokratie in einer sich globalisierenden Welt
Im Unterschied zu früheren Globalisierungswellen verläuft die gegenwärtige unter dem Vorzeichen von Demokratie und Demokratisierung. Der Zusammenhang von Globalisierung und Demokratie ist jedoch mehrdeutig und spannungsreich. Man kann hierunter zum Ersten die Ausweitung von Demokratie auf zunehmend mehr Länder verstehen, zum Zweiten das Problem, politische Gestaltungsmacht über eine entgrenzte Weltwirtschaft zurück zu gewinnen, und zum Dritten den Versuch, die gesellschaftlichen Beziehungen oberhalb der bestehenden Staaten zu demokratisieren. Die vergleichende Politikwissenschaft konstatiert, dass die Demokratie parallel zur wirtschaftlichen Liberalisierung der beiden letzten Jahrzehnte ihre historisch größte Ausbreitung erfahren hat. Begünstigt wurde dies einerseits durch weltweite Kommunikation und politisches Lernen; andererseits verschlechtern globalisierte Märkte die sozialen Voraussetzungen von Demokratie, indem sie Ungleichheiten verschärfen und die Handlungsfähigkeit von Staaten herabsetzen.
|22|Die Dynamik der Globalisierung wird von ökonomischen Kräften vorangetrieben, doch fallen ihre weitreichendsten Folgen in den Bereich der Politik. Die Fernwirkungen der Globalisierung scheinen das territorial definierte Gewaltmonopol des modernen Staats zu relativieren. Die Deutungen dieses Sachverhalts gehen weit auseinander, sie stimmen jedoch darin überein, dass hiervon nicht nur der Staat, sondern auch die Demokratie betroffen ist. Und hier liegt zugleich der wichtigste Unterschied zum goldenen Zeitalter des wirtschaftlichen Liberalismus zwischen 1870 und 1914. Zur Zeit des Goldstandards wurden außenwirtschaftliche Ungleichgewichte ohne innenpolitische Rücksichtnahmen umstandslos ausgeglichen. Die Souveränität der großen Staaten basierte auf den »souveränen Maklern« einer überstaatlichen Hochfinanz, die Staatsanleihen, Auslandskredite und Finanzierungskontrollen organisierte, das Budgetverhalten kleinerer Staaten überwachte sowie die Finanzverwaltung in den kolonisierten Gebieten und zerfallenden Imperien ausübte. Zahlungsunfähige Staaten wurden gegebenenfalls mit militärischer Gewalt zur Überlassung von Steueraufkommen und Exporterlösen gezwungen (Polanyi 1944, S. 17–37).
Heute dagegen vollzieht sich die Globalisierung unter den Bedingungen der Demokratie und in einer Welt grundsätzlich gleich souveräner Staaten, und genau daraus erwächst ein Legitimationsbedarf, der sich vor 100 Jahren noch nicht stellen konnte. Negative Folgen der Globalisierung werden im parlamentarischen Raum und von politischen Protestbewegungen aufgenommen. Die UN-Charta verpflichtet ihre Mitglieder darauf, internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel und unter Wahrung der Gerechtigkeit beizulegen. Befürworter und Kritiker der Globalisierung beurteilen deren Auswirkungen auf die Institutionen der Demokratie unterschiedlich. Euphoriker begrüßen die gestiegene Mobilität, die verbesserte Kommunikation und die Freiheitsgewinne, an denen prinzipiell |23|alle Bürger und alle Gesellschaften teilhaben könnten. Apokalyptiker sehen die in der wohlfahrtsstaatlichen Demokratie mühsam errungene Zivilisierung des Kapitalismus unter dem Zwang anonymer Weltmarktzwänge dahinschwinden und die Ungleichheit zwischen den Gesellschaften des Nordens und des Südens ins Unermessliche steigen.
Die Demokratietheorie liefert keine direkte Antwort auf das Problem, wie sich demokratische Politik unter globalen Bedingungen gestaltet. Zunächst fragt sich, was Globalisierung der Demokratie überhaupt heißen soll: Ist damit die weltweite Verwirklichung des Prinzips demokratischer Verfassungsstaaten gemeint, oder zielt sie auf die Herstellung einer globalen Demokratie, die von Internationalen Institutionen und transnationalen Akteuren zu tragen wäre? Unzureichend bestimmt ist zum Zweiten der in diesem Kontext verwendete Demokratiebegriff selbst. In den Standardtheorien der Politikwissenschaft wird Demokratie über die Rechtsförmigkeit politischer Entscheidungen im Rahmen von Verfassungsstaaten begründet und die an den Staat gebundene politische Demokratie allen anderen Formen von Mitsprache übergeordnet. Macht, Zwang, Freiheit, Recht, Gerechtigkeit, Gleichheit, Inklusion, Repräsentation und weitere Schlüsselbegriffe der Demokratietheorie wurden mit Blick auf »unseren historischen Ort – den Nationalstaat« entwickelt, wobei die historisch variable Größe eines demokratischen Gebildes »heute für wesentlich größer als eine kleine Stadt und wesentlich kleiner als die ganze Welt« gehalten wird (Sartori 1992, S. 25). Internationale Beziehungen aber werden in der Regel weniger unter dem Gesichtspunkt demokratischer Werte analysiert als aus der Perspektive nationaler Sicherheit, relativer Macht und strategischer Bündnisse. Ist es nun sinnvoll, den an nationalstaatlichen Verhältnissen entwickelten Demokratiebegriff auf die zwischen- oder transnationalen Verhältnisse zu übertragen, die bislang in machtpolitischen Kategorien gedacht wurden? Oder verlangt der globale |24|Kontext eine grundlegende Revision des etablierten Demokratieverständnisses, nämlich seine Ablösung von der partikularen Ordnung der Staaten? Die Teleologie demokratischer Werte und damit der Bedeutungsgehalt von Demokratie gilt als prinzipiell offen (Apter 1991, S. 463). Offen also auch dafür, eine globalisierte Welt in sich aufzunehmen? Lässt sich Demokratie in ähnlicher Weise »deterritorialisieren« wie die »virtuelle Ökonomie« von Finanzdienstleistungen, Wissen und Information?
Die historischen Erfahrungen mit der Herausbildung von Demokratie werfen Licht auf die Möglichkeiten, zugleich jedoch auf die Ambivalenzen und Abgründe, denen die Demokratie in globalen Kontexten gegenüber steht. Robert A. Dahl hat aufgezeigt, wie das moderne Demokratieverständnis durch eine erste Transformation des politischen Lebens im überschaubaren Rahmen der antiken und mittelalterlichen Stadtstaaten entstand und im Verlauf einer zweiten demokratischen Transformation auf die weitaus größere Skala der Nationalstaaten ausgeweitet wurde. Ob sich Demokratie auf die gesamte Staatenwelt ausdehnen, ob sie sich gar auf die Größenordnung transnationaler Institutionen erstrecken könnte, scheint ihm jedoch keineswegs selbstevident. Denn trotz der historischen Variabilität von demokratischer Herrschaft und ihrer Formung durch spezifische soziale und kulturelle Bedingungen insistiert Dahl auf analytischen und empirischen Grenzen dieser Vielfalt. Zum einen sind minimale begriffliche Kriterien unverzichtbar für jede historisch und interkulturell vergleichende Demokratieforschung, die sich der Konsistenz ihres Untersuchungsgegenstands sicher sein will. Ohne solche Kriterien entstünde die Gefahr einer Begriffsdehnung, die das Demokratiekonzept leichtfertig inflationieren würde – eine Gefahr, die Dahl insbesondere in der im weiteren beschriebenen, historisch beispiellosen »Dritten Welle« der Demokratie vermutet (Dahl 1989, S. 2). Zum anderen ist die Übertragung von |25|Demokratie auf neue Größenordnungen alles andere als trivial. Der Druck grenzübergreifender Herausforderungen auf die Politik ist schneller gewachsen als die zu ihrer Bearbeitung entwickelten Institutionen. Bereits die Europäische Union, das fortgeschrittenste Projekt regionaler Integration, scheint unzureichend legitimiert und hat die sarkastische Bemerkung provoziert, dass sie sich selbst nicht als Mitglied aufnehmen könnte, da sie nicht über die einem Beitritt vorausgesetzten demokratischen Strukturen verfügt. Erst recht stellt sich die »Paradoxie der optimalen Größe« für Versuche, die über die regionale Ebene hinaus auf eine Demokratie im globalen Maßstab zielen – eine Paradoxie, die Dahl früh auf eine treffende Formulierung gebracht hat: »Von jeder Größe unterhalb derjenigen der ganzen Welt [...] lässt sich zeigen, dass sie kleiner ist als der Umfang eines dringenden Problems. [...] Doch je größer das Gebilde, desto größer die Kosten einheitlicher Regelungen, desto größer die Minderheiten, die nicht zum Zuge kommen, und desto geschwächter die Kontrolle durch den einzelnen Bürger« (Dahl 1959, S. 372f.).
1.1 Dritte Welle der Demokratie?
Zweifellos also ist Demokratie kein zeitloses System, das sich unabhängig von seiner sozialstrukturellen, kulturellen und historischen Umwelt isolieren ließe. Ebenso wie die Politik ist die in unserer Zeit ablaufende Transformation der Demokratie allerdings ein passiver Spielball des Weltmarktgeschehens. Demokratische Prinzipien waren und sind aktiv an der Umgestaltung der globalen politischen Landschaft beteiligt. In diesem Sinn hat Dankwart Rustow die weltweiten Demokratisierungsbewegungen des zurückliegenden Jahrzehnts als eine globale Revolution charakterisiert (Rustow 1990). Der beschleunigte |26|Zusammenbruch autoritärer Regime seit den 90er Jahren wurde nicht ohne Ironie als umgekehrter Domino-Effekt bezeichnet: Die Steine kippten nicht, wie stets befürchtet, von Osten nach Westen, sondern in gegenläufiger Richtung. Nicht der Kommunismus, die Versprechungen der Demokratie erwiesen sich als »subversive Ideologie« (Gaddis 1997, S. 200).
Die epochale Bedeutung dieser Veränderungen erschließt sich freilich erst, wenn man sie auf den weiter gefassten Zeithorizont bezieht, den Samuel Huntington in einer der einflussreichsten Studien des letzten Jahrzehnts als einen langgestreckten Zyklus dreier Wellen der Demokratisierung charakterisiert (Huntington 1991). Folgt man dieser Einschätzung, dann nahm eine erste lange Welle der Demokratie ihren Ausgang im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und der Französischen Revolution. Sie setzte sich über die Verkündung der Volkssouveränität zunächst in einigen Staaten des westlichen Europa und in den europäischen Siedlerkolonien in Australien, Kanada und Chile bis hin zu den demokratischen Staatsgründungen in Mittel- und Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg fort. Einer zweiten, kürzeren Welle, die Huntington von 1943 bis 1962 datiert, war die Demokratisierung Westdeutschlands, Österreichs, Italiens und Südkoreas durch die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zu verdanken; im Zuge der Entkolonialisierung schlossen sich Indien, die Philippinen, Nigeria und Jamaika an. Die jüngste Welle der Demokratie folgte auf den Zusammenbruch der mediterranen Diktaturen Mitte der 70er Jahre und setzte sich den 80er Jahren in Lateinamerika, einigen Ländern Afrikas und Asiens fort, um in den demokratischen Revolutionen von 1989 zu kulminieren.