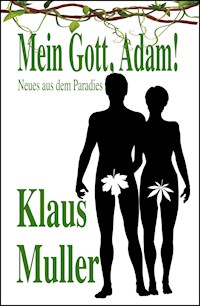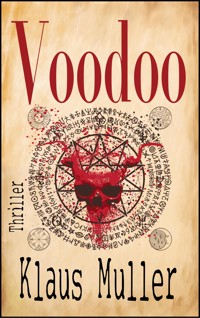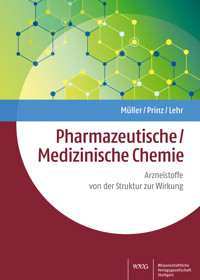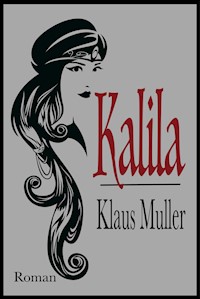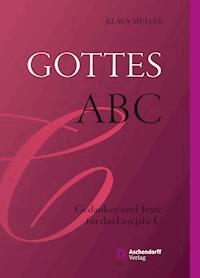
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aschendorff
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Zum neuen Kirchenjahr legt Klaus Müller den dritten Band von Gottes ABC vor. Seine Gedanken, Texte und Impulse folgen dem Rhythmus der Sonn- und Feiertage der katholischen Liturgie. Der Band C setzt ein im Advent 2014. Gemeinsam bilden nun die drei Bände als Gesamtwerk einen reichhaltigen geistlichen Begleiter für die Leseordnung aller Kirchenjahre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des § 54 Abs. 2 UrhG werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen.
ISBN der Printausgabe: 978-3-402-13042-1
ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-402-19763-9
Zum Gedenken an
Prof. Dr. Dr. hc. Thomas Pröpper
* 06.10.1941† 10.02.2015
den Kollegen,
den Meisterdenker der Freiheit,
den Freund wie kein anderer
Inhalt
Vorwort
Advents- und Weihnachtszeit
Erster Advent: Lk 21,25–28.34–36 (und 1 Thess 3,12–4,2)
Zwischen Kairos und Parusie
Zweiter Advent: Lk 3,1–6
Wahrheit aus der Wüste
Dritter Advent: Lk 3,10–18 (und Zef 3,14–17; Phil 4,4–7)
Einfach so
Vierter Advent: Lk 1,39–47
Wider das Missverstehen
Weihnachten – in der Nacht: Lk 2,1–14
Was von Weihnachten blieb
Weihnachten – am Tag: Joh 1,1–18
Logos
Fest des Heiligen Stephanus: Apg 6,8–10; 7,54–60
Grundgesetz
Fest der Heiligen Familie: Lk 2,41–52
Ganz glauben
Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr: Num 6,22–27 [zugewählt]
Im Segen geborgen
Zweiter Sonntag nach Weihnachten: Joh 1,1–18
Fascinosum Wort
Erscheinung des Herrn: Mt 2,1–12
Gottes Plan
Fest der Taufe des Herrn: Lk 3,15–16.21–22 und Apg 10,34–38
Ernst gemeint
Fasten- und Osterzeit
Erster Fastensonntag: Lk 4,1 –13; 9,28b–36 und Pss 1; 2; 149; 150
Doppeltor und Echo
Zweiter Fastensonntag: Gen 15,5–12.17–18
Einprägsame Verheißung
Dritter Fastensonntag: Ex 3,1–8a.13–15
Theologie der Unruhe
Vierter Fastensonntag: Lk 15,1–3.11–32
Der Gott der Verlorenen
Fünfter Fastensonntag: Joh 8,1–11
Letzte Stellprobe
Palmsonntag: Lk 22,14–23.56
Einen Tod feiern?
Gründonnerstag: Ex 12,1–8.11–14
Wenn Gott „ich“ sagt
Karfreitag: Jes 52,13–53,12
Um das wahre Bild von Gott
Osternacht: Systematische Meditation [Hintergrund: 2 Kor 5,20]
Sprechende Leerstellen
Ostertag: Systematische Meditation
Gottes Siegelstein
Ostermontag: Lk 24,13–35; Apg 2; 1 Kor 15; Offb passim
Hervorgelockte Geschichte
Zweiter Ostersonntag: Joh 20,19–31
Osterwunder – mehrfach
Dritter Ostersonntag: Joh 21,1–14
Ostern nach Ostern
Vierter Ostersonntag: Joh 10,27–30
Gott, christlich
Fünfter Ostersonntag: Joh 13,31–33a.34–35
Neues Gebot
Sechster Ostersonntag: Joh 14,23–29 und Offb 21,10–14.22–23
Von der Würde und der Heimat
Christi Himmelfahrt: Apg 1,1–11; Hebr 9,24–28; 10,19–23; Lk 24,46–53
Dreifacher Fingerzeig
Siebter Ostersonntag: Joh 17,20–26 und Eph 20,4–10 [zugewählt]
Gottes Bild
Pfingsten: Gal 5,15–25 (26)
Was der Geist tut
Pfingstmontag: Röm 8,14–17
Worauf Ostern hinauswill
Dreifaltigkeitssonntag: Spr 8,22–32
Etwas von Gott
Fronleichnam: Lk 9,11b–17
Unterbau
Sonntage im Jahreskreis
Erster Sonntag im Jahreskreis: [siehe Fest der Taufe Jesu]
Zweiter Sonntag im Jahreskreis: Joh 2,1–12
Programmatischer Einstand
Dritter Sonntag im Jahreskreis: 1 Kor 12,12–14.27
Wer wir sind
Vierter Sonntag im Jahreskreis: Lk 4,21–30
Jesus am Rand
Fünfter Sonntag im Jahreskreis: Lk 5,1–11
Wort von drüben
Sechster Sonntag im Jahreskreis: Lk 6,17.20–26
Lebenslehrer
Siebter Sonntag im Jahreskreis: Lk 6,27–38
Gottes-Logik
Achter Sonntag im Jahreskreis: 1 Kor 15,54–58
Was wir suchen
Neunter Sonntag im Jahreskreis: Lk 7,1–10
Jesuanische Seel-Sorge
Zehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 7,1–17
Wenn der Tod zum Leben gehört
Elfter Sonntag im Jahreskreis: Lk 7,36–8,3
Evangelium von der verlorenen Fassung
Zwölfter Sonntag im Jahreskreis: Lk 9,18–(24) 26
Christus und die Christen
Dreizehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 9,51–62
Ruf in die Paria-Existenz
Vierzehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 10,1–12.17–20
Stellenausschreibung
Fünfzehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 10,15–37
Die Mitte
Sechzehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 10,38–42
Christliches Handeln
Siebzehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 11,1–13
Einübung in die Absichtslosigkeit
Achtzehnter Sonntag im Jahreskreis: Koh 1,2; 2,21–23 und Lk 12,13–21
Lob der Zufälligkeit
Neunzehnter Sonntag im Jahreskreis: Lk 12,32–48
Was uns richtet
Zwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 12,49–53
Wenn Glaube brennt
Einundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 13,22–30
Zwischen Ernst und Zuversicht
Zweiundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 14,1.7–14
Von der christlichen Demut
Dreiundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 14,25–33
Hierarchie auf evangelisch
Vierundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 15,1–10 [Kurzfassung]
Gottes Unverhältnismäßigkeit
Fünfundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 16,1–13
Kluges Engagement
Sechsundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 16,19–31
Einstellungssache
Siebenundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 17,5–10
Falsch gebetet
Achtundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Dtn 8,7–18 und Lk 17,11–19
Vom Danken
Neunundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 18,1–8
Was beim Beten geschieht
Dreißigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 18,9–14
Vor Gott: Verkehrte Welt
Einunddreißigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 19,1–10
Gottes Überschwänglichkeit
Zweiunddreißigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 20,27–38
Jesu Ewigkeit
Dreiunddreißigster Sonntag im Jahreskreis: Lk 21,5–19
Auf Hoffnung gestellt
Vierunddreißigster Sonntag im Jahreskreis – Fest Christkönig: Lk 23,35–43
Macht von Gottes Art
Ausgewählte Feste
Aufnahme Mariens in den Himmel: 1 Kor 15,20–27a
Heimkehr ins Leben
Erntedank: 1 Tim 6,6–11.17–19
Was reicht
Allerheiligen: Mt 5,1–12a
Verschwenderischer Gott
Allerseelen: Röm 8,14–23 und Lk 7,11–17
Hauch der Versöhnung
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria: Systematische Meditation
Das Einmalige und das Gemeinsame
Vorwort
Mit diesem Band kommt Gottes ABC zum Abschluss. Es war und ist der Versuch, auch in der Sprache der Verkündigung Glaube und Vernunft untrennbar zu verweben. Anders darf in religiös dermaßen produktiv und aufgeladenen Zeiten wie heute von Gott gar nicht mehr gesprochen werden, weil sich christlicher Glaube seit Anfang immer auch als Aufklärung im besten Sinn des Wortes versteht. Doch zugleich soll durch den Einbezug von Stimmen aus der bildenden Kunst, der Musik und der Poesie auch etwas von der Schönheit der christlichen Botschaft aufleuchten.
Viele haben zum Gelingen dieses Großprojekts beigetragen. In besonderer Weise gilt das von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Seminar für Philosophische Grundfragen der Theologie, namentlich Rahel Steinmetz und Georg Pfalsdorf. Meine Sekretärin Monika Epping hat sich – wie auch schon all die Jahre zuvor – mit größtem Elan in den Dienst der Sache gestellt, die ja noch neben dem Alltagsgeschäft gemeistert werden wollte. Das Gleiche gilt von den Schwestern des Klarissenkonvents am Dom zu Münster, die nicht müde wurden, dem Druckfehlerteufel und irgendwelchen dem Autor anzulastenden (im Norden nicht verständlichen) Bavarismen auf der Spur zu bleiben, um sie unerbittlich zu tilgen.
Besonderer Dank gilt schlussendlich auch Herrn Dr. Bernward Kröger vom Aschendorff Verlag, der das ABC-Projekt über Jahre mit Akribie und größtem Interesse verfolgt und begleitet hat.
Mir selbst ist in den Jahren an der Vorbereitung der drei Bände klar geworden, dass die derzeitige Leseordnung aus der Bibel im Rahmen der katholischen Liturgie einer dringenden Revision bedarf, gerade im Umgang mit dem Alten Testament. Diese einzulösen wird meiner Generation nicht mehr beschieden sein. Aber zumindest war es mein durchgängiges Bemühen, das Neue Testament als den ersten Kommentar zum Alten Testament zur Geltung zu bringen und so den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens gerecht zu werden.
Regensburg/Münster, am 03. Juli 2015,
dem Fest des Hl. Apostels Thomas, des produktiven Zweiflers
Klaus Müller
Advents- und Weihnachtszeit
Erster Advent: Lk 21,25–28.34–36 (und 1 Thess 3,12–4,2)
Zwischen Kairos und Parusie
— Nachdenklicher Anfang —
Mit dem heutigen Sonntag beginnt der Advent. Er macht den Anfang im Kreis des Kirchenjahres, mit dem wir die Geheimnisse des Glaubens feiern. Trotz der unguten Entleerung so vieler Zeichen und Bräuche des Glaubens und trotz der Hektik, die sich nicht wenige immer noch machen in den Wochen vor Weihnachten, – trotzdem haben diese adventlichen Tage etwas Besonderes an sich: das warme Licht der Kerzen in der Dunkelheit, grüne Zweige, ein leises Lied – das macht nachdenklicher als sonst; und wenn einer nicht ganz abgestumpft ist, rührt es ihn in der Seele an.
— Unerwartete Ouvertüre —
Seltsamerweise steht am Beginn des Advents in der Liturgie ein Evangelium, das gar nicht zu dem Gefühl zu passen scheint, das wir mit diesen Tagen verbinden. Aber das ist nur scheinbar so: In Wirklichkeit redet uns das Evangelium am ersten Tag des Kirchenjahres – gleichsam wie die Ouvertüre am Beginn eines musikalischen Werkes – davon, was sich wie der rote Faden durch das ganze Kirchenjahr zieht: vom Grund unseres Glaubens und von der Kraft, die in ihm wirkt.
— Wenn die Welt einstürzt —
Da spricht Jesus von Zeichen am Himmel, vom Tosen des Meeres, davon, dass die kosmischen Kräfte erschüttert und die Menschen vor Angst vergehen werden. Wie immer in der Bibel steht dabei das, was als äußeres, sichtbares Geschehen erzählt wird, als Sinnbild für die inneren Dinge, von denen die Rede ist. Und das ist hier in diesem Evangelium – so steht es da – die Angst. Sie alle wissen, wie das ist, wenn man Angst vor etwas hat, Angst um jemanden, auch um sich selbst vielleicht: Da fällt einem die Decke auf den Kopf; der Himmel mit den Sternen, das ganze Gewölbe unserer Ideale und Orientierung bricht ein: Der Boden unter den Füßen scheint nicht mehr verlässlich zu tragen, buchstäblich untergehen fühlen wir uns in der Angst wie in einem uferlosen, tosenden Meer, dem nichts Einhalt gebieten kann. Wenn wir Schuld auf uns geladen, wenn wir schwere Fehler begangen, einen lieben Menschen verloren oder schlimm versagt haben, da wird uns so, als ob wir vergehen müssten. Nicht nur einmal im Leben stürzt dem Menschen die Welt ein, manchmal so oft, dass er gar nicht mehr leben kann.
Aber ganz eigenartig verbindet unser Evangelium die Erschütterung durch die Angst mit einem Versprechen: Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nahe! Dann werdet ihr den Menschensohn mit Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Mit diesem alttestamentlichen Sinnbild vom gottgeschickten Retter aus aller Not meint das Evangelium: Wenn Dir, Mensch, alles aus der Hand gleitet, wenn Du nichts mehr hast, um Dich selbst zu sichern und Dir etwas vorzumachen; wenn Du Dich nicht betäubst – durch Rausch und Trunkenheit –, und auch nicht mit der Geschäftigkeit des Alltags die Angst überspielst, sondern sie Dir eingestehst, dann kommst Du vor Deine eigene Wahrheit, eine Wahrheit, die Dich frei macht.
— Christlicher Spannungsbogen —
Diese urchristliche Erfahrung hat übrigens im 20. Jahrhundert eine ganz eigenwillige, faszinierende Wirkungsgeschichte entfaltet, denn sie wurde für einen der größten wie auch umstrittensten Denker der Zeit zu einem der Dreh- und Angelpunkte seiner Beschreibung von Welt und Leben: Martin Heidegger. Heidegger hat nämlich 1920/21 als junger Privatdozent in Freiburg Vorlesungen über den Ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki und über ein Buch der Confessiones des Augustinus gehalten. Das hatte gar nichts damit zu tun, dass da ein Philosoph herumzutheologisieren versuchte. Heidegger hatte zwar nach dem Abitur zunächst ein Theologiestudium begonnen, dieses aber nach vier Semestern abgebrochen, weil er immer mehr zu der Überzeugung gelangte, dass die katholische Theologie seiner Zeit mit ihrem neuscholastischen Begriffsapparat das nicht zu erfassen vermochte, was in den Worten des Neuen Testaments als urchristliche Lebenserfahrung festgehalten ist: dass nämlich das faktische Leben, das Leben so wie es wirklich und eigentlich ist, nicht im Horizont der platonischen Philosophie, sondern der urchristlichen Erfahrung entdeckt worden sei: die Einmaligkeit seiner Situation, in die es durch das Kommen Christi gestellt ist, den Kairos, und andererseits sein Gefährdetsein, sein Ausgerichtetsein auf die Zukunft, nämlich das Wiederkommen Christi, die Parusie. Der erste Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, aus dem auch die zweite Lesung vorhin stammte, ist übrigens die älteste erhaltene Schrift des Urchristentums, das älteste Stück des Neuen Testaments, sodass dort unmittelbarer als in den anderen Schriften der Originalton dieses ursprünglichen Glaubensbewusstseins laut wird – man merkt das übrigens auch an der Fremdheit, die für Leserinnen und Leser von heute nicht wenige Passagen dieses Paulusbriefes durchzieht, so etwa, wenn an einer Stelle von der Posaune Gottes die Rede ist, die die Toten weckt und mit ihnen die Lebenden auf den Wolken in die Luft entrückt oder Ähnliches. Aber weil die Theologie mit erborgten Mitteln, mit platonischen und aristotelischen Kategorien an die ihr aufgegebene Sache herangeht, verfehlt sie das, was sie eigentlich weitersagen sollte. Und darum muss sich nach Heideggers Überzeugung die Philosophie an die Aufgabe machen, jene ursprüngliche Wahrheit über den Menschen und das Leben authentisch zu Gehör zu bringen. Gerade in dieser frühen Auseinandersetzung mit der urchristlichen Lebenserfahrung hat Heidegger auch die Bahnen ausgelotet, auf denen später die Grundgedanken seines großen Werkes Sein und Zeit zur Entfaltung kommen sollten. Und einer der Leitgedanken dort lautet, des Menschen Leben sei im tiefsten ein „Sein zum Tode“.
— Trost und Hoffnung —
Damit hatte sich der Philosoph freilich unbeschadet des urchristlichen Motivs im Ansatz weit vom Christlichen entfernt. Denn die Glaubenden haben nie aufgehört, diese Botschaft vom Ausgespanntsein des Lebens nach vorne auch als Trost und Hoffnungswort zu verstehen. Wenn Du anerkennst, ganz und gar ungesichert zu sein, dann wird Dir wie von selbst aufgehen, was allein Dir Hand gibt und Boden unter den Füßen: der Menschensohn. Das meint: Wo nichts mehr in meiner Macht steht, bleibt mir, Mensch zu sein, wie Gott es gedacht hat: also die Menschlichkeit.
Was Menschlichkeit ist, das wissen Christinnen und Christen von dem Menschen aus Fleisch und Blut, den das Evangelium, weil er so ist, wie er ist, den Menschensohn nennt: Jesus von Nazareth. Das Gottvertrauen und die Güte, die ihn beseelten, sie haben gemacht, dass seine Menschlichkeit Menschen durch und durch ging, manchmal so sehr, dass einer durch seine bloße Gegenwart gesund geworden ist, wenn er zuvor von der Angst zerrissen gar nicht mehr er selber hat sein können. Jesu Gottvertrauen und seine Güte, die haben Menschen ermutigt, neu anzufangen mit Gott und mit sich. Die haben ihnen die Kraft gegeben, die Not ihres Lebens menschlich zu bestehen – und manchmal auch sogar des Sterbens noch, dasjenige von lieben Menschen und das eigene einmal, ohne in der Angst unterzugehen. Gott zu trauen wie Jesus und ein wenig auch nur von der Güte zu leben, für die er steht, das macht stark gegen das Chaos, das die Angst anrichtet. Und das lässt einen am Ende auch vor dem bestehen, an dem wir alle gemessen werden von Gott: am Menschensohn, an dem also, der Mensch war, wie Gott will, dass Menschen sind.
— Biblischer Adventskalender —
Glaube heißt: Ich lasse den Menschensohn – das, wofür er steht – in mir mächtig werden. Wie das anfängt, das werden wir bald in allen Einzelheiten hören: in den Geschichten von der Geburt des Menschenkindes, in dem der Menschensohn einer von uns geworden ist, um uns auf Du und Du menschlich nahezubringen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Darum auch steht das Evangelium, das sein Kommen verheißt, am Beginn der Zeit, in der wir uns auf das Geheimnis der Menschwerdung, auf Weihnachten vorbereiten. Und das große Zeichen dieser Tage – der Adventskranz – macht vielfältig sichtbar, welche Hoffnung unser Glaube wagen darf: Da ist der Kranz, der nicht Anfang und Ende hat – so treu ist Gott, immer und ohne Ende. Der Kranz ist aus grünen Zweigen gewunden, Lebendiges mitten in der toten Winterzeit – auch da, wo alles aus scheint, gibt es einen neuen Aufbruch. Je länger wir auf den Menschensohn warten, desto mehr Kerzen entzünden wir – desto heller wird es in uns und um uns. Und die bunten Bänder am Kranz lassen uns ahnen, dass den Christinnen und Christen trotz der Not, die ihr Leben treffen mag, Freude kein Fremdwort wird. Darum auch beendet Paulus seinen Ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki unter anderem mit den Worten:
… ermutigt die Ängstlichen,
nehmt euch der Schwachen an,
seid geduldig mit allen!
Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergilt,
sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun.
Freut euch zu jeder Zeit!
Betet ohne Unterlaß!
Dankt für alles, das will Gott von euch,
die ihr Christus Jesus gehört!
Löscht den Geist nicht aus! …
Prüft alles, behaltet das Gute!
Das ist gleichsam ein biblischer Adventskalender – lauter kleine Fenster aus Worten in das Geheimnis geborgenen Lebens hinein. Wenn wir auch nur das eine oder andere daraus ein wenig in unseren gelebten Werktag zu übersetzen suchten, hätte wir mit diesem Advent einen neuen Anfang mit dem Glauben gemacht.
Zweiter Advent: Lk 3,1–6
Wahrheit aus der Wüste
— Von der Macht der Bilder —
In den Jahren, da ich als Seelsorger im Gefängnis tätig war, habe ich erst eigentlich verstehen gelernt, was Bilder bedeuten. Die Wände jedes Haftraums wurden für mich zum Bilderbuch der Seele dessen, der darin untergebracht war, Bilderbuch seiner Träume, seiner Ängste, der Hoffnungen. Bilder auch zum Betäuben: Pin-up-Girls ohne Ende aus den Boulevard-Magazinen; Poster von muskelstrotzenden Kinohelden; auf einer sonst kahlen Wand einzig das Hochglanzfoto einer Sportlimousine. Hie und da einer, der sich ein Marienbild übers Bett heftete. Und ganz oft Fotos von Freund oder Freundin, von Ehemann oder Ehefrau und von den Kindern. Bilder sind wichtiger für uns als Worte: Durch Bilder prägt sich unauslöschlich ein, wenn Dinge geschehen, die uns zuinnerst treffen. In Bildern formt sich, was wir hoffen und fürchten. Für alles, was uns wichtig ist, finden und schaffen wir Bilder.
— Bilderbuch zum Evangelium —
Kein Wunder, dass es darum auch so etwas wie ein Bilderbuch zu den Worten des Evangeliums gibt: Das sind die Heiligen. Wie sie sind und leben, dadurch machen sie sichtbar, was Gott und Glaube, was Reue, Liebe und Freiheit heißt: Sie machen ihr Leben zu einem Bild für all dies. Die Adventszeit, in der wir stehen, und ihre Botschaft, die haben ein solches kleines Bilderbuch gleichsam ganz für sich. Vier Seiten hat es: Am vierten Dezember ist der Gedenktag der Heiligen Barbara, am sechsten feiern wir den Heiligen Nikolaus, immer wieder, besonders am achten Dezember, denken wir an Maria, die Gottesmutter, die persönlich ganz in der Erwartung Jesu, also adventlich gelebt hat. Ja, und heute begegnet uns im Evangelium die Gestalt, die noch enger als die anderen drei zum Advent gehört: Johannes der Täufer. Sein Bild prägt diese adventlichen Tage wie kein anderes.
— Die Täufer-Wahrheit —
Das Evangelium nennt den Täufer Vorläufer Jesu, und dieser selbst sagt über Johannes, er sei der größte je von einer Frau Geborene unter den Menschen – also derjenige, der als Mensch, von unten, der Wahrheit von oben, die Jesus verkünden wird, am nächsten kommt. Und was ist das für eine Wahrheit, die Johannes verkörpert und darum dann auch predigt? Seine Wahrheit gipfelt in dem Satz: Kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Wie kommt Johannes zu dieser Botschaft? Das sagt uns das Evangelium durch das, was es über Johannes erzählt.
Auf das Jahr genau und mit Namen berichtet Lukas, wann Johannes aufgetreten ist: Tiberius regiert als Kaiser, Pontius Pilatus ist Statthalter von Judäa, Herodes, Philippus und Lysanias haben die ringsum liegenden Fürstentümer inne. Und in der Region haben Hannas und Kajaphas das Sagen. – Da erging das Wort Gottes an Johannes. Dieser eine Satz macht all die Großen von soeben, die Herren und Herrschaften und Hochwürden zu Statisten. Sie alle verfügen nicht über die Wahrheit. Rang und Titel verbürgen sie nicht. Wahrheit geschieht einzig zwischen Gott und dem Menschen, der auf ihn hört, der nach innen ganz Ohr ist, was ihm die Stimme des Gewissens zu sagen hat.
Das alles sagt Lukas also nicht bloß, um ein Datum zu fixieren für das öffentliche Auftreten Jesu, von dem er erzählen will. Stattdessen führen diese scheinbar so äußerlichen Angaben sozusagen senkrecht in die Innenwelt des Evangeliums: Palästina stand damals unter Fremdherrschaft, Herr des Landes ist der römische Kaiser Tiberius, von dem die römischen Geschichtsschreiber das Bild eines misstrauischen, grausamen, genusssüchtigen Herrschers entworfen haben; der südliche Teil des Landes wird vom Statthalter Pontius Pilatus verwaltet, bekannt als rücksichtslos, bestechlich, gewalttätig. Die Politiker aus dem eigenen Volk – Herodes, Philippus, Lysanias – waren mächtig nur von des Kaisers Gnaden, Speichellecker und Hofschranzen logischerweise; und die geistlichen Autoritäten, die Hohepriester Hannas und Kajaphas, wussten sich mit aalglatter Diplomatie und Opportunismus über lange Jahre an der Macht zuhalten. Ganz abgesehen davon, dass Galiläa, dieser hinterste Winkel Israels, den unzweideutigen Ruf hatte, das Glasscherbenviertel der damals bekannten Welt zu sein –; da erging das Wort Gottes. Mitten in dieses Gewirr von Machtmissbrauch und Gekungel, von Schleimerei und Niedertracht begibt sich Gott mit der Berufung des Johannes. Nicht in einem windstillen Winkel heiliger Welt will er sich einlassen auf die Menschen und ihre Geschichte, sondern dort, wo es zugeht, wie man so sagt. Evangelium – gute Nachricht – ist das. Nicht von hoch oben in der Hehre majestätischen Glanzes meldet sich Gott zu Wort, sondern inmitten der Unansehnlichkeit, die die Welt der Menschen prägt: wo geschachert und getreten wird, gelogen und betrogen. In diese Welt – in diese unsere Welt – stellt Gott sich mitten hinein, bar allen Schutzes und aller Rüstung. Das ist das Vorzeichen, unter dem uns Lukas mit der Geschichte vom Leben Jesu von dem Gott erzählt, der sich nicht zu gut ist für diese Welt; ein Gott, der sich eher zum Narren machen lässt für die Welt, als sie fallen zu lassen; einer, dem seine Ehre nichts wert ist, wenn es um die Menschen geht. So heruntergekommen ist er im wörtlichsten Sinn des Wortes. Keine Religion der Welt hat je von ihrem Gott so sprechen dürfen. Die Gebildeten der Spätantike wie ein Kelsos empörten sich über eine solche Geschmacklosigkeit. Christinnen und Christen müssen so reden von Gott.
— Verstörende Unmittelbarkeit —
Das fällt uns im Übrigen gar nicht leicht – wahrzunehmen, dass Gott uns so unmittelbar nah sein will. Viel lieber hätten wir ihn doch gern hoch oben auf Altären und Podesten. Da störte er uns nämlich nicht so sehr. Kein Wunder darum, dass das an Johannes ergehende Wort dieses Gottes für die Menschen als Ruf zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden laut werden muss. Sünde kommt ja von sondern, ab-sondern, für mich allein sein wollen. Umkehren bedeutet: einverstanden sein, dass Gott mit meinem Leben – so wie es ist – zu tun hat.
Und wo Menschen eben dies zulassen, da bahnt sich etwas an, was Lukas nur noch durch die uralten, jahrhundertelang geschliffenen Worte des Propheten Jesaja zu sagen vermag: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken … Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
In der Wüste, sagt das Evangelium, erging Gottes Wort auch an Johannes. Die Wüste hat für alle Juden und Jüdinnen bis heute eine einzigartige Bedeutung. Sie erinnert an den Auszug aus Ägypten ins gelobte Land hinüber, der durch die Wüste führt, und auch an die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Wüste ist der Ort der Gottesbegegnung, Ort der Entscheidung, der Reinigung. Dort in der Wüste lenkt nichts mehr ab vom Wesentlichen, da kann man sich nichts mehr vormachen. In der Wüste wird alles weggebrannt von der sengenden Hitze, weggeschliffen von den Sandstürmen, was nicht wirklich hält und Bestand hat – äußerlich sowieso und innerlich erst recht. Noch heute bestätigt das jeder, der durch eine Wüste gewandert ist. Da vergehen die Sprüche und die Mätzchen, und die Masken fallen. Die Wüste verwandelt den, der durch sie geht, weil sie ihn vor sich selber bringt, ohne dass er sich drücken kann. Das heißt: wahr werden. Aus diesem Schmelztopf, dem Fegfeuer der Wüste, bringt Johannes seine Botschaft mit – die Art, wie er ab jetzt lebt, und seine Predigt:
Kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden! Wenn es gut ausgehen soll mit uns Menschen, will das heißen, dann muss wirklich bis zum Grund alles anders werden. Dann können wir nicht so weitermachen. Was ihr tut und lebt, ist heil- und gnadenlos. Gerade an den Großen und Mächtigen, die sozusagen den Rahmen bilden für das Auftreten des Täufers, – an ihnen wird das wie in einem Brennspiel sichtbar: in ihren Macht- und Ränkespielen, ihrem giftigen, misstrauischen Gegeneinander, das als einziges, was sie untereinander noch verbindet, die Angst übrig lässt.
Wo Menschen Gottes Ruf an sie beantworten, indem sie sich hinkehren zu ihm, wird ihnen eine Verheißung zuteil: Gräben, die die Welt zerreißen, die uns behindern, werden zugeschüttet, die Barrieren, die uns trennen und einsperren, werden niedergelegt werden. Mit einem Wort: Gott selbst wird seine Gläubigen in die Freiheit führen. So hatte einst Jesaja zu den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft gesprochen und ihre Hoffnung auf eine gottgeschenkte Zukunft entzündet. Lukas sieht diese Verheißung von Neuem sich erfüllen in der Gestalt des Täufers und in Jesus. Der Täufer ist die Stimme, Jesus selbst mit Leib und Leben der befreiende Ruf Gottes, der alle, die ihm trauen, in die Freiheit führt, über alle Hindernisse hinweg. Jesajas Verheißung endet mit den Worten: Und alle Menschen – wörtlich: alles Fleisch – wird das Heil schauen, das von Gott kommt. Das ist wieder so ein Satz, den nur die Gläubigen des Alten und Neuen Bundes sprechen können: Denn Fleisch ist in der Sprache der Bibel Sinnbild für das Vergängliche schlechthin. Aber gerade diesem unserem vergänglichen Leben ist das Heil zugesagt. Nicht für außerhalb oder oberhalb oder jenseits des irdischen Lebens gilt diese Verheißung, sondern für das staubige, manchmal so armselige Hier und Jetzt, in dem wir stehen. Gott mischt sich ein in die Welt und ihre Geschichte, damit wir Menschen aus Fleisch und Blut befreit werden, endlich so zu leben, wie Gott es uns seit Anbeginn zugedacht hat. Das ist Evangelium.
— Advent ansagen —
Überall dort, wo Unfreiheit herrscht – im Politischen, auch in der Kirche, genauso angesichts unfreier Beklemmung über sich selbst –, da überall dürfen, ja: müssen die Christinnen und Christen um der Ernsthaftigkeit ihres Glaubens willen Advent ansagen: Jesaja hat es in Babylon getan, Johannes der Täufer im Israel der Zeitenwende, Lukas im Raum der jungen Kirche, und wir verkünden heute: Gott ist für uns; er geht mit uns um unserer Freiheit willen. Überall. Christsein heißt darum: Ich darf von Gott etwas erwarten. Nicht muss das, was nicht sein soll, immer so bleiben. Ich sehe meiner Zukunft mit brennender Hoffnung entgegen. Und diese Hoffnung hat einen Grund: Ich erwarte den siegreichen Advent des Herrn, der alles, auch die Bruchstücke meines Lebens, zu einem guten Ganzen befreien wird, – ich erwarte ihn, weil er, der das verheißt, schon einmal gekommen, schon einmal ganz heruntergestiegen ist, so sehr, dass er nicht einmal mehr hat Gott sein wollen und darum ein Mensch wurde wie wir. Der Advent, den wir dieser Tage begehen, ist Vergegenwärtigung dieses Grundes, der uns ein Recht gibt, für uns und die ganze Welt zu hoffen. Gott kommt; er hat für uns Zeit. Nehmen darum wir uns in diesen Tagen auch Zeit, um betend unsere Hoffnung auf den Herrn brennender zu machen.
Dritter Advent: Lk 3,10–18 (und Zef 3,14–17; Phil 4,4–7)
Einfach so
— Unerwarteter Empfang —
Ein Mann aus den amerikanischen Südstaaten hatte lange Jahre im Gefängnis einsitzen müssen. Jetzt nahte allmählich der Tag seiner Entlassung. Frau und Kinder hatten ihn nur ganz selten besuchen können, weil sie so weit weg wohnten. Je näher die Entlassung kam, desto mehr zitterte er vor dem Augenblick, da er wieder frei sein würde. Er hatte Angst, ob ihn die Seinen wieder aufnehmen würden, da doch im Dorf jeder wusste, was geschehen war. Deshalb bat er in einem Brief seine Frau um ein Zeichen: Wenn ich heimkehren darf zu Dir, schrieb er, dann häng’ mir ein buntes Tuch in den Apfelbaum auf dem Hügel, den man vom Zug aus am ehesten sieht. Würde er bei seinem Kommen kein Tuch sehen – beschloss er –, dann würde er den Zug erst gar nicht verlassen und nie mehr heimkehren.
Der Tag der Entlassung war da. Schon seit Stunden saß er im Zug mit zugeschnürter Kehle und eiskalten Händen. Ein paar Kilometer waren es noch. Er starrte in die Kurve, die der Zug gerade durchfuhr. Da schoss ihm der Apfelbaum auf dem Hügel in die Augen. Er war mit hunderten bunten Tüchern behängt.
— Bestürzt durch Sympathie —
Gehofft hatte der Mann, vor allem aber gezagt. Er sah die Dinge nüchtern und wusste, was es um ihn war. Würden sie ihn wieder einlassen, ihn, den Gebrandmarkten? Würden sie ihm gnädig ein Plätzchen wieder zugestehen in ihrer ordentlichen Welt? Dass ihm nicht ein Tuch entgegenwehte, sondern hunderte – das hat ihn erschüttert: Sie verzeihen ihm nicht nur, sie heißen ihn willkommen. Sie freuen sich über ihn – weil er er ist, einfach so, ohne dass er die Zuneigung sich verdient hätte. Und eben das ist es, was ihn jetzt erst wirklich freimacht – und endlich froh.
— Das Lied vom durchgestrichenen Urteil —
Ich weiß nicht, ob dieser Mann Christ war – aber wenn: dann hätte er das heutige Evangelium und die Worte des Propheten Zefania wie kein anderer verstanden. Sie hätten ihm ans Herz gegriffen, denn er hätte entdeckt, dass das, was er an sich selber schon hatte erfahren dürfen – nämlich grundlos um seiner selbst willen gemocht zu sein –, dass genau das im Großen schon längst zwischen Gott und der Welt unwiderruflich geschehen ist in Geschick und Geschichte Jesu von Nazaret. Einfach so von Gott geliebt zu sein: Das ist das Urdatum unseres christlichen Glaubens. Deshalb lässt Lukas genau dies den Täufer Johannes – ganz wirklichkeitsgetreu noch in der alttestamentlichen Sprache der Erwartung – proklamieren, bevor Jesus den allerersten Schritt ins Licht der Öffentlichkeit tut. Und erst von jenem Urdatum der zuvorkommenden Liebe Gottes zu uns her vermögen wir zu ahnen, was in Jesus Christus geschieht.
Der Täufer hatte als letzter Prophet des Alten Bundes seinen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen schonungslos vor Augen gehalten, wie die Dinge wirklich stehen zwischen Gott und Mensch. Er hatte sie erschüttert in ihrer fahrlässigen Selbstgewissheit. Wir sind Kinder Abrahams, sagten sie, wir gehören ja dazu, was kann uns da schon noch passieren? Johannes hält ihnen knallhart entgegen: Die Tatsache, dass ihr zum Gottesvolk gehört, ist für sich genommen noch gar nichts wert. Sie bekommt erst dann Gewicht, wenn sie auch Folgen hat: Auf die Früchte kommt es an. Nicht der geglaubte Glaube zählt, sondern der gelebte nur. Dass ihr glaubt, das muss sich spiegeln darin, was ihr tut!
Und was sollen wir tun?, fragen den Täufer darauf die verunsicherten Frommen. Er darauf in unmissverständlicher Eindeutigkeit: Teilt eure Kleider und euer Essen mit dem, der nichts hat. Denn ihm steht von den zwei Kleidern, die Du hast, eines – also die Hälfte – zu. Den Zöllnern sagt er: Haltet euch an das Recht! Betrügt niemanden und beutet nicht aus! Und den Soldaten: Hütet euch vor Gewalt! Die Mahnungen des Täufers sind im Grunde genommen selbstverständliche Gebote der Menschlichkeit, die auch denen einleuchteten, die nicht an Gott glaubten. Den Gläubigen bedeuten sie noch mehr. Indem sie ihr Leben diesen schlichten Geboten unterstellen, beglaubigen sie anschaulich, dass ihnen wirklich an Gott liegt und es ihnen ernst ist mit der Heimkehr zu ihm. So wird sein schlichtes, gelebtes Werktagsleben zur Geste der Erwartung, dass Himmel und Erde wieder zusammenfinden.
Die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen freilich empfinden schon das prophetische Plädoyer für die Menschlichkeit aus dem Mund des Täufers als Anbruch einer heilen Zukunft – eines Miteinanders ohne Habsucht, ohne Ausbeutung und Gewalt. So fremd ist ihnen ihr eigenes Menschsein schon geworden, dass sie das im Grunde Selbstverständliche für den Anbruch des Gottesreiches halten. Und – wer dürfte ihnen das verdenken? Wäre es nicht schon ungeheuer viel, wenn es uns wirklich gelänge, einander Mensch zu sein und nicht Wolf? Wäre das nicht unendlich viel, zumal heute, da das nackte Menschsein millionenfach verweigert wird? Wenn wir einer dem andern ein buntes Tuch in den Apfelbaum hängten – dafür, dass wir uns als Menschen anerkennen – wäre das nicht ohnehin das Größte, was wir voneinander erwarten dürften?
Nein, es ist nicht das Größte, das wir in unserer Not mit uns selber und in unserer Not miteinander erwarten dürfen. Es gibt noch Größeres, sagt der Täufer denen, die ihn für den Messias halten möchten. Und haargenau in diesem Moment überschreitet er die Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Ich taufe euch nur mit Wasser, sagt er. Bei mir setzt ihr ein Zeichen, mit dem ihr um die Gnade eines neuen Anfangs bittet. Nach mir kommt jetzt einer, der eure Bitte erfüllt. Aber wie er sie erfüllt! Nicht von oben herab, gerade noch, sodass ihr spürt, wie wenig ihr der Erfüllung eurer Bitte wert seid! Nein, er erfüllt sie so, wie es Gottes Art entspricht – unvergleichlich mit allem, was Menschen sich ausdenken können. Denn er, der da kommen wird, gibt euch nicht bloß ein bescheidenes Zeichen von Gott, dass er es wieder mit euch versuchen will. Stattdessen, sagt Johannes, wird er euch mit Heiligem Geist taufen. Er beschenkt euch mit unendlich Größerem als nur einem Zeichen. Er bringt euch das Größte überhaupt – Gottes Gegenwart selber: Ihr werdet sie spüren als Lebensmacht in euch – das ist Heiliger Geist – und als verzehrendes Feuer, das euer Leben eindeutig macht und alles leere Stroh in euch verbrennt. Mit neuen Augen werdet ihr einander und euch selber sehen. Gottes Atmosphäre wird sich ausbreiten. Sie wird die Herzen endlich ausfüllen, sie werden nicht mehr hohl sein und alles in sich hineinraffen, um endlich einmal satt und still zu werden. Und so werden in Gottes Atmosphäre die Menschen nicht mehr bloß einander nicht Wolf sein. Sie werden entdecken, dass es keine Kluft mehr gibt untereinander – und deshalb in warmherziger Liebe füreinander da sein, ganz nach Gottes Art. Das ist der Unterschied zwischen mir und ihm, sagt der Täufer. Größer als der Unterschied zwischen Herrn und Knecht, so sehr, dass ich es nicht wert bin, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Was der Täufer da unbeholfen zu künden sucht, ist und bleibt das Unausdenkbare. Gott selber wendet sich – alles überspringend – den Menschen zu. Er tut sich mit ihnen zusammen auf Du und Du. Er selber geht in sie ein als der Geist, der sie beseelt. Das heißt: getauft werden mit dem Heiligen Geist. So nah will er uns sein, so sehr treibt es ihn an unsere Seite. Das ist es, was sich in Jesus sichtbar ereignet. Solches freilich lässt sich nicht mehr erwarten, auch wohl nicht mehr erträumen: Es lässt sich nur noch staunend annehmen voll überwältigter Freude. Sie ist das Einzige, dessen wir noch fähig sind, wenn wir 100 bunte Tücher für uns im Apfelbaum erblicken – und nicht bloß eines.
Solche Zuneigung – uns geschenkt einfach um unseretwillen – verträgt kein Abschätzen und Abwägen mehr. Der Prophet Zefanja hatte das geahnt. Er, der das Wunder unserer Rettung durch die unbedingte Nähe Gottes von Ferne hat schauen dürfen, er stimmt deshalb einfach nur noch ein Lied an – das Lied vom Geheimnis Gottes: Er hebt das Urteil gegen euch auf, singt er. Er streicht es einfach durch. Er erneuert seine Liebe zu euch von sich aus; er ist so sehr Liebe, das er nicht mehr warten kann. Er jubelt über euch, weil es euch gibt. Er tut das nicht um eines Zwecks willen, sondern einfach so, weil er so ist, wie er ist. Deshalb schenkt er uns seine rettende Gegenwart. Und eben das ist die Mitte des Evangeliums: unverdient und ungeschuldet unendlich mehr beschenkt zu werden, als wir je hätten hoffen dürfen. Weil Gott der ganz andere ist. Darin also nimmt unsere Rettung ihren Ursprung: darin, dass Gott sich freut über uns. In seiner Freude, dass es Dich und mich gibt, wurzelt das ganze Wunder der Erlösung. Sie besteht darin, dass Gott durch seine Gegenwart unsere Herzen vermenschlicht und uns verschwenderische Liebe lehrt – aus dem Überschwang der Freude heraus, selber so unendlich reich beschenkt zu sein. Das ist jenes Darüberhinaus des Christlichen über alles menschliche Gutsein, das wir Gnade nennen. Die Gnade kommt dabei nicht äußerlich dazu zu unserem Menschsein, sondern sie wurzelt uns ein in dem Boden, auf dem allein unser ganzes Leben zur Entfaltung kommt: Gott selbst.
— Die Freude über Gottes Freude über uns —
Dass Gott sich über uns freut, das ist die Innenseite der Gnade, das Geheimnis, das Gott an unsere Seite treibt. Wer damit Ernst macht, Christ, Christin zu werden, muss genau hier anfangen bei diesem unausdenkbaren Geheimnis. Er wird sich ihm aussetzen und sich mit ihm vertraut machen – betend, schweigend, staunend. Und dann wird einmal der Tag kommen, da beim Betrachten der Freude Gottes an uns in ihm etwas ins Schwingen gerät. Das ist der Tag, an dem eines Menschen Taufe endlich wahr geworden ist. Da geschieht, was uns der Täufer vom kommenden Herrn verheißen hat. Jetzt verstehen Sie, warum Paulus der Gemeinde in Philippi im Vorhinein zu allem, was immer geschehen mag, schreiben kann: Freut euch im Herzen zu jederzeit! Sorgt euch um nichts! Das hat nichts mit schwärmerischer Hochstimmung zu tun. Es ist die Außenseite zuinnerst geschehender Begnadung, der unverbrüchlich geschenkten Heilung unseres Daseins. Wenn es irgendwo Christen, Christinnen gäbe mit bitteren, griesgrämigen Gesichtern, dann hätten die noch nichts vom Evangelium begriffen – selbst wenn sie fromme Gelehrte wären oder Würdenträger mit roten Talaren.
Wer Gottes Geheimnis begriffen hat, der kann nicht mehr anders als froh zu werden. Meist wird seine Freude still im Herzen bleiben. Aber sie wird durchscheinen in dem tiefen Frieden, den dieser Mensch ausstrahlt. Und manchmal wird seine Freude hervorbrechen. Sie wird sich Worte, Lieder und Gesten suchen. Denn sie muss sich einfach mitteilen und möchte anderen Anteil geben an ihrem Grund. Genau daher rührt das Fest der Heiligen Nacht, dem wir entgegengehen. Wenn wir dabei von Friede und Freude reden, dann schwätzen wir – allem Schein zum Trotz – nicht leeres Zeug daher, sondern: Wir deuten mit diesen zwei Worten auf den tiefsten Grund des Geheimnisses Gottes, das auch unser Geheimnis ist, und auf das, was geschieht, wo dieses Geheimnis geglaubt und gelebt wird. Gottes Geheimnis besteht darin, dass ein jeder – wenn er die Bühne des Lebens betritt – immer schon 100 bunte Tücher für sich aufgehängt findet – und nicht bloß eines. Und dass daher auch er selber 100 Tücher aufhängen kann im Apfelbaum für die, die in sein Leben treten.
In wenigen Tagen werden Sie Ihren Weihnachtsbaum schmücken. Vielleicht denken Sie dabei für ein paar Augenblicke an unseren Apfelbaum. Dann würden Sie ahnen: Ihr Christbaum ist Gottes Baum mit den 100 bunten Tüchern für Sie. Und auch Sie schmücken mit ihm einen solchen Baum mit den bunten Tüchern. Alle, die mit Ihnen Ihr Leben teilen, warten auf ihn – schon lange.
Vierter Advent: Lk 1,39–47
Wider das Missverstehen
— Verwechslung —
Kein Grundschullehrer in der Stadt Regensburg versäumt, seinen Schülerinnen und Schülern im Heimatkundeunterricht den alten Spruch beizubringen: Zu Regensburg am Dom, da küsst der Mönch die Nonn’. Anlass zu diesem Vers gibt eine kleine Figurengruppe drinnen in der Kathedrale, rechts vom Hauptportal. Zwei Gestalten mit langen Gewändern und einer Art Kapuze über dem Kopf stehen nebeneinander, fassen sich an der Hand, und ihre Lippen berühren sich gerade. Die Figuren waren jahrhundertelang an der Außenfassade des Domes angebracht. Das Wetter hat seine Spuren in sie eingegraben und die Linien der Gesichter und Gewänder verwaschen. Man könnte die beiden tatsächlich für zwei Leute im Ordensgewand halten. Freilich ist das ein Missverständnis: Sieht man genau hin, so entdeckt man, dass es zwei Frauen sind, Maria und Elisabeth, wie sie sich begrüßen – die Szene, die uns eben das Evangelium erzählt hat.
— Verwaschen oder: Das große Missverständnis —
Kräfte von außen haben die feinen Linien der Gestalten zerstört und so für Spötter zum Ziel kesser Sprüche, für Touristen und Fremdenführerinnen zur kleinen Attraktion werden lassen. Fast will mir scheinen, die kleine Figurengruppe und ihr Schicksal sind so etwas wie ein Gleichnis für Weihnachten heute geworden. Einmal – noch vor dem ersten Adventswochenende – las ich als Schlagzeile in einer großen Tageszeitung: Luxus-Weihnachten wie nie. Deutsche im Kaufrausch. Wahnsinn! – Wahnsinn, das ist wahr. Christinnen und Christen verkünden die Botschaft, dass der große Gott, der allmächtige, sich klein und armselig macht. Er wird Mensch wie wir, um mit eigenem Leib und Leben sichtbar zu machen, wodurch unser Dasein so reich, so gelungen wird, wie es ein jeder, eine jede von uns ersehnt. Und um dieses Unausdenkbare, dieses Überraschende an Gott – sein Kommen zu uns – ein wenig in die Sprache unserer menschlichen Sinne zu übersetzen, suchen sie füreinander kleine Geschenke, die etwas widerspiegeln von jener Wesensart Gottes.
Aber diese Geste hat sich gleichsam losgerissen. Sie ist eine Macht geworden, die alles andere, was eigentlich Weihnachten ist, niederwalzt. Was übrigbleibt, sind Pappendeckelchristkinder, hart am Rand der Karikatur, und darüber hinaus Christbäume mit Nippes dran als Schaufensterdekoration – und die Leute stöhnen schon vorher über die sinnlosen Geschenke, die sie wieder bekommen werden, über den schweren Magen, den die Festessen machen und die Langeweile, die sich nach der Bescherung breitmacht. Ja, wirklich: Wahnsinn! Weihnachten missverstanden. Total.
— Nur aus Zuneigung verständlich —
Dabei wäre es so einfach, alles richtig zu sehen. Die kleine Geschichte von der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth gibt gleichsam die Anleitung dazu. Das Allererste dabei: die Atmosphäre der Zuneigung, der Sympathie, die durch die Zeilen dieser kleinen Szene webt. Zwei, die sich verstehen – wäre Maria sonst wenige Monate vor der Geburt ihres eigenen Kindes den beschwerlichen Weg über die Berge zu ihrer Verwandten gegangen? Beide sind guter Hoffnung. Beide mehr ahnend denn wissend vom Geheimnis Gottes angerührt, ja: in es hineingenommen. Ich denke mir, die beiden haben über persönlichste, intime Dinge gesprochen, die bevorstehende Geburt der Kinder, die Vorzeichen, die andeuten, dass es mit den noch Ungeborenen Besonderes auf sich haben wird – über all das eben, was eine Frau ihrer besten Freundin anvertraut. Das meint der Evangelist, wenn er sagt, Elisabeths Kind, der spätere Täufer Johannes, sei im Leib seiner Mutter gehüpft, als die die Stimme Marias vernahm. Und darum zeichnet er die Elisabeth geradezu als Prophetin, die vom Segen kündet, der auf Maria und ihrem bald zur Welt kommenden Kind liegt – Worte, die wir bis heute im „Gegrüßet seist Du, Maria“ nachsprechen. Und all das ruht auf der Sympathie beider Frauen zueinander. – Nicht anders bei uns, was das Weihnachtsfest betrifft: Man muss Weihnachten mögen, voll Herzlichkeit auf die Gestalten der Weihnachtsgeschichte schauen, auf Maria und Josef, auf Ochs und Esel, die Hirten, die Engel, die Könige und ihre ganze Gefolgschaft, den Stern – und das Kind natürlich. Ohne Zuneigung zu all den Gestalten, gerade den unscheinbaren, versteht man nichts und missversteht alles.
Und das Zweite: Als Elisabeth Maria begrüßt und das Kind in ihrem Leib spürt, da kann sie nur noch staunen, dass sie fast zu stottern beginnt: Und – woher – mir – dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie staunt über die Regung in ihrem Leib – und über ihre eigenen Worte, die sie sich doch nicht ausgedacht, nicht zurechtgelegt hat – gerade so, als hätte ein anderer sie ihr eingegeben. Eben dieses Staunen tut auch uns not, damit uns die Weihnachtsgeschichte nicht zum Rührstück vom Kindelein im kalten Stalle wird. Durch das Staunen bleibt bewahrt, dass sich in allem, was die Weihnachtsgeschichte erzählt – in ihrer an die Seele rührenden Menschlichkeit – Gott selbst, der dreimal Unbegreifliche, für uns ahnbar macht.
— Glaube, der selig macht —
Die herzliche Zuneigung zur Weihnachtsgeschichte und das stille Staunen über sie lassen uns durch alle Entstellung hindurch etwas von der Zartheit empfinden, die alles einhüllt, was Gott tut. Sie behütet uns davor, die Dinge misszuverstehen und banal zu machen. Und zugleich machen sie für uns selber wahr, was Elisabeth über Maria sagt: dass Glaube selig macht.
Weihnachten – in der Nacht: Lk 2,1–14
Was von Weihnachten blieb
— Vierzehn Verse —
14 Verse Evangelium. Es gibt auf der ganzen Welt kein Stück aus einem anderen Buch, das öfter weitererzählt, farbiger ausgemalt, verschiedenster nachgedichtet worden wäre als diese 14 Verse der Weihnachtsgeschichte. Geschah das, weil sie ein sprachliches Meisterwerk sind? Ich glaube kaum. Weil sie so anrührend, so romantisch sind? Keine Spur. Was aber bewegt Menschen dann, derart unermüdlich diesen paar Zeilen nachzuspüren? Was hören sie in der Weihnachtsgeschichte, dass sie sie derart fesselt?
— Moderne Nachdichtung —
Vielleicht kann uns eine jener Nachdichtungen ein wenig bei der Antwort helfen. Sie stammt von dem französischen Dichter Jean Anouilh1 und heißt Das Leid vom verlorenen Jesuskind:
„Jesuskind, wo bist du? Du bist nicht mehr zu sehn.
Leer ist deine Krippe, wo Ochs und Esel stehn …
Ich seh Maria, die Mutter, und Joseph Hand in Hand,
ich seh die schönen Fürsten vom fernen Morgenland.
Doch dich kann ich nicht finden:
Wo bist du, Jesuskind?“
„Ich bin im Herzen der Armen, die ganz vergessen sind!“
„Maria, voller Sorgen, die sucht dich überall,
draußen bei den Wirten, in jeder Eck im Stall.
Im Hof ruft Vater Joseph und schaut ins Regenfaß.
Sogar der Mohrenkönig, er wird vor Schrecken blaß.
Alles sucht und ruft dich:
Wo bist du, Jesuskind?“
„Ich bin im Herzen der Kranken, die arm und einsam sind!“
„Die Könige sind gegangen, sie sind schon klein und fern;
die Hirten auf dem Felde, sie sehn nicht mehr den Stern.
Die Nacht wird klar und finster – erloschen ist das Licht.
Die armen Menschen seufzen: Nein, nein das war ER nicht!
Doch rufen sie noch immer:
Wo bist du, Jesuskind?“
„Ich bin im Herzen der Heiden, die ohne Hoffnung sind!“
— Weihnachtliches Erwachsenwerden —
Keine und keinen von uns wird es wohl gegeben haben, die oder der sich als Kind nicht auf Weihnachten freute. Das Geheimnisvolle um den Heiligen Abend, der Baum, die Kerzen, die Krippe, die Geschenke. Aber in irgendeinem Jahr kam der Tag, da wir gelernt haben, dass all das nicht das Christkind bringt, sondern von Vater und Mutter kommt, und dass Weihnachten gefeiert wird als Geburtstag Jesu, der schon gut zweitausend Jahre zurückliegt. Im ersten Moment ist da ja eine Enttäuschung – fast so, wie wenn in einer Krippe alle Figuren von Maria und Josef über die Hirten und Könige bis zu den Schafen da sind, aber das Krippenkind fehlt. Trotzdem geschieht gerade so der erste Schritt von der kindlichen Wunderwelt zum Glauben der Erwachsenen: Er besteht darin zu lernen, dass Weihnachten nicht gleichbedeutend ist mit Lichtern, Geschenken und ein bisschen Harmonie, sondern: dass all das Sinnbilder sind – menschliche Zeichen für ein Beschenktwerden durch Gott, das Menschen unendlich froh macht. In Jesus hat Gott nicht etwas, sondern sich selbst geschenkt, seine Nähe; seitdem ist er mit uns. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn uns jemand, der uns wichtig ist, nicht nur einen Gruß schickt, sondern selber kommt und bei uns bleibt. Mit Weihnachten hat Gott sich auf unser Menschenleben eingelassen, mit allem, was dazugehört. Hoffen und Freuen, die Sehnsucht und das Traurigsein, das Leid sogar hat Gott mit uns geteilt. Ein Mensch zu sein, ist kein Verhängnis, ist kein Fluch. Es ist etwas Großes, weil es sogar zu Gott passt. Und er selber zeigt und hilft uns, wie wir recht umgehen mit dem, was uns da geschenkt ist, mit dem Leben.
— Was bleibt? —
Allerdings: Wer das bedenkt, dem wird an eben diesem Punkt Weihnachten noch viel fraglicher werden, als es ihm damals zu Kinderzeiten wurde, da er erfuhr, dass das Christkind ein Sinnbild ist. Er wird sich fragen: Wenn die Weihnachtsgeschichte wahr ist, wenn Gott wirklich einer von uns geworden ist, was ist davon geblieben für uns? Ist überhaupt etwas geblieben? Sind Menschen – so reich beschenkt – gütiger geworden zueinander, geschwisterlicher, friedliebender? Es sieht eher nach dem Gegenteil aus. Die täglichen Fernsehbilder aus Syrien, aus Libyen, dem Irak und anderswoher, die Zeitungen sind der Beweise voll. Gerade so, wie es Anouilh in seinem Gedicht schrieb: Die Mitte von Weihnachten – das Christus-Kind, Inbild der Menschlichkeit – ist schier unauffindbar geworden, die Krippe mit ihren Figuren zur leeren Staffage verkommen.
— Den zweiten Schritt tun —
Wenn es so steht, warum feiern wir dann Weihnachten noch? Weil jene Mitte immer noch da ist, obwohl sie unauffindbar scheint. Wir müssen nur nochmals tiefer schauen: Den ersten Schritt haben wir als Kinder vom Christkind zur Botschaft vom menschgewordenen Gott getan. Der zweite Schritt jetzt geht von der Botschaft – ja, wohin?
In unserem Gedicht wird denen, die fragen: „Wo bist du, Jesuskind?“, geantwortet:
„Ich bin im Herzen der Armen, die ganz vergessen sind!“
„Wo bist du, Jesuskind?“
„Ich bin im Herzen der Kranken, die arm und einsam sind!“
„Wo bist du, Jesuskind?“
„Ich bin im Herzen der Heiden, die ohne Hoffnung sind!“
Was für eine Antwort! Gott hat sich für sein Kommen zu uns eine neue Krippe gesucht. Nicht mehr die aus Holz und Moos unter Christbäumen; auch die nicht mehr, die aus den Worten der Glaubensbotschaft besteht. Seine Krippe, sein Ort, wo er da ist und sich finden lässt – diese Krippe sind Menschen, besondere Menschen: Arme, an die keiner mehr denkt, Kranke, die keiner mehr besucht, Menschen, die nichts mehr glauben und darum nichts mehr zu hoffen haben. Vielleicht wir selber aus anderer Not.
Eine, die nichts mehr hat, wartet auf mich, dass ich mit ihr teile; einer, der darniederliegt, sehnt sich danach, dass ich eine Weile bei ihm sitze und ihm die Hände halte; eine, die zweifelt oder verzweifelt ist, hofft auf mich, dass wenigstens ich sie nicht aufgebe, hofft, dass ich für sie hoffe, weil sie selber es nicht mehr kann: Dieses Warten, dieses Sehnen, dieses Hoffen, das nichts anderes mehr ist als Warten, Sehnen, Hoffen, angenommen und gemocht zu sein, das macht Weihnachten wahr. Denn solange es dieses Warten, Sehnen und Hoffen gibt, solange war nicht vergeblich, dass Gott selber ein Mensch wurde, um uns auf Du und Du zu sagen: Dein Warten, Sehnen, Hoffen ist nicht umsonst. Gott selber hat Dich schon längst angenommen, Dich und alle Deine Menschengeschwister. Keiner ist aufgegeben, keine vergessen. Das hat er uns durch Jesus, also als Mensch gesagt. Seitdem ist das Menschsein selber Gottes Sache. Was er zu eigen nimmt, lässt sich nie mehr leugnen, durch nichts widerlegen, geht nie mehr verloren, selbst wenn es äußerlich so scheint. Und seitdem gilt auch: Wo einer dem anderen menschlich begegnet, begegnen sie einander dem menschlichen Gott. Weihnachten liegt schon gut zweitausend Jahre zurück – und geschieht in jedem Augen-Blick neu, in dem Menschen einander Menschen sind.
1 Anouilh, Jean: Das Lied vom verlorenen Jesuskind. In: Baltz-Otto, Ursula (Hg.): Licht in der Finsternis. Texte zur Weihnachtszeit. Düsseldorf 2005. 106.
Weihnachten – am Tag: Joh 1,1–18
Logos
— Vertrauter Anfang —
Gerade seit ein paar Stunden ist die Heilige Nacht vergangen. Wir haben die vertrauten Geschichten aus der Bibel gehört, die Lieder gesungen, den einen oder anderen alten Brauch daheim gepflegt, der selbst noch die anrührt, die gern von sich sagen, dass sie religiös unmusikalisch seien. Jetzt ist Weihnachten.
— Vom Überschuss —
Aber Weihnachten ist mehr, viel, viel mehr als diese Geschichten, die Lieder, die wunderschönen Krippen und jene Bräuche vielleicht. Auf dieses „Mehr“, diesen Überschuss stößt uns geradezu das Evangelium des Weihnachtstages, das wir eben gehört haben: Auch es ein Hymnus, ein Lied gewiss – aber doch von einer Nüchternheit und so sehr gleichsam von weit oben herab, dass es beinahe kühl wirkt vor dem Hintergrund des Dunkels und der milden Lichter der Heiligen Nacht.
— Von Betlehem zum Universum —
Denn in diesen Versen, die den Anfang des Johannes-Evangeliums bilden, da geschieht etwas Ungeheures. Da wird das Geschehen im Stall von Betlehem ohne Wenn und Aber ins Verhältnis zum Ganzen der Welt, ja mehr noch: zum Ganzen der Schöpfung gesetzt:
Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott.
Alles ist durch es geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist …
Und das Wort ist Fleisch geworden.
– Und so weiter. So steht es in den liturgischen Büchern und unseren Bibeln heute. Doch im Grunde verrät diese Übersetzung so gut wie nichts von dem, was da wirklich gesagt wird.
Johannes hat da nämlich ein Wort aufgegriffen, das schon damals von weit her kommt, nämlich aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert von einem Philosophen, dem sogenannten Vorsokratiker Heraklit. Diesem Denker war eines Tages aufgefallen, dass es ganz viele verschiedene Dinge gibt in der Welt, dass die auch noch dauernd in Bewegung und Veränderung begriffen sind – und dass trotzdem irgendwie alles, was es da gibt, zusammenhängt und ein sinnvolles, beständiges Ganzes bildet. Darum war er überzeugt: Wenn das, was solchermaßen ist, Bestand hat, muss es ein einendes Prinzip geben, das alle Unterscheidungen übergreift und zusammenhält. Dieses Prinzip hat er „Logos“ genannt, wörtlich übersetzt: „Lese“ oder „Sammlung“. Und dass wir Menschengeister, wir kleinen, auch halbwegs etwas von all diesem Wirklichen verstehen können, verrät, dass unsere Seele an diesem Prinzip irgendwie Teil hat – und aussprechen können wir dieses Gedachte auch noch so, dass andere uns verstehen, weshalb er beides, das Denken und Aussprechen, auch noch „Logos“ nennt. Daher kommt auch, dass wir diesen griechischen Ausdruck „Logos“ gern mit „Wort“ übersetzen, obwohl das nur einen kleinen Teil von dem ausdrückt, was er eigentlich meint.
Aber jetzt kommt der Paukenschlag: Diesen Logos, dieses alles zusammenhaltende, alles verständlich und transparent und aussprechbar machende Prinzip, identifiziert der Evangelist mit Jesus von Nazaret. Er will sagen: Was er, dieser Jesus sagt, was er tut, wie er ist, das macht verständlich, wie alles zusammenhängt und zusammengehört: Gott und Mensch, Himmel und Erde, und all das, was uns Menschenkinder zu Lebzeiten bewegt: das Kommen und Gehen, Geborenwerden und Sterben, das Gute und das Böse. Er, Jesus, das Kind im Stall, das später an einem Galgen sterben wird und – verrückt genug – durch all das zusammen etwas aufstrahlen lässt vom Geheimnis Gottes, er in Person ist jener Logos, jenes Grundmaß alles Wirklichen – nur dass es jetzt christlich gesehen nicht mehr ein nur wenigen zugängliches, elitäres philosophisches Prinzip ist, sondern gleichsam Menschenantlitz besitzt: Der Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt, seine Bleibe aufgeschlagen, sagt Vers 14.
— Atemberauende Hintergründe —
Wie kommt Johannes zu dieser verwegenen These? Um das zu verstehen, muss man gleichsam den Blick ein bisschen im Neuen Testament schweifen lassen. Und wenn man das tut, findet man zwei Haltepunkte, die weiterhelfen. Da gibt es zum einen im Ersten Johannesbrief den lapidaren Satz „Gott ist die Liebe“. Und zum anderen stößt man auf einen viel älteren Gedanken im Brief an die Gemeinde in Philippi des Apostels Paulus Kapitel 2, in Versen, die wie ein Hymnus klingen, aber wohl in Wahrheit so etwas wie Paulus’ emphatischste Programmangabe seines ganzen Denkens und Handelns sind:
Er [Jesus] war wie Gott,
hielt aber nicht daran fest Gott gleich zu sein,
er entäußerte sich,
wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich (Phil 2,6–7).
Er entäußerte sich – griechisch „ekenosen“: die Denkfigur der Kenosis, wie die Theologinnen und Theologen sagen.
Dahinter steht ein atemberaubender Gedanke: Gott hat sich in die Menschwerdung seines Gottseins begeben, hat sich klein gemacht. Doch warum? Antwort: Könnte, wenn das wahr ist, – könnte dann nicht sein, dass er genau darin seine größte Größe erweist? Wenn und weil Gott Gott ist, hat er es gar nicht nötig, sich in Gesten und Taten der Macht zu manifestieren, sondern – menschlich gesprochen – tut er das darin und dergestalt, dass er sogar noch auf das Mächtigsein verzichtet, um das zu sein, was er in Wahrheit ist: Quelle und Urgrund von allem, was lebt.
Wenn die Macht des denkbar Mächtigsten – also Gottes, traditionell gesprochen – in der Preisgabe dieser Macht zugunsten von anderem besteht – dass dieses andere sei –, und wenn sich darin das wahre Mächtigsein dessen zeigt, worüber hinaus Mächtigeres nicht gedacht werden kann, dann kann es in der Welt nichts Mächtiges mehr geben – keine Moral, kein Dogma, keine Autorität –, das sich diesem Kriterium des Seins-für-Anderes zu entziehen vermöchte. Und auch wenn es so etwas wie Gottes Allmacht gibt, dann kann sogar diese nur die Form des unbedingten Seinlassens von anderem haben. Der italienische Philosoph Gianni Vattimo füllt die Hohlform dieser Macht, die sich im buchstäblichen Seinlassen von anderem vergegenwärtigt, wortwörtlich mit dem Begriff der caritas, der Liebe, übrigens in bemerkenswerter Nähe zu Augustinus, der einmal in seinem Johannesbrief-Kommentar sinngemäß geschrieben hat: Jemandem bekennen „Ich liebe Dich“, heiße, ihm oder ihr zu sagen: „Ich will, dass Du bist.“ Darum vorhin mein Hinweis auf den Ersten Johannesbrief.
— Wenn Gott sich klein macht —
Das ist die Mitte der Weihnachtsbotschaft: Gott macht sich selber klein und gibt dadurch dem Menschlein, das klein ist und sich oft klein fühlt, eine durch nichts anderes zu gewinnende Würde. Kritiker des Christentums von der Spätantike bis zur jüngsten Gegenwart hat eben das am meisten aufgeregt: dass der Mensch, dieses zerbrechliche, fehlbare, für Störungen und Verletzungen anfällige Wesen so wichtig sein soll, dass Gott sich seiner annimmt bis dahin, dass er selber seinesgleichen wird. Für die Heiden von einst und heute ist das ein einziger Skandal, eine Geschmacklosigkeit sondergleichen.
Aber genau das ist das christliche Zentrum: Was Gott uns unbedingt sagen will, sagt er in der sichtbaren, leiblichen, deshalb auch sterblichen Existenz Jesu von Nazaret. Was Gott uns unbedingt sagen muss um unseretwillen, sagt er uns nicht als hehre Formel, auch nicht als Befehl, noch nicht einmal als Wunsch, sondern sagt er als Zeit-Wort, als Tun-Wort, indem er Mensch wird. Die göttliche Botschaft ist das Fleisch. Johannes sagt nicht: Das Wort ist Mensch geworden, oder: Das Wort ist Person geworden. Nein: Fleisch ist es geworden, sagt er. Also: Gott identifiziert sich mit der menschlichen Wesensart: mit ihrem Anfang und ihrem Ende, mit ihrer riskanten Freiheit und ihrem Verdanktsein, auch mit ihren Grenzen und mit der Frage, die sie sich selbst für immer bleibt. Das alles gehört zu euch, sagt er uns. Du musst nicht anders sein als ich Dich schuf, um Dein Glück zu finden. Wenn wir Jesus von Nazaret wirklich als Gottes Botschaft zu glauben wagen, dann hat er uns in ihm gesagt: Traut euch, Mensch zu sein im Zutrauen zu mir. Getrau Dich deshalb, alles anzunehmen, was Du in Dir findest, sogar das, was Dir jetzt hässlich und niedrig und gefährlich erscheint. So wird es nur, weil Du es unter Deine eigene Macht und Verfügung gestellt hast. Du hast nicht mehr Fleisch sein wollen, Du hast wie Gott sein wollen aus Misstrauen, ich hätte Dir etwas vorenthalten am Leben. Darum kann so viel Gutes, was ich Dir gab, auch böse werden: Deine Triebe, dein Verstand, sogar dein Schönstes, Deine Liebe, kann zwielichtig sein. Deshalb: Trau Dich wieder, Mensch zu sein! Schau auf den, den ich gesandt habe! Vertrau Dich ihm an, ihm, der mein Wort ist an Dich, das Dir sagt, was Leben ist. Auch wenn viele es nicht hören wollen. Nimm Du ihn auf in Dich, schließ Dich ihm an! Trau Dich, mit ihm zu sein! Denn alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, sagt Johannes. Wer dem fleischgewordenen Wort traut, lebt wie neu geboren, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott. Wer es wagt, von Gott getragen Fleisch zu sein, ein zerbrechlicher, ungesicherter Mensch, der einzig davon lebt, dass er Vertrauen und Liebe empfängt und Vertrauen und Liebe schenkt, – wer das wagt, hat begonnen, Gottes Kind zu sein. Der lebt in Gottes Nähe, hat teil an Gottes Frieden. Der ist wie Gott geworden. Aber jetzt nicht mehr gegen Gott, sondern so, wie Menschen wirklich wie Gott zu sein vermögen. Das ist unsere Berufung, Ihre und meine. Weihnachten ist – alles Gemütvolle an ihm in Ehren! – ein großes, ein einziges Wahrheitsfest. Und was könnte uns Besseres passieren, als an Tagen wie diesen, da unsere Seele sich auftut wie selten sonst, gesagt zu bekommen, wer wir in Wahrheit sind!