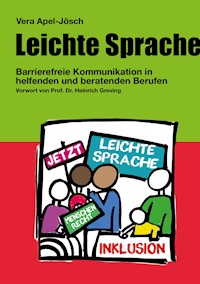Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine Frau von 63 Jahren geht alleine zu Fuß über die Alpen. Sie beschreibt die Höhen und Tiefen ihres Weges, berichtet von zwischenmenschlichen Begegungen und gibt viele Hinweise zu lokalen Sehenswürdigkeiten. Wir dürfen in diesem Buch ihre Gedanken begleiten, diese sind mal spirituell, mal philosophisch und sehr oft humorig. Auf den letzten Seiten des Buches erwarten den Leser und die Leserin Fotografien von der Strecke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Begleitworte:
Ich widme dieses Büchlein meiner wunderbaren Freundin Karin Simanowski. Ohne Ihr Vorbild hätte ich diese Tour vermutlich nicht gewagt.
Im Text tauchen immer mal wieder Produktnamen oder Firmennamen auf. Ich habe für den möglichen Werbeeffekt keinerlei Honorar erhalten.
Inhaltsverzeichnis
Textbeginn
Von Mittenwald nach Leutasch
Von Leutasch nach Landeck
Von Nauders nach Reschen
Von Reschen nach Naturns
Von Naturns nach Meran
Epilog
Das Schicksal hat Humor. Das muss man ihm echt lassen. Da habe ich letzte Woche fette 98 Kilometer zu Fuß unbeschadet in den Alpen hinter mich gebracht, um jetzt daheim mit hochgelagertem Bein und Riss am Außenmeniskus im Bett zu liegen. Erworben habe ich diese Verletzung auf einem harmlosen Spaziergang im heimischen Wald. Ich wollte über einen quer auf dem Weg liegenden Stamm springen, war mit dem rechten Bein schon hinüber, als sich mein linker Fuß im Geäst verfing und mich zu Boden warf, dabei das linke Bein ordentlich verdrehte. Sofort schoss ein mächtiger Schmerz ein und ich wusste: Hier ist was kaputt gegangen.
Damit nämlich habe ich Erfahrung. Ich kann selbstdiagnostisch Verletzungen gut einordnen, denn ich bin eine Unfallpersönlichkeit. Eine Bruchpilotin ohne Flugzeug. Mein Leben ist gespickt mit Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Überdehnungen, Gehirnerschütterungen, Blutergüssen, Quetsch-, Schnitt- und Schürfwunden. Überall am Körper sind Narben, die Knie sehen aus wie der Grand Canon. Das linke Knie war ohnehin angeschlagen, vor neun Jahren hatte ich mir auf einer Fete Kreuzband und Seitenband eingerissen. Ich habe auch eine stattliche Anzahl von Knochenbrüchen hinter mir: Sprunggelenk, Handgelenk, Elle, Schulter gleich zweimal, Mittelhand, Mittelfuß, Steiß, Nasenbein (doppelt), vier Zehen, Rippe. Mein Sohn Max hat das zu Beginn seines Medizinstudiums zu der Zeit der obligatorischen Anatomie- und Pathologiepraxis lakonisch mal folgendermaßen kommentiert:" Mutter, Dein Skelett könnte man in der Rechtsmedizin 1a identifizieren." Wie tröstlich. Einzig getoppt von jenem Satz, als ich ihm meine Patientenverfügung übergab: "Du stirbst eh keines natürlichen Todes!" Dabei hatte er aber wohl noch nicht mal meine Stürze im Blick, sondern eher die anonymen Drohbriefe, die ich damals von Neonazis erhielt. Nun bin ich immerhin schon kurz vor meinem 63. Geburtstag, war ganze fünf Jahre unfallfrei. Bis vorgestern.
Natürlich habe ich immer wieder darüber nachgedacht, warum ich so oft hinfalle. Oder wie meine Freundin Sabina einst zu Zeiten des reiselustigen Karol Wojtyla sagte: " Du küsst den Boden häufiger als der Papst!"
Es begann schon zu Kindertagen und meine Eltern interpretierten es oft als Faulheit oder Drückebergertum, wenn ich humpelnd von einem Arbeitsauftrag zurückkehrte. Als junge Frau habe ich dann Dethlefsen und Dahlke gelesen, wie viele andere in meiner Generation auch. Schicksal als Chance, Krankheit als Weg. Die Autoren interpretierten Unfälle als unbewusst selbstgewollt um sich Auszeiten zu gönnen oder als Zeichen für übermäßige Starrheit, für die Notwendigkeit einer Beugung. Ich hab mich damit nicht identifizieren können, denn als Kind war ich mehr gebeugt als mir gut tat, ich wollte mit allen Mitteln ein gutes Mädchen sein.
Als ich 16 Jahre alt war und den Mopedführerschein machte, brauchte ich einen Sehtest. Und da stellte sich heraus, dass ich ein ziemlich blinder Maulwurf bin. Ein Auge ist fast blind, das andere hat extreme Hornhautverkrümmungen und andere Läsionen , ein Auge ist kurzsichtig, das andere weitsichtig und bei Müdigkeit schaltet mein Gehirn einfach mein ganz schlechtes Auge ab. Alles in allem führt das dazu, dass ich nur eindimensional sehe. Ich kann nicht räumlich sehen, Tiefe nicht erkennen oder eine solche nicht richtig einschätzen. Bei Treppen weiß ich nicht, wie tief mein Schritt zur nächsten Stufe sein soll, Bordsteine erkenne ich ebenso wenig wie Bodendellen. Kein Wunder, dass ich dauernd auf die Nase falle! Ich kenne kein anderes Sehen, darum ist es mir selbst nie aufgefallen. Eine Brille kann mein ein dimensionales Sehen nicht verändern, sie schützt nur meine Augen vor Überanstrengung. Nordic Walking Stöcke hingegen helfen recht gut, weil ich über das Fühlen merke, dass der Boden vor mir anders wird. Theoretisch müsste ich beim Gehen dauernd hellwach und konzentriert sein. Praktisch komme ich beim Gehen total schnell in einen Flow, fast tranceartig, was wunderschön ist. Das will ich nicht verlieren. Und so ist es wie es ist. Ich bin inzwischen eine gute Abrollerin und verletze mich nur noch selten bei Stürzen. Außer vorgestern. Siehe oben.
Die ersten paar Stunden nach dem jetzigen Sturz habe ich gehadert und gejault, ich gebe es zu. Meniskus tut auch echt weh. Aber nun habe ich mich besonnen. Alles ist zu irgendetwas gut. Nichts geschieht ohne Grund. Das Universum verschenkt keine Energie. Wenn ich schon hier herum liegen muss, kann ich ja auch gleich die Geschichte meiner Alpenüberquerung aufschreiben, noch sind die Erlebnisse ganz frisch. Die zurückliegende Woche ist noch irgendwie irreal, sicher hilft das Schreiben auch beim Verarbeiten.
Der Gatte hat mir im Bett eine Bank aus Yogakissen und Deckenrolle für das hochzulagernde Bein gebaut, der ungarische Hund schnarcht gemütlich unter meiner Bettdecke und ich tippe. Ich tippe einfach drauf los ins Tablett, ohne Storyboard und Dramaturgiekonzept. So wie man das auf keinen Fall macht. Darin bin ich gut.
Das Fazit aus meinem Sturz fällt folgendermaßen aus: Meine ewigen Warner fühlen sich bestätigt. Sie sagen: Siehste, man kann sich stets verletzen. Ich sage: Siehste, man kann sich überall verletzen. Beide finden wir, dass wir Recht haben.
Die Idee einer Alpenüberquerung begleitet mich seit 2011/2012. Mein Gatte und ich erwanderten zu der Zeit den Rothaarsteig und ich bemerkte, dass mir Routenwanderungen viel mehr Spaß machen als das zielloses Umhergehen des Gehens Willen. Nach dem Rothaarsteig erwanderten wir die Traumpfade in der Eifel und ich kaufte mir Wanderbücher, so auch eines über den Goetheweg nach Italien, der in vielen hundert Kilometern von München nach Venedig führt.
Goethes Aufbruch über die Alpen nach Italien war damals eine Flucht. Durch sein anstrengendes Ministeramt in Weimar glaubte Goethe den Zugang zu seiner Kreativität verloren, die er im idealisierten Italien wiederfinden wollte und sollte. Was als Reise geplant war, wurde zu einem fast zweijährigen Aufenthalt, Goethe schrieb und zeichnete vor allem wie besessen. Seit Schülertagen faszinierten mich seine italienischen Verse:
"Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!"
Ich bin ein Mensch mit schier unstillbarem Fernweh. Mich zieht es immer irgendwo hin. Es ist kein "Fort-von" im Sinne einer Flucht, sondern immer ein "Hin-zu", ein fast fiebriges Streben nach neuen Eindrücken, dem aufsaugenden sinnlichen Erleben, dem eifrigen Sammeln von Erfahrungen und Erinnerungen. Am sechsten Tag meiner Wanderreise entdecke ich in den Sommergärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran tatsächlich einen Zitronenbaum voller Früchte, sage im Geiste das Goethegedicht auf und bin wirklich ergriffen. Ich war durchaus schon früher in Italien gewesen: in Mailand, am Lago Maggiore, im Piemont, im Vinschgau und in der Toscana, aber diesmal war es anders. Meine eigenen Füße hatten mich von Deutschland hierher gebracht, unter viel Schweiß und fast ein paar Tränen. Doch dazu später mehr.
Der Goetheweg schied für mich wegen seiner Länge aus. Der bekannteste Alpenweg E 5 von Oberstdorf nach Meran schied für mich ebenso aus. Ich musste den Tatsachen nüchtern ins Auge sehen, für Gletscherpartien und Kletterpassagen bin ich nicht sportlich genug. So wurde es ebenso wie der E 5 ein Weg mit 5 Wandertagen, beginnend aber in Mittenwald am Fuße des herrlichen Karwendel, endend in Meran in Südtirol. Dieser Weg ist sanfter als der E 5, aber soviel sei schon jetzt verraten: Ein Spaziergang ist er nicht.
Zu den Eckdaten:
Ich bin 98 Kilometer gelaufen in den 5 Wandertagen, Umwege und Abstecher inbegriffen. 1.400 Höhenmeter bergauf und 2.200 Höhenmeter bergab. Mehr als einmal habe ich mich verlaufen. Das war aber weder meiner Wanderapp bei Komoot geschuldet, noch meinen hervorragenden Wanderunterlagen von Eurohike. Ich fühlte mich schnell durch die App und das häufige Nachschauen in den Unterlagen in meinem Flow gestört, schaute mir am Morgen des Wandertages die Route genau an, prägte mir Wesentliches ein und orientierte mich dann eher an Beschilderungen, was bisweilen doch zu Mehrkilometern führte. Aber so hat es für mich gepasst, andere Wanderer haben sich akribisch an ihre Unterlagen gehalten. So hat es für sie gepasst. Jeder ist anders. Auch bei Städtetouren kaufe ich mir tolle Reiseführer, studiere die im Vorfeld mit viel Freude um dann später vor Ort doch lieber in Seitenstraßen abzubiegen oder mich einfach treiben lassen. Ich bin gut im Planen, aber weniger gut in der Planerfüllung, da erlaube ich mir viele Freiheiten, Spirenzchen und Schlenker. Ich bin eine Schlenderin, dazu gehört auch eine gewisse Ziellosigkeit, die Offenheit für Zufälle, die Neugier auf Unvorhergesehenes.
Ich bin meinen Weg in den Alpen oft intuitiv gegangen oder habe Einheimische befragt. Dadurch bin ich manchmal vom richtigen ("vom rechten Weg") Weg abgewichen, was aber immer nachträglich seinen Sinn für mich hatte. Ein Beispiel ist die Entdeckung der mittelalterlichen Stadt Mals, die so gar nicht vorgesehen war und die ich nicht missen möchte.
Bei Eurohike kann man die Tour auch in sechs Wandertagen, beginnend ab Garmisch-Partenkirchen gehen. Der Tag des Starts ist frei gewählt, es gibt keine festen Starttage. Die Tour heißt Alpenüberquerung light, denn das Gepäck wird von Eurohike täglich und sehr zuverlässig ins neue Übernachtungsquartier gefahren, man trägt nur seinen Tagesrucksack selbst. Ich hatte einen 20 Liter Rucksack dabei, der war vom Platz gut ausreichend, von Tag zu Tag habe ich weniger Sachen mitgenommen.
Ein paar Sätze zu weiteren Alpenrouten: welchen genauen Weg Hannibal mit seinen Elefanten nahm, ist bis heute nicht genau geklärt, vermutlich über die Schweizer und französischen Alpen.
Einen weiteren grausamen Weg lernte ich bei den Vorbereitungsrecherchen kennen: Den Weg der Schwabenkinder. Schwabenkinder waren Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren aus ärmeren Regionen der Alpenländer. Ihre Eltern waren arme Bauern, die ihre Kinder kaum ernähren konnten. Deshalb schickten sie diese zum Arbeiten nach Oberschwaben.
Auf Kindermärkten wurden die Kinder an Bauern als Saisonarbeitskräfte verkauft. Es handelte sich um eine Form von Sklaverei. Schulpflicht bestand für diese Kinder nicht, so dass sie meist nicht lesen oder schreiben lernten. Diese Form der Kinderarbeit war bis in die Dreißigerjahre des 20.Jahrhunderts in Süddeutschland weit verbreitet. Die Kinder wurden auf ihrem Weg aus Norditalien oder Tirol von einem Erwachsenen begleitet, häufig ein Priester. Die Strecke muss eine Tortur gewesen sein, führte sie über Schnee und Eis, die Kinder waren häufig nur dürftig bekleidet, hatten schlechtes Schuhwerk. Hinzu kamen ein fremdes Land, häufig böse Herren, Heimweh und Hoffnungslosigkeit. In einem aktuellen Projekt reiht und analysiert die Europäische Union Daten dieses Schandflecks oberschwäbischer Geschichte ( www.schwabenkinder-eu.de ).