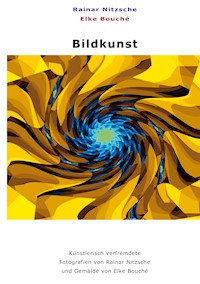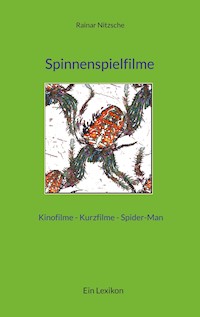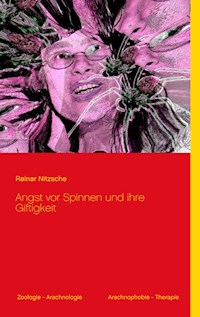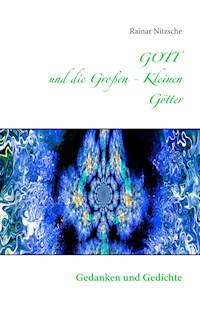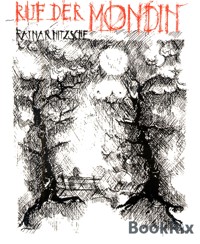Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fortsetzung von "Der Leuchtende Pfad des Magiers", Reise durch die Welten = Bioregionen der Erde 3-5: Chinesisches Nebelland der Drachen (Manfreds Mutter ist ein Feuerdrache), Aufbruch des Massaimädchens Moyo in den Norden Afrikas und Verwandlung in eine Schwarze Pantherin: Sie ist ein Leopardenmensch. Vor 65 Millionen Jahren schlug ES von T-Her ins Meer, und die Dinos starben aus. Vor 4 Millionen Jahren spaltete ER sich von "ES" ab, ging an Land und hatte Einfluss auf die Menschenevolution. Seitdem zieht ER durch die Welt und tut, was er will. Manfred, ein Magier, aber doch nur ein Mensch, der sich auf seiner Reise in zahlreiche Wesen verwandelt, hat keine Chance gegen IHN. Und wie soll Manfred in Eurasien auf dem Weg nach Osten zum Himalaya jemals auf seine neue Liebe Moyo treffen, die nach Ägypten unterwegs ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainar Nitzsche
Wandlungen der Drei
Band 2 der Reise durch acht fantastische Welten: NEBELLAND, GRÄSERNE MEERE und WASSERWELTEN
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Längst bist du abgerückt
Nebelland
Der gar nicht mehr so alte Alte
Gräserne Meere
Einen Kräutertee trinkt der Alte
Wasserwelten
Wichtige Personen, Lebewesen und Begriffe*
Die Pfadwelten
Worte und Erinnerungen*
Der Autor
Impressum neobooks
Vorwort
Den Rabenkrähen in Kaiserslautern
Du sitzt am Schreibtisch und schaust aus dem Fenster.
Ach, da landet ja die Krähe, eine alte Bekannte - oder doch ein „Er“, also ein alter Bekannter?
Spreche ich von „ihr“.
Irgendetwas Weißes-Großes trägt sie im Schnabel, legt es in der Dachrinne ab.
Ein andermal wieder pickt sie dort oben im Laub und Moos herum, das die Dachrinne verstopft - ob sie nach Essbarem sucht, das sie einst dort selbst versteckte?
Du springst auf und schaust hinaus.
„War das der Ruf der Krähe?“, fragst du dich.
Sie aber ignoriert dich völlig, schaut dich nicht an und fliegt davon.
Und den Raben im Nebelland
Liebe(r) LeserIn,
hier zunächst eine kurze Zusammenfassung der Handlung des ersten PFAD-Romans Der Leuchtende Pfad des Magiers: „Und so begann es: Eines Nachts verließ Manfred die Stadt, denn er sah ihn wahrhaftig vor sich, seinen Leuchtenden Pfad, der ihn aus dem Alltagstrott wegrief. Schon war es um ihn geschehen: Er erhob sich in die Lüfte und gelangte in die Welt mit Namen Wald. Dort fand er nach vielen Abenteuern seine große Liebe Nairra und - verlor sie wieder.
Und nun zum Inhalt von Band 2 Wandlungen der Drei: Im Wasser begann das irdische Leben, aus Wasser bestehen wir alle noch immer. Meer brandet an den Küsten empor: Das ist die lockende See mit ihren noch immer den Menschensinnen verborgenen Tiefen – es sind Wasser-Welten. Wasser durchnetzt Sand und Erde, Quellen sprudeln empor, werden zu Bächen, Flüssen, Strömen. Wolken schweben in den Lüften, fallen als Regen, Schnee und Hagel hinab. Andernorts zu anderer Zeit unten im Tal steigen warme Wasser am Morgen auf - verschwinden niemals vollständig im Nebelland.
Oben aber auf dem Plateau Eurasiens, aber auch nördlich des Regenwaldes auf dem alten Kontinent mit Namen Afrika, wo einst vor Jahrmillionen der Mensch entstand, und inmitten der beiden Amerikas leben Gräserne Meere, die viele Namen tragen: Pampa, Prärie, Savanne und Steppe.
Ach ja, die Worte »essen«, »Mondin« und »Sonn« sind keine Druckfehler, sondern bewusst gebraucht. Tiere essen. Ich sehe den Mond weiblich, die Sonne männlich. Wie im ersten Band gibt es auch hier wieder einen Anhang mit Informationen zu zahlreichen Begriffen aus diesem Romanteil.
Diese Worte mögen genügen, auch wenn sie nur wenig vom Inhalt verraten, wo doch vielleicht jedes Wort - oder kein Einziges? - von Bedeutung sein könnte?
Rainar Nitzsche, Kaiserslautern,
Oktober 2004, Juli 2007 und Juli 2015
Längst bist du abgerückt
von dem alten Mann, der einst so plötzlich vor dir erschien, sich formte vor deinen Augen aus ETWAS und ALLEM, was immer es auch war, der dich zu sich winkte und dir alles erzählte.
Nun ist mehr Distanz zwischen ihm und dir.
Doch wie seltsam, weder er noch du, keiner von uns, denkst du, bewegte auch nur ein Bein. Es ist, als wärest du einfach geräuschlos zurückgefahren, als wäre deine Bewegung nur ein Zoom in einem Film gewesen.
Und doch ist er dir noch immer so nah: der alte Mann, der da nun sitzt so klein und - allein. Eine dicke, nein, keine Brille auf der großen Nase - wie komm’ ich nur darauf? -, nicht mehr allzu viel Haare und das, was blieb, ist weiß. Groß war er wohl einst in jungen Jahren, doch heute ist sein Rücken krumm.
Jetzt schaut er auf.
Falten im Gesicht, denkst du, graue Bartstoppeln - könnte sich mal rasieren. Wage erinnerst du dich. Lang ist’s her, dass er dir zum ersten Mal erschien, aus den Nebeln trat, in einer warmen Sommernacht war das.
Oder flog die Zeit dahin, weil er dir so viel erzählte, weil einfach so viel geschah?
Du schaust dich um, drehst dich im Kreis, ohne aus dem bläulich leuchtenden Drehstuhl, einem Chefsessel gleich, den jedoch kein Leder bedeckt, aufzustehen, der deinen Nacken stützt und deinen Körper hält und dich zugleich so zart umschmiegt. Deine Arme und Beine hüllt er ein, als wäre er ein Teil von dir. Er ist es.
Du befindest dich im Zentrum des Platzes. Wann kam ich hierher? Warum?, fragst du dich.
Ringsum ist freier Raum. Bänke stehen im Kreis vor Hecken und Platanen. Dahinter liegt die im Kreis herumführende Straße, stehen still die Häuser, führen die anderen Straßen sternförmig nach irgendwohin. Jetzt sind sie alle verlassen. Nur wir sind hier, zu zweit allein im Park der Stadt bei Mondinschein.
Saß dort auf einer Bank nicht einst einmal ein junger Mann und sah empor ins Licht der Vollen Mondin, die ihn rief und rief, die ihn zu sich rief? (Der Ruf der Mondin 1992)
Ein Schatten dort, das könnte alles sein, was von ihm blieb in dieser Welt, sein Geist vielleicht, der noch immer nicht begreift, was längst geschah.
Nachtfalter flattern hin zum Licht der Laternen. Dort müssten auch Spinnennetze sein, denkst du. Bisweilen kommt eine Fledermaus auf der Jagd vorbeigehuscht. Ansonsten ist alles still, jetzt und hier in dieser einen klaren, warmen Sommernacht, denn die meisten Menschen schlafen. Wen wundert’s! Früh müssen sie raus aus dem Haus - zur Schule, zur Arbeit. Denn morgen ist weder Sonn- noch Feiertag noch Ferienzeit noch - damals.
Ist also alles längst vergangen?
Ja! Nein!
Alles vergeht. Nichts vergeht. Alles, was war, das ist.
Also war alles wahr!? Und auch er existiert, heute alt, doch damals jung. Und doch ..., denkst du verwundert und schaust ihn noch immer an. Gebannt, verzaubert lauschst du seinen nie gesprochenen Worten. Die Bilder, die er dir zeigt, die Töne, tausend Gerüche und Gefühle, selbst die Welten und Wesen, die da geboren werden und leben und wieder vergehen, all dies verändert sich - in dir.
Waren da am Anfang nur stottern, erinnern von kurzen Episoden, Splitter nur - Tropfen aus seinem Geist, so tritt nun aus Fels ein Quell, wird Bach und Fluss und Strom. Alles beginnt zu fließen und - zu flimmern. Also verändert sich auch der alte Mann.
Kann das denn sein? - der wird ja merklich jünger! - und das geht rasch! - von einem Augenblick zum andern, als wäre da Magie im Spiel. Schon ist der Wandel vollbracht.
Gegangen ist ein wenig Weiß, auch etwas vom Grau, mehr Farbe ist wieder in seinem noch immer schütteren, doch längeren Haar. Wie es weht im Wind!, den du nicht spürst, der hier nicht ist, den es gar nicht geben kann.
Du schaust ihn an, rückst näher ran, doch fasst du ihn nicht an.
Jetzt ist seine Haut fast faltenlos und ohne Altersflecke. Und dir dämmert - oder flüstert es dir jemand zu?:
Zehn Jahre könnten es gewesen sein.
Aber weshalb, wieso? Als Belohnung gar fürs Erzählen seiner Abenteuer, falls es denn wirklich geschah und nicht nur Dichtung war?
Dies alles fragst du dich noch und hörst ihn auch schon sprechen:
„Ja, so ist es: Als alter Mann von 80 kam ich auf die Welt, damals in einer Stadt - der Stadtmit Namen Kaiserslautern. Mit 70 verließ ich den Wald. Nun bin ich 60 Jahre jung geworden.“
Staunend mit offenem Mund versuchst du zu verstehen. Jünger sieht er tatsächlich aus. Doch Schein und Sein sind zweierlei. Ist alles nur Illusion, Traum oder Zauberei?.
Im Zentrum des Platzes, wo einst Rosenhecken blühten, dann Blumenbeete waren, wächst nun überall grünes Gras. Heuschrecken springen - Sommerzirpen.
Dort liegt er schon auf den Rücken, schaut in die Himmel auf, schließt seine Augen.
Du hörst seine Stimme in dir flüstern, es ihm gleich zu tun.
So legst auch du dich ins Gras und schließt die Augen.
Du öffnest sie und findest dich - noch immer neben ihm auf der Wiese liegend wieder. Ein warmer Sommerregen fällt dir kitzelnd aus einer grauen Wolkendecke ins Gesicht. Du schließt deine Augen und - schaust von oben auf die Welt hinab, siehst im Zeitraffer, die Wasser der Erde verdunsten, Nebel am Morgen entstehen und zum Mittag hin vergehen. Überall sind da vom Tau benetzte Gespinste: Baldachine zwischen den Kräutern, spiralige Räder in den Lücken ausgespannt, jetzt noch, bis die Wärme sie wieder fast unsichtbar macht für Beute und Feind. Dann taucht eine andere Welt vor deinen Augen auf, in der die Nebel niemals vergehen, denn ...
„Schau und lausche meinen Worten“, flüstert seine Stimme.
In der Ferne hörst du Krähen krächzen.
Sind es die, die du kennst? Rabenkrähen?
Oder sollten es gar die großen Kolkraben sein?
Nebelland
Einst war alles Wald.
Jetzt lärmt dort Stadt.
Und morgen?
Hier aber träumt hinter Nebeln
ein anderes Land.
Worte des Magiers
Die Drachen erwachen
aus ihren Träumen unter Bäumen
im Nebelland.
Sie öffnen ihre Augen.
Sie schauen dich an.
Du aber fragst staunend dich:
„Und wer bin ich?“
Worte des Magiers
Alles
entstand
aus dem Drachen.
Huai-Nan-Tzu
Chinesische Landschaft
Wie lange war es her, dass ich aufgebrochen war, mein altes Leben abgeworfen und eine Welt mit Namen Stadt hinter mir gelassen hatte?
Wie viel Zeit verging, seit ich die Lichtung verließ, wo ich um dich trauerte, meine einzige große Liebe, bis ich Ihn Dort Oben sah?
Tagelang war ich den verschlungenen Wegen gefolgt und nächtelang meinem Leuchtenden Pfad. So gelangte ich schließlich aus dem finsteren Wald auf eine singende Wiese. Staunend blieb ich stehen und sah empor: wie hell und voll die Mondin hier doch schien. Ich suchte mir einen Platz im Zentrum der Lichtung und legte mich hin.
Öffne meine Augen am Morgen und schließe sie wieder, höre Vogelzwitschern, dazwischen die heisere Stimme einer Krähe. Unter und über allem liegt Stille, weit und breit sind da weder Menschenworte noch Maschinenlärm.
„Wo bin ich?“, flüstere ich mir leise zu.
„Wer bin ich?“, schallt das Echo aus mir heraus.
Brandet empor Erinnern, ein Ruf, zwei Silben: „Man-fred!“
Ja, der bin ich. Doch das ist nur ein Menschenname.
Erst der Name, dann strömen die Bilder der Welt empor, Erinnern: Einst waren da Häuser und Straßen in der Welt mit Namen Stadt, dann geschah der Übergang.
Einst war da eine Welt mit Namen Wald. Tiere und Menschen. Sieben Samurai und eine Frau - ach, Liebe, dein Name ist Nairra!
Doch war da auch der Andere, der Dunkle, der alles zerstörte: Drefman! Er war Schwärze und Qual und Tod.
Sie alle sind gegangen: weggegangen, dahingegangen, vergangen.
Ich aber blieb - übrig - allein.
Weshalb, warum, wieso?
Nun bin ich hier auf dieser Lichtung, drehe mich im Kreis, schaue mich um, lausche, atme, rieche und schmecke die Luft.
Nun bin ich hier und lebe, noch immer oder wieder, immer wieder?
Geboren und geworden zu dem, der ich bin: Manfred der Magier: ein Mensch, ein Menschenmann. Und langsame lerne ich, die Dinge und Wesen zu lieben, nicht wie ich sie gern hätte, sondern so, wie sie sind. Am meisten aber liebe ich die Stille.
Und während ich S-T-I-L-L-E denke, verstummt die Natur.
Ich atme Stille ein ...
Alles zerfließt ohne Laut, entschwindet sanft, doch unaufhaltsam.
„Mein ganzes Leben schmilzt dahin!“, weine ich beim Anblick der braunen, gelbroten Blätter der Bäume. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Nichts nehmen wir mit auf unserem Weg. Alles verblasst! Kein Grün ist zurückgeblieben!
Also gibt es keine Hoffnung?
So gehen die liebgewordenen Dinge dahin und wandeln sich in Erinnerungen, die nichts als schwacher Abglanz des Lebens sind, Fragmente, Lügen, die nun lautlos in mir sterben.
Innen wie außen, oben wie unten.
Ich sehe das Herbstlaub der Eichen und Buchen fallen.
So fielen die Blätter einst in der Stadt von anderen Bäumen - Robinien und Platanen. Dann wurden die Bäume von den Maschinen der Menschen niedergesägt.
Fall - fall - The Fall of the House of ... nicht Usher, sondern Manfred - mein Untergang, mein Sterben!?
Vater Sonn sinkt leuchtend rot, gewaltig und doch so fern, verschwindet dort im Westen in der Unterwelt.
Tränen weine ich in wachsende Nacht.
Weil alles ringsum stirbt?
Weil alles stirbt - in mir!
Kein Erinnern, kein Gestern mehr und noch kein Morgen.
Jetzt ist der Augenblick. Doch der ist voller Trauer.
Dann irgendwann ist alles vorbei. Ich schaue mich um, drehe mich noch immer langsam im Kreis, hebe meine Arme empor, steige in die Schwärze auf, durchbreche die Wolkendecke, falle weiter und weiter in sternenleuchtendes Himmelsmeer, wo sie - ich sehe sie und lache und rufe es laut hinaus: „Ach, Schwester!“ - wo voll die Mondin scheint.
Ein Blitz aus schwarzer Leere: Erinnern an den Leuchtenden Pfad, der mich einst von irgendwoher nach irgendwohin führte.
Mag sein, dass da unten auf Erden dem Herbst der Winter folgt und dem Schlaf die Wiedergeburt des Frühlings, mag sein.
Sicher ist: Die Wald-Welt ist nun in mir gestorben.
Ein Wort nur, gesprochen in zwei Sprachen, flüstert eine Stimme, sprechen Kehlkopf, Mund und Lippen nach, ein Wort nur, das sich immer wieder wiederholt: „gate gate ... gegangen, gegangen ... gate gate“
Menschenliebe, Menschenleid, Vergangenheit. Einmal lebe ich nur, jetzt und hier. Dann ist Dunkelheit und Stille - oder aber Schlaf und Traum.
Schau, wie Manfreds geschlossene Lider dort oben in den Nachthimmeln zucken!
Etwas taucht aus den Nebeln auf. Es ist ...
Der Drache grüßt. Er öffnet seinen Mund.
Kein Feuer!
Etwas anderes kommt hervorgeschossen. Eins? Nein! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Er spuckt sie alle aus. Sieben Samurai erwachen zum Leben.
Ich sehe sie und lese in ihren Gedanken, während sie sich vor mir verneigen. Nehme sie zugleich aus einem anderen Winkel wahr, fühle und lebe die Erinnerungen des großen Drachen.
Ich öffne meine Augen, weiß nicht, wo ich bin, wundere mich über meinen Traum, den letzten, den einzigen dieser Nacht, an den ich mich erinnere. Wie seltsam er doch war! So klar und deutlich und real.
„Brachte mich mein Traum hierher? Wohin?“, flüstere ich mir zu, drehe mich im Kreis, schaue mich um und sehe - nichts. Schwärze überall und Stille.
Dann wandelt sich alles in wallendes Weiß, steigt auf aus nie gesehenen Schlünden. Die Schwärze verschwimmt hinter wirbelnden Nebeln.
Ich öffne meine Augen ein zweites Mal. Also träumte ich nur zu träumen, aus meinem Traum zu erwachen und in Nebeln zu zerfließen! Also bin ich irgendwann irgendwo gelandet. Ich schaue mich um und sehe - Nebel.
„Vergessen auch hier?“, rufe ich laut und lausche.
Doch da sind weder Echo noch Antwort. Die Nebel schweigen.
Benebelt sind meine Sinne: Mein Augenlicht ist ohne Licht blind.
„Wo bin ich?“, flüstere ich mir zu, höre, rieche nichts und sehe noch immer nur Nebel. Taste mit meinen Händen und fühle feuchtes Gras zu meinen Füßen.
Also bin ich in einer Wiese, an einem anderen Ort zum Leben wiedererweckt. Tief atme ich die Morgenluftfrische. Es riecht nach Erde. Alles kehrt wieder zurück, denke ich, hinweg mit diesen letzten Morgennebeln, es werde Tag!
Und tatsächlich, so geschieht es: gewaltig steigt der Morgensonn auf, lässt Tau und Nebel verdampfen. Neu werden Farben und Bilder geboren. Mild ist der Duft. Freie Sicht für einen Augenblick, bis der Vorhang wieder fällt?
Ich liege auf dem Rücken in der Wiese. Über mir rasen Wolken lautlos ins Nichts. Dann hüllen mich wieder Nebel ein.
Nun gut, geht’s nicht so, dann geht’s eben anders. Ich stehe auf, drehe mich langsam um meine Achse. Und während ich mich weiterdrehe, steige ich auf und schaue hinab, ganz so, wie ich es schon einmal tat.
Welch seltsames Land und doch so bekannt! Ein Land, das ich irgendwo schon einmal sah? Oder nahm es ein anderer andernorts wahr und sandte mir die Bilder zu?
Ja, mein Herr und Meister, der mich nach seinem Ebenbild schuf, Er Dort Oben war es, der es „Nebelland“ nannte, alles erträumte Er sich. Oder aber ... Doch dies nur zu denken, wäre schon „Gotteslästerung“ - und die Strafe folgte sogleich, es sei denn, Er Dort Oben wäre ein gütiger „Gott“ und hörte meine Gedanken, die Er mich denken lässt, und lächelte. Ach ja, ich weiß, Er tut es ja! So kann mir nichts geschehen, also denke ich es zu Ende: Oder aber diese Landschaft entsprang gar nicht Seinem Geist. Er sah sie nicht in sich, sondern mit Seinen Augen irgendwo dort draußen vor sich. Vielleicht war da einst und irgendwo in Seiner Welt nur ein Gemälde an einer Wand, nicht mehr und auch nicht weniger. Viele Jahre könnten seitdem Dort Oben vergangen sein, wenn es denn Dort überhaupt Jahre vergleichbar mit denen hier hunten gibt. Längst könnte das Bild dort nicht mehr hängen, wo es einst hing. Doch was spielt das schon für eine Rolle?!
Einmal vor langer Zeit war Er Dort Oben ganz ergriffen von diesem Bild einer selbst für Ihn so fernen Landschaft mit kiefernbestandenen Hängen und Nebeln in den Tälern. Da konnte Er nicht widerstehen. Also betrat Er dieses Land - doch nur in Seinen Träumen.
Ich aber, der ich bin wie Er, gleite sanft zu Boden, lande sicher auf meinen Füßen, schließe stehend meine Augen. So sehe ich nun, was Er einst sah, sehe Ihn jetzt in einer Stadt mit Namen Kaiserslautern staunend das Gemälde betrachten.
Schon beim ersten Mal war es ihm aufgefallen. Welch grandiose Landschaft, dachte er gänzlich überwältigt von den Bergen, den Nadelbäumen, dem tosenden Bach, der da so tief ins Tal hinunterstürzte, in das weite Land der Inseln und Nebel.
Dann irgendwann, an einem Faschingsdienstag vielleicht, ja, so war es, geschah es. Er besuchte wieder einmal dieses eine Chinarestaurant, das es schon längst nicht mehr in seiner Stadt gibt, betrat wiederum den GOLDENEN DRACHEN. Diesmal setzte er sich so, dass die Landschaft beim Essen ausgebreitet vor seinen Augen lag. Jetzt traute er sich endlich, die ältere Chinesin zu fragen, wo die echte Landschaft, das Vorbild, denn läge.
„Irgendwo in Rotchina“, antwortete sie, die wohl wie die meisten Chinesen zu jener Zeit in Deutschland von Taiwan oder aus Hongkong kam. Genauer wusste sie es nicht.
Aber spielt das denn eine Rolle? Selbst seine Frage, hatte die denn einen Sinn? Was hätte er gewonnen, wenn er es erfahren hätte?
Nun blieb noch das Rätsel der Schriftzeichen oben links in der Ecke. Sahen sehr chinesisch aus, wunderbar gemalt in seinen Augen. Doch ohne Klang in seiner Kehle, für ihn nur Bilder und keine Worte. Denn sein Chinesisch war nun mal nicht sonderlich, genau genommen, gar nicht existent. So war es eben damals zu seiner Zeit in seiner Welt: Es gab zahlreiche Sprachen. Doch die meisten Menschen hatten nur eine gelernt. Wie auch immer, an diesem einen Tag war er mutig und fragte die Chinesin ein zweites Mal, diesmal nach der Bedeutung der Schriftzeichen.
„Poesie“, lautete ihre Antwort.
Vielleicht wusste sie auch nicht mehr oder konnte es gar nicht lesen und schon gar nicht übersetzen. Wer weiß, wer weiß!
Mehr erfuhr er damals nicht und niemals mehr in seinem kurzen, langen, ewigen Leben. Er aß seine Suppe, Hühnerfleisch mit Reis, trank Jasmintee dazu, bezahlte und ging.
Zu Hause träumte er von der chinesischen Landschaft. In seinem Traum ging er zum Bild hinüber. Das Restaurant war leer, er konnte sich nicht erinnern, wie er hineingekommen war. Aber das war ohne Bedeutung. Er war zurückgekehrt zu dem, was ihn schon so lange gerufen hatte. Er war dem Ruf gefolgt, aber nicht dem Ruf der Mondin und nicht dem Leuchtenden Pfad. So stand er allein und klein und staunend so nah wie nie zuvor davor.
Seltsam nur war, dass er sich zugleich von seinem Stammplatz aus vor dem Bild stehen sah - Mecki fiel ihm ein, Lektüre aus der Jugendzeit, Abenteuer in Serie in einer Rundfunkzeitung mit Namen Hör zu bei seinen Großeltern. Darin geschah es einmal, was jetzt wieder geschah, was diesmal ihm selbst geschehen sollte?
Ja. Erst stand er nur staunend da, dann wurde er immer kleiner, schrumpfte bis auf die Größe einer Menschenhand, konnte gerade so über den unteren Rand des rahmenlosen Gemäldes schauen. Seine Hände griffen nach vorne, spürten hartes Gestein. Er zog sich hoch. Schon hörte er den Wasserfall in der Ferne tosen. Seinem Oberkörper folgten die Beine.
Jetzt war er im Land seiner Träume. Er lief in die Weite, lief ins Land hinein, dem Nebelland entgegen.
„Ich komme!“, hörte er sich rufen und immer wieder seinen Ruf von den Bergen widerhallen. Doch im Echo waren Silben verlorengegangen: „Komm! Komm!“, klangen die Worte in seinen Ohren.
Rasch lief er, immer weiter, so schnell ihn seine Füße trugen, hin zu der fernen Schlucht zwischen den beiden Gipfeln der Berge. Denn dort lag sein Ziel.
Im Tal
Der Dieb,
der die Augen der Toten isst.
Du willst wissen, wer er ist?
Sein Name ist Rabe.
Worte des Magiers
Ich bin ein Teil von Ihm Dort Oben, denke ich, bin dort, wohin Er ging in seinem Chinatraum, an einem Ort/zu einer Zeit so fern von hier.
Dunkelgrün-schwarz sind da nur Silhouetten von Bäumen. Morgendämmern. Eiseskälte.
Stehe auf einem Bergrücken und sehe hinab.
In der Ferne ragen Bergketten düster auf. Langsam steigen die Nebel empor - oder sinke ich hinab? Alles verschwimmt hinter grauen Schleiern, die sich nun verbinden mit dem Grau des wolkenverhangenen Himmels über mir. Krähen, Elstern und Eichelhäher, auch Amseln und Meisen, Sperlinge und Banden von Staren sehe ich nun - nicht mehr. Alles scheint tot. Kein Vogel am Himmel. Aber noch immer sind da Vogellaute in meinen Ohren.
Was, was, was?, krächzt mein Verstand. Was bedeutet das?
Dabei ist alles doch so einfach, antworte ich mir auch schon selbst: Nebel verdecken die Sicht und schlucken nicht völlig den Schall. So einfach ist das.
Sehe nur noch Schatten von Bäumen. Alles andere ist grau in grau, nebel- und wolkengrau. Ein kleiner Vogel fliegt vorbei, von links nach rechts, so dicht vor meinen Augen. Aber ohne einen Laut. Denn jetzt ist auch jeglicher Gesang verstummt. Stille.
Um so erschreckender ist dann das Krächzen - in Menschenohren, zugleich wunderschönes Singen und Sprechen in den Ohren seiner Art. Das ist der Ruf der Krähe, die da etwas im Schnabel mit sich trägt. Von links, dort vorn aus dem Nebel tauchte sie auf: „Kra kra!“ Und schon ist sie meinen Blicken entschwunden.
Erinnerungen an Bilder in der Stadt, einst vor langer Zeit irgendwo im Westen. Dort lebten und leben wohl noch immer schwarze große Vögel: „Rabenkrähen“. Auf höchster Birkenspitze saß da eine oder einer von ihnen - denn die Geschlechter scheinen dem Menschen gleich - und sah hinab, hob den Kopf, senkte ihn in ständigem Wechsel bei jedem Ruf: „Kra Kra Kra.“
Worte fielen mir einst ein, branden nun wieder empor, kaum dass ich die Krähe sehe:
Eine Krähe am Himmel,
Wolken grau
und Streifen aus Licht,
fern so rot
der Abendsonn.
Hier und jetzt jedoch ist Morgen, leuchtet nirgendwo der Sonn, weder rot noch gelb noch weiß. Und so unglaublich es scheint, er muss doch da irgendwo weit oben sein, sonst wäre die Erde schwarz und kosmisch kalt.
Die Nebelwand verdichtet sich.
Und noch ein Unterschied besteht zwischen gestern und heute, oben und unten, zwischen Erinnerung-Dichtung und Gegenwart-Wirklichkeit: hier im Osten sehen die Krähen ein wenig anders aus. Nicht rabenschwarz, sondern grauschwarz sind sie hier gekleidet. Grauschwarz ist die, die ich eben noch sah. Ach, wie passend zu diesem Land ist doch ihr Menschenname „Nebelkrähe“.
Menschenname - Menschenwelt. Erinnerungen an die Stadt. Nein, ich weine nicht mit den Nebeln, sondern lächle. Voller Sehnsucht sah ich im Sommer den Mauerseglern zu, wie sie „sriih“-schreiend in Formationen über die Dächer rasten, blickte den Tauben beim Abflug nach, lauschte am Abend im Frühling dem Amselmann oben auf dem Wipfel - bin auch jetzt ganz entzückt, entrückt und fange an zu lachen, weiß nicht wieso, tue es einfach, lasse mich prustend zu Boden fallen, drehe mich auf den Rücken, wie einst einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Leben, liege auf dem Rücken im Schoß von Mutter Erde, schließe meine Augen, bin nun still und lausche.
Ach, wie Glaube doch Berge versetzen kann - oder Unglaube Grenzen zieht! Dachte ich doch einst, ich könnte mich als Magier niemals in jedes beliebige Lebewesen dieser Erde verwandeln, und gelänge es tatsächlich, so käme ich ohne Hilfe von außen nie wieder in meine Menschengestalt zurück. Ich dachte es - und so geschah es dann auch im Wald. Nun aber gibt es keine Grenzen mehr, ist alles so einfach und leicht.
Während ich das noch denke, erhebe ich mich auch schon lachend, bewege meine Arme auf und ab. Welch lächerlicher Anblick das sein muss, durchzuckt mich noch ein Gedanke, doch hier im dichten Nebel, wo niemand sonst ist ... Und schon verwandle ich mich in einen großen schwarzen Vogel, schwarz vom Schnabel bis zu den Zehen. Größer als alle Krähen bin ich, der Rabe Kolk. Schlage mit meinen Flügeln, die eben noch Menschenarme und -hände waren, und fliege auch schon flatternd im neuen gefiederten Körper empor. Leise gleite ich durch Nebel, die sich nun immer mehr lichten, schon bin ich darüber, endlich sehe ich aus Vogelaugen hinab, so klar wie nie zuvor.
Dort stürzt von den Bergen das wilde Wasser eines Baches schäumend zu Tal, entschwindet in den Tiefen selbst meinem scharfen Rabenblick. Dunkle Inseln ragen unter mir aus weißen wogenden Nebelwolken auf: aus nackter Erde, aus Stein und von Nadelbäumen bewachsene Inseln.
Lande zum ersten Mal in meinem Leben auf Rabenfüßen in einem Waldameisennest und bade mich darin. Ein Säureregen der vielen Kleinen, der mich nicht tötet, aber die anderen tötet und vertreibt, die da in meinem Gefieder sitzen und mein Blut saugen. Springe heraus, hüpfe davon, wie es auch damals schon meine fernen Verwandten taten, die noch ohne Flügel waren. Verwandle mich wieder - hüpfend zunächst, dann schon laufend und wachsend - in meine alte Menschengestalt zurück.
Ich verharre, lasse all die Bilder und Töne, so wie ich eben noch als Rabe die Welt wahrnahm, noch einmal in mir ablaufen und wundere mich, weshalb ich das Bad im Ameisenhaufen nahm. Hatte ich denn als Rabe oder gar schon als Mensch Flöhe, Läuse oder Zecken an mir?
Ich gehe ein paar Schritte, bleibe staunend stehen.
Mir gegenüber stürzt ein gewaltiger Wasserfall ins Bodenlose. Er ist es. Ich sah ihn einst in meinen Träumen. Ich sah ihn Dort Oben im Bild. Mein Blick folgt ihm so weit, bis er im Nebel verschwindet. Doch das ist ohne Belang. Was zählt, ist nah und real. Das ist auch nicht die tosende Gischt drüben am anderen Ufer. Näher ist der Felsenrand, wo knorrige Kiefern in luftige Leere wachsen.
Meine Augen weiten sich, tief atmet meine Seele ein.
Falle auf die Knie und staune noch immer über dieses träumende Land, das dort unten auf mich wartet, das schon immer in mir war, mich zu sich rief.
Warum?
Ein Traum von einem Land, einem Nebelland. Träume ich noch immer nur, hier oben zu stehen? Oder bin ich längst aus meinem Traum erwacht und wirklich hier und schaue voller Sehnsucht hinab?
Träume gebären Träume. Und so schließe ich meine Augen und atme ein und atme aus und erblicke ihn wieder, sehe ihn vor mir, sich an den Felsen entlangwinden, in endlosen Bahnen hinabschlängeln, meinen Leuchtenden Pfad, der mich einst aus dem Alltagsleben rief, der mich noch immer ruft.
Ich öffne meine Augen - nichts hat sich verändert. Ich lache, verharre noch ein wenig, atme dieses eine Bild ein, das niemals mehr wiederkehrt. Jetzt lebt es in mir.
Und wiederum verwandeln sich die Dinge. Und nichts ist mehr wie zuvor. „Denn ich habe das Nebelland gesehen“, flüstere ich mir zu und weine.
Stille.
Leere.
Eins mit allem.
Irgendwann - es könnten Sekunden, Minuten, aber auch Stunden vergangen sein - stehe ich von dieser fremden, stillen, ach so bekannten Erde auf.
Du bist erwacht in mir, denke ich, denn ich spüre dich, fühle dich und zittere. Denn ich weiß, dass Du durch meine Augen schaust. Du bist jetzt in mir, mein Schöpfer, mein Gott. Du bist in mir und gehst meinen Weg in meiner Welt mit mir und verrätst mir nicht, wer jetzt deinen Körper Dort Oben - wenn du denn einen Körper hast - bewohnt. Ob er leer und verlassen auf die Rückkehr Deiner Seele wartet? Du bist in mir, wir beide sind eins.
Du antwortest nicht. Weil alles nur Illusion ist, nichts weiter als ein Traum?
Und wäre es so, so bleibt mir die Erinnerung, die schon verblasst.
Drei Silben, drei Worte spreche ich nun: „Ich bin ich!“
So ist es. Aus mit den Träumen. Ich stehe auf, gehe zum Abhang, drehe mich um und beginne hinabzusteigen. Es ist, als wichen die Nebelschleier zurück, als neigten sich selbst die Krüppelkiefern vor mir. Spüre keine Kälte mehr. Mein Leuchtender Pfad, der mich hinabführt, hüllt mich wärmend ein. Vorsichtig seitwärts kletternd geht’s rasch vor... Verliere den Halt! Rutsche schneller und schneller. Falle ... noch nicht ins Tal hinab. Ein seltsam geformter Grat fing mich mit steinernen Hand.
„Was nun?“, frage ich mich und schaue hinab und schaue hinauf und schaue hinab.
Du aber, liebe(r) LeserIn, wunderst dich und fragst dich: „Warum klettert Manfred denn als Mensch da rum. Wieso verwandelt er sich nicht noch einmal in einen Raben? Muss das denn sein, ein Abstieg zu Fuß? Wenn einer schon Magier ist, dann sollte er fliegen und schwimmen und schweben, wo immer er kann. Der ist aber blöd. Oder ist der etwa lebensmüde?
Stimmt. Klingt sehr logisch und überzeugend. Doch vieles hätte in unserer Welt anders sein können. Hätte, könnte, könnte sein - war es, ist es aber nicht. Denn es ist, wie es ist.
Also schau einfach zu, wie es weitergeht, schweige und ...
Sieh an, unser Magier hat wohl deinen Einspruch vernommen, der klettert ja gar nicht mehr!
Jetzt reicht’s aber mit dem Gekrabbel, denke ich - warum erst jetzt und nicht schon früher? - und springe kopfüber von meinem Felsgrat hinab ins Tal. Mir voraus fällt blaues Licht, mein Leuchtender Pfad. Noch falle ich einfach nur, halte meine Arme nach hinten angelegt, falle und falle, während mein Körper schrumpft und sich wandelt, die Knochen hohl werden und sich verändern, braunes Gefieder mir wächst, wo vorher nackte Haut, Haare und Kleidung waren. Arme und Menschenhände sind nun Falkenschwingen. Rasend geht es mit angewinkelten Flügeln im Sturzflug hinab, so als wollte ich mich auf eine Beute stürzen. In letzter Sekunde breite ich meine Flügel aus und schwebe, lande sanft, kralle meine befiederten Fänge in Erde und Stein. Sehe an mir hinab und dort aus vierzehigen Fängen fünfzehige Menschenfüße werden und meine Beine wachsen.
Ich schaue mich um - noch immer mit Falkenaugen, die schärfer sind als Menschenaugen es jemals waren, lausche schon mit Menschenohren und rieche mit einer Menschennase.
Dort vor mir jenseits der Wiese liegt ein See.
Ich schließe meine Augen und sehe die Sumpfschildkröten ein letztes Mal sich auf Ästen im Wasser und warmen Steinen am Ufer sonnen. Dann werden sie ihre Winterquartiere aufsuchen, sich eingraben und Monate ruhen.
Enten sehe ich im Winter: Ein bunter Erpel balzt die grau gefleckte Entenfrau an. Am Abend wird er müde, schließt ein Auge, das andere bleibt offen. So ist er immer vor Katze, Fuchs und Wolf auf der Hut. Nun schläft die eine Seite seines Gehirns. Dann schließt er das andere Auge, und die andere Hälfte schläft. So geht es die ganze Nacht hindurch. Das ist der Halbschlaf der Einsamen und aller Enten am äußeren Rand der großen Schar. Die aber, die innen sitzen, das sind die stärkeren, die sich die besten Plätze eroberten, halten beide Augen geschlossen - sie schlafen vollständig und vollkommen.
Ich aber öffne meine Augen und sehe nun wieder mit Menschenaugen weder Tau noch Spinnennetze und auch nicht den Tempel der weißen Kiefer. Denn sie alle sind meinem Blick verborgen. Was ich erblicke, sind die Silhouetten der gewaltigen Berge ringsum. Düster und schwarz sind sie hinter Nebeln fast verborgen. Was mögen sie behüten, was Menschenaugen niemals sahen - niemals sehen werden, weil es verboten ist?
Dort vorn am Rande des kleinen Eichenwaldes taucht eine Wildschweinrotte auf. Eine Schar junger Raben fliegt heran. Wie mutig die sind, ja, Frechheit siegt! Einige reiten gar auf den Rücken der Allesesser. Die Halbstarken üben sich im Liebesimponiergehabe: schlagen Salto in der Luft, fliegen synchron.
Ich schaue ihnen zu und denke - noch immer im Flugtaumelrausch - nur vier Worte, immer wieder und höre auch schon meine Lippen das Mantra summend flüstern:
„Rabe sein im Frühling.
Im Frühling Rabe sein.
Rabe sein im Frühling.“
Zeit rast. Herbst und Winter gehen dahin. Frühling. Es grünt so grün. Gelbe, weiße und rosa Blüten.
Ich finde mich wieder im Körper eines fliegenden Raben, vielleicht tausend Flügelschläge von der Stelle entfernt, wo ich einst landete und wo wilde Schweine Eicheln aßen.
Jetzt höre ich in weiter Ferne die Drachen erwachen. Sie lachen. Welch Gebrüll in Raben- und auch in Menschenohren! Letztere aber gibt es hier nicht. Jetzt nicht. Niemals nie für alle Zeit?.
Noch immer hüllen mich Nebel ein.
Höre die anderen singen, lausche dem Lied und den Worten aus schwarzen Schnäbeln: „Kroar kroar kroar.“ Verstehe: Es ist nicht mehr weit zum Zentrum des Nebellandes.
Sehe einen großen Raben für Augenblicke aus den Nebeln hervor treten. Er fliegt nicht, sondern steht dort still und wartet. Er ist der Wächter, der Posten auf dem Pfosten!
Öffne meine offenen Augen wieder der wirklichen Welt ringsum.
Weiße Wolken umgeben mich gleich Nebeln. Oder verwandelt sich Nebel in Wolken? Sind Nebel und Wolken eins? Wasser sind sie, das aufsteigt, Wasser, das dahinzieht und hernieder nieselt/regnet/prasselt/strömt, Wasser, wie der Bach, der dort unten hörbar plätschert.
Ist es ein Bach oder gar der Atem eines großen Tieres, das dort liegt und schläft und - schnarcht?
Ist es das Lachen der Drachen, das die Berge jetzt vielfach in meine Rabenohren zurückwerfen?
Regen fällt hier oben und unten - überall.
Dann bricht wieder Sonn hindurch. So warm für mich, denn schwarz ist mein Gefieder, so nimmt es die Wärme auf. Schwarz ist mein breiter Schnabel, meine Augen sind schwärzer als die Nacht. Doch mein Herz ist es nicht.
Schwebte ich eben noch Adlern gleich, so schlage ich jetzt einige Male kräftig mit den Flügeln, gleite dann wieder ruhig über dem Tal dahin.
Doch dies - wie alles andere auch - endet einmal, vergeht, ist einigen Erinnerung, anderen längst entfallen.
Schlafe ein im Flug.
Wache auf - nicht im Jenseits, weil ich abgestürzt bin, nein - wache auf in einem Menschenkörper.
Gewaltig geht der Sonn am Horizont auf. Noch ist die Welt kalt von der Nacht, doch schon ist der Tag erwacht. Vögel zwitschern, singen, jubilieren in meinen Ohren, in meinem Geist, der sie als Mensch niemals verstehen, der nicht wie sie singen kann. Denn mir fehlen Vogelschnabel, -syrinx, -ohr, -hirn und -seele.
Erhebe mich von meinem Lager, stehe auf, drehe mich frontal zum Sonn, schließe die Augen, strecke mich, breite meine Arme aus, atme den Duft der frischen Morgenluft. Beuge mich nieder, lasse die Arme fallen und atme aus. Und strecke mich wieder, beuge mich - wieder und wieder - sieben Mal. Dann stehe ich aufrecht und still. Seine Wärme fange ich mit Gesicht, Körper, Armen und den Innenflächen meiner Hände auf. Mein ganzer Körper atmet Seine Energie, ganz so, wie es die Blätter und Nadeln der Pflanzen tun.
Einer sieht alles, schaut nur kurz hin, sieht alles aus Vogelaugen, was dort unten vor sich geht. Es ist der Amselmann dort oben auf dem Wipfel. Er schaut hinab, sieht sich nach Rivalen, Feinden und Frauen um, während er sein Amsellied singt: „Hört mich an, hier bin ich, ein Mann, so jung, so stark! Und das ist mein Revier!“ Er wundert sich nicht, denn er ist ja kein Mensch, ist nicht wie der dort unten, der etwas von einem gefährlichen Vogel zu haben scheint - deshalb tixt er nun doch, denn der dort unten wandelt sich.
Nackt und still und stumm steht der Mensch für einen Augenblick. Dann wächst etwas, wachsen aus Rumpf, Beinen und Zehen, Armen und Händen Zweige, die sich auch schon mit frischem Grün beblättern. Blätter und Grün breiten sich aus. Die neugeborenen Chloroplasten in den Zellen atmen Kohlendioxid der Luft und Sonnenmorgenlicht ein.
Anderes nehmen die Engerlinge und Regenwürmer unter der Erde wahr. Sie verstehen es nicht, und könnten sie es begreifen, so wäre es ihnen sicher egal. Denn Menschenfüße wandeln sich: Wurzeln wachsen heraus, hinaus und hinab in die Erde, suchen Wasser und saugen es ein.
Aus Kohlendioxid und Wasser wird Zucker in seinen grünen Oberflächenzellen, Sonn liefert die Energie, aus Zucker wird Stärke und ... Pflanzenstoffwechsel. Sauerstoff wird frei.
Ein Rabe kommt geflogen. Er landet ganz in der Nähe auf einem anderen Baum und schaut im Gegensatz zum Amselmann, der „Luftfeind“ schreiend jetzt verschwindet, interessiert zu dieser seltsamen Birke, die anders ist als all die anderen, die sich nun rauschend und schüttelnd wieder zurück in einen Menschen verwandelt.
Rundum gesättigt wache ich auf, reibe mir die Augen und - kann mich nicht daran erinnern, was eben noch geschah, muss wohl eingeschlafen sein.
Die Rabin, nicht der Rabe, fliegt hinüber, setzt sich auf einen Ast und schaut dem Menschen tief in die Augen.
Schwarz sind ihre Augen, die da vor mir landet und mich neugierig zu betrachten scheint. Ja, Raben gehören doch zu den intelligentesten Vögeln. Schwarz, denke ich, schwarz ... schließe meine Augen, um mehr zu sehen, zu ergründen, wer sie wirklich ist.
Die waren doch eben noch blau-grau, denkt die Rabin, deren wahren Namen Menschenmünder niemals aussprechen könnten. Denn jetzt sieht sie dort rote Feuer brennen.
Gedanken rasen: Eine Rabin. Wer könnte sie sein? Weshalb schaut sie mich so an. Das kann doch kein Zufall sein! Trafen wir uns früher schon? Eine Frau bist du. Doch wer? Erinnerst du mich an sie, die ich einst verlor. Du - in mir - und du dort draußen? Bist du Nairra in neuem Körper? Weilt ihre Seele in dir? Weine ich nun wieder Tränen um meine verlorene Liebe? Tränen - salzige Wassertropfen oder Tränen aus Feuer, die fern der Außenwelt brennen. Ein Krächzen, ein Singen. Ach ja, eine Rabin war da.Öffnet euch, meine Augen! Öffnet euch und schaut!
Aha! Noch immer sieht sie mich interessiert an, spricht schließlich: „Kroar kroar!“
Ich nix verstehen, nix Rabe, denke ich noch und schlage mir auch schon mit der rechten Hand an meine Menschenstirn: „Ach, was mache ich denn, wieso tue ich nichts? Die Lösung heißt doch Verwandlung. „Hallo, wie geht’s?!“, antworte ich ihr nun aus Syrinx und Schnabel auf rabisch.
Die Rabin aber spricht: „Träume noch ein wenig! Schwebe dann nach Osten! Dort triffst du die Drachen, die jetzt erwachen. Hörst du sie lachen, die da bewachen - schon lange keine Schätze mehr?“ Dann fliegt sie davon.
Und was tue ich? Fliege ich hinterher oder ...?
Ich bleibe, nehme meinen alten Menschenkörper wieder an und denke ein wenig nach über Raben, Zahlen und Magie: Rabenzahlenmagie. Ich sehe Bilder in mir. Ich höre, lebe es: Eins, zwei, fünf, zehn, einhundert.
Eins.
Eine Rabin, ein Rabe - eine Liebe.
Einst im Westen lebte Lug, der große Gott der gallischen Kelten. Lug aber trug auch andere Namen. Er war Lamfada, der mit der langen Hand, Samildanach, der Alleskönner, Meister des Handwerks und der Künste. Ihm verbunden war der Rabe. Heil dem Zauberer und dem Dichter. Er war der Lichte.
Dann war da der Rabe als Diener der Zauberer und Hexen. „Sieh dem Raben nicht zu lange in die Augen, sonst stiehlt er dir deine Seele und fliegt damit davon!“, sprach der Zwerg zu Sneewittchen.
Zwei.
Ein Rabenpaar. Einst lebten zwei Raben, Hugin und Munin, bei Odin. Ihm opferten die Normannen den Abt der Mönche. Odin aber ist Wodan, Gott des Krieges und Vater der Toten, der auf seinem Schimmel Sleipnir durch die Kältewüsten zieht. Wolf und Rabe sind ihm geweiht. Ein Auge gab er für die Weisheit hin, denn er ist der Gott der Dichtkunst und Ekstase. Seine Raben sandte er als Späher aus. Nachts raunten sie ihm ins Ohr, was sie auf ihrem Flug durch die Welt bei Tag gesehen hatten.
Fünf.
Im Frühling finden sich die Paare. Rabe und Rabin, aus eins und eins werden zwei, aus zwei werden mehr. Er bringt ihr einen Leckerbissen und zeigt ihr, was für ein Kerl er ist: segelt dahin, dreht und überschlägt sich. Beide fliegen sie synchron: das ist zeitgleicher, gleichstarker und gleichartiger Flügelschlag ... Eins-sein in Harmonie.