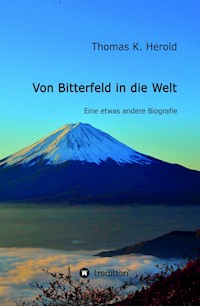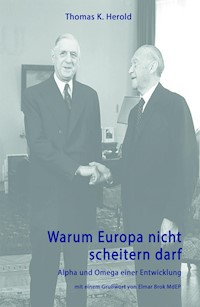
8,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
EUROPA - Mythen, die es gebaren Menschen, die es prägten Menschen, die es zerstörten Menschen die es neu formten Mythen, die es zerlegen Mit einem Grußwort von Elmar Brok MdEP
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
©2017 Thomas Κ. Herold
Foto Titelseite: © Bundesarchiv Β 145, Bild 015892/0010 Ludwig Wegmann CC-BY-SA 3.0 (wikicommons Lizenz 3.0 Deutschland)
Layout u. Umschlaggestaltung: Angelika Fleckenstein, spotsrock.de
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:978-3-7439-6570-6 (Paperback)
978-3-7439-6571-3 (Hardcover)
978-3-7439-6572-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Thomas K. Herold
Warum Europa nicht scheitern darf
Alpha und Omega einer Entwicklung
Mit einem Grußwort von Elmar Brok MdEP
Mitglied der Ausschüsse Auswärtiges und Institutionelles des
Europäischen Parlamentes
Widmung
Dieses Buch widme ich meiner lieben Anne,
die die Entstehung dieses Buches mit großer Geduld
und nachhaltiger Kritik begleitet hat
und unseren Kindern Constanze und Christian,
verbunden mit der Hoffnung auf deren
friedvolle und glückliche Zukunft
in einem friedlichen und geeinten Europa.
Grußwort
von Elmar Brok MdEP
„Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Sie ist notwendig für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Dasein als Nation und als geistig schöpferische Völkergemeinschaft.“
Diese Überzeugungen formulierte Konrad Adenauer bereits im Jahr 1954. Bis heute haben die Worte Adenauers nichts an ihrem Eindruck und ihrer Relevanz verloren. Von den vorsichtigen Anfängen europäischer Zusammenarbeit im Bereich von Kohle und Stahl haben die europäischen Staaten einen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Einigungsprozess vollzogen, der Frieden, Freiheit und Prosperität in Europa garantiert hat – und das seit über 70 Jahren. Diese Errungenschaft der europäischen Völker ist weltweit einmalig.
Doch heute, in einer Phase des raschen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Wandels, in der sich die Bürger Europas mit gestiegenen Unsicherheiten konfrontiert sehen, werden diese Errungenschaften der europäischen Einigung schnell aus den Augen verloren. Vereinfachend wird der EU oft überbordende Bürokratie vorgeworfen und die europäische Einigung auf ein wirtschaftliches Instrument herabgewürdigt, das lediglich ökonomische Vorteile für die eigene Nation liefern soll. Solchen Geisteshaltungen, die von einigen Politikern in populistischer Weise zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt werden, müssen wir entschlossen entgegentreten. Insbesondere müssen die Generationen, die den europäischen Einigungsprozess vom Schrecken der Nachkriegszeit über den Fall des Eisernen Vorhangs bis zum heutigen Tage miterlebt haben, den jüngeren europäischen Bürgern ein Verständnis für die historischen Dimensionen der EU vermitteln.
Es geht allerdings nicht nur um ein Verständnis der heutigen Europäischen Union. Es gilt das historische und kulturelle Erbe Europas, das bereits Jahrhunderte vor der Schaffung der EU begann, zu vermitteln. Denn das heutige Europa ist auf drei Hügeln erbaut worden: Auf Golgatha, der Akropolis und dem Kapitol. Das ist es, was Konrad Adenauer schon 1954 beschrieb. Die europäische Einigung der vergangenen sieben Jahrzehnte ist die Verwirklichung historischer Träume, deren kulturelle Basis auf die griechischen und römischen Hochkulturen sowie auf die Entwicklung des christlich-jüdischen Werteverständnisses und auf die Aufklärung auf dem europäischen Kontinent zurückzuführen ist.
Nur mit einem Verständnis dieser historischen Ursprünge können wir die Tragweite der durch die EU verwirklichten europäischen Einigung nachvollziehen. Das vorliegende Werk leistet einen schönen Beitrag zur Beleuchtung dieser historischen Entwicklung; zugleich erarbeitet der Autor unsere Verantwortung und Aufgaben für die europäische Einigung in der heutigen Zeit heraus. Denn das Verstehen unserer gemeinsamen europäischen Geschichte gibt uns nicht nur Anlass sich zufrieden zurückzulehnen und mit Stolz auf das Erreichte zu blicken. Vielmehr gibt es uns auch die nötigen Instrumente an die Hand, zu verstehen, wie wir den großen Herausforderungen, mit denen wir Europäer uns in dieser Zeit konfrontiert sehen, gemeinsam gegenübertreten können, ohne dass unsere europäische Einigkeit an eben diesen Herausforderungen zerschellt. Das vorliegende Buch bietet hierfür eine nüchterne und kritische Analyse. Es stellt dar, welche Herausforderungen wir Europäer zu meistern haben, welche Gefahren uns auf diesem Weg auseinanderzubringen drohen und was uns trotz allem verbindet.
Die Lektüre dieses Werkes sowie ihr klares Bekenntnis zur europäischen Integration motiviert für ein geeintes Europa zu kämpfen. Die EU steht an einem Scheideweg, an dem wir unsere gemeinsamen Herausforderungen beherzt anpacken müssen – oder aber an ihnen scheitern werden. Wie die Gründerväter unserer Europäischen Union, haben wir dabei jeden Tag die Chance uns auf das zu besinnen was uns eint, statt die Geister zu beschwören die uns teilen. Ergreifen wir die Chance für ein geeintes Europa zu kämpfen. Es lohnt sich!
Dieses Buch wird uns helfen, das europäische Projekt in seiner ganzen politischen, historischen und kulturellen Dimension zu verstehen.
Ich kenne Thomas Herold aus vielen Jahren der Zusammenarbeit in seiner Tätigkeit für die IHK und aus seinen Tätigkeiten in der Zivilgesellschaft. Dabei habe ich immer seine Kenntnisse, sein Engagement und sein Eintreten für christliche und europäische Werte geschätzt.
Grußwort
Vorwort
Einführung
Teil 1
Ein Blick zurück
Die kulturelle Basis Europas
Die griechische Hochkultur
Das römische Weltreich
Untergang des Römischen Reiches
Macht und Religion
Religion und Kirche
Religion bzw. Kirche als staats- und machtpolitischer Faktor
Die großen monotheistischen Religionen
Das Judentum als Basis großer Weltreligionen
Europa und das Christentum
Europa und der Islam
Dynastien und deren Bedeutung für die Entwicklung Europas
Der Weg Europas in die Neuzeit
Karl Martell (686–741) Hausmeier der Merowinger
Karl I. „der Große“ (742-814) Karolinger
Otto I. „der Große“ (912–973) Liudolfinger oder auch Ottonen
Heinrich IV. (1050–1106), Salier
Friedrich I. gen. Barbarossa (um 1122–1190), Staufer
Das Selbstverständnis des Christentums zu Beginn der Neuzeit
Ergebnisse der Kreuzzüge
Das „neue“ Rom –der Vatikan und seine weltliche Bedeutung
Der Weg zu Martin Luther
Kaiser Karl V. (1500-1558), Habsburger
Von der Reformation zum Westfälischen Frieden (1517–1648)
Martin Luther und andere Reformatoren
Die Bauernkriege (1524–1526)
Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648)
Vom Westfälischen Frieden zum Wiener Kongress (1648–1814)
Ludwig XIV. 1638–1715
Peter I. (der Große) 1672–1725
Maria Theresia 1717–1780
Friedrich II. (der Große) von Hohenzollern 1712–1786
Katharina II. (die Große) 1729–1796
Napoléon Bonaparte 1769–1821
Der Wiener Kongress und seine Folgen
Taktgeber der Verhandlungen:
Charles-Maurice de Talleyrand (1754–1838)
Klemens Wenzel Fürst von Metternich (1753–1859)
Karl August Fürst von Hardenberg (1750–1822)
Karl Robert Graf von Nesselrode (1780–1862)
Das Ergebnis
Die Bedeutung des Osmanischen Reiches für das damalige Europa
Europa als geografischer Begriff
Die Entwicklung nationalstaatlicher Gedanken
Entstehung europäischer Nationalstaaten
Die großen Nationalstaaten Europas
Europäische Kolonialreiche
Die wirtschaftlichen Dimensionen dieser Entwicklung
Die „Entstehung“ und „Vernichtung“ Deutschlands
Vom Wiener Kongress zum Ende des 1.Weltkrieges (1815–1918)
Der Deutsche Bund
Der Deutsche Zollverein
Der Norddeutsche Bund und die deutschen Einigungskriege
Das zweite Deutsche Kaiserreich
Otto von Bismarck, (1815–1898)
Kaiser Wilhelm I. (1797–1888)
Kaiser Wilhelm II. (1859–1941)
Der 1. Weltkrieg
Von der Weimarer Republik zum Ende des 2. Weltkrieges (1918–1945)
Die Weimarer Republik
Friedrich Ebert (1871–1925)
Walther Rathenau (1867–1922)
Gustav Stresemann (1878–1929)
Aristide Briand (1862–1932)
Heinrich Brüning (1885–1970)
Franz von Papen (1879–1969)
Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi (1894–1972)
Das 3. Reich
Adolf Hitler (1889–1945) und seine deutschen Helfer
Der 2. Weltkrieg und die Vernichtungsfeldzüge
Der Holocaust
Das Ende
Das Erbe
Teil 2
Vom Ende des 2. Weltkrieges zur Gründung der Montanunion (1945–1951)
Die vorläufige Neuordnung Deutschlands
Josef Stalin (1878–1953)
Franklin D. Roosevelt (1882–1945) Harry S. Truman (1884–1972)
Winston Churchill (1874–1965)
Die Entstehung der Bundesrepublik und der DDR sowie deren Einordnung in die jeweiligen Bündnisse
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
Warschauer Pakt
Die Montanunion als Nukleus eines friedlichen Europas
Jean Monnet (1888–1979)
Robert Schuman (1886–1963)
EWG oder EFTA?
Von der Gründung der EWG zur Europäischen Union (1958–1993)
Die Gründerväter der EWG
Konrad Adenauer (1876–1967)
Josef Bech, Luxemburg (1887–1975)
Johan Willem Beyen, Niederlande (1897–1976)
Alcide de Gasperi, Italien (1881–1954)
Sicco Mansholt, Niederlande (1908–1995)
Paul-Henri Spaak, Belgien (1899–1972)
Altiero Spinelli, Italien (1907–1986)
Walter Hallstein (1901–1982)
Die Deutsch-Französische Freundschaft und die Befriedung Europas
Frankreich nach 1945
Charles de Gaulle (1890–1970)
Die Schritte hin zur EU
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)
Die Europäischen Gemeinschaften (EG)
Die Europäische Union (EU)
Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
Die Entwicklung der Mitgliedschaften
Griechenland –Alpha und Omega
Von Troja nach Brüssel – oder die List der Griechen
Der Zusammenbruch des COMECON sowie die Entwicklung dahin
Willy Brandt (1913–1992)
Michail Gorbatschow (1931)
Helmut Kohl (1930–2017)
Wiedervereinigung und Aufnahme der DDR in die EU
Aufnahme weiterer ehemaliger COMECON-Mitglieder in die EU
Die vier Grundfreiheiten des Vertrages von Maastricht und deren Realisierung
Das Abkommen von Schengen (1993)
Die Dubliner Übereinkommen [DÜ] (1997)
Auf dem Weg zur Osterweiterung der EU
Der Vertrag von Amsterdam (1999)
Der Vertrag von Nizza (2003)
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa (2004)
Der Vertrag von Lissabon (2009)
Grexit, Brexit und die Folgen für die EU der 27
Auswirkungen des „Grexit“
Auswirkungen des „Brexit“
Die Folgen für die EU der 27
Europäische Kulturen im Wandel der Zeiten, sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung Europas und der EU
Gibt es Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte oder hat die EU, so wie sie konstruiert wurde, eine Chance?
Was spaltet Europa?
Was könnte Europa verbinden?
Teil 3
Bewertung und Ausblick
Nachwort
Epilog
Anhang
Das klassische Griechenland und seine – meist verbalen –Auswirkungen auf unseren modernen Sprachgebrauch
Homer
Solon (um 640–ca. 560 v. Chr.)
Pythagoras von Samos (ca. 570–ca. 510 v. Chr.)
Heraklit (535–475 v. Chr.)
Perikles (um 490–429 v. Chr.)
Sokrates (469–399 v. Chr.)
Platon (427/8–347/8 v. Chr.)
Aristoteles (384–322 ν. Chr.)
Archimedes von Syrakus (ca. 287–212 v. Chr.)
Sparta
Hybris und Nemesis
Die „alten Römer“ und ihre konkreten Auswirkungen auf unseren modernen Alltag
Cicero (106–43 v. Chr.)
Cäsar (100–44 v. Chr.)
Varus (47/36 v. Chr.–9 n. Chr.)
Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.)
Tacitus (58–120)
Übergreifende Fakten zur Antike
Weltreligionen
Das Judentum
Das Christentum
Der Islam
Der Buddhismus
Der Hinduismus
Naturreligionen
Wichtige Herrscherhäuser in Zentraleuropa im Mittelalter und in der Neuzeit
Habsburger
Hohenzollern
Karolinger
Liudolfinger
Merowinger
Romanows
Salier
Staufer
Die wichtigsten Parteien während der Weimarer Republik
Die sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum)
Deutsche Demokratische Partei (DDP)
Deutsche Volkspartei (DVP)
Deutschnationale Volkspartei (DNVP)
Bayerische Volkspartei (BVP)
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
Sonstiges:
Bibliographie
Namensregister
Über den Autor
Danksagung
Vorwort
„Tief unglücklich die Seele, die sorgend die Zukunft bedenkt.“ Lucius Annaeus Seneca, ca. 4 v. Chr.–65 n. Chr., römischer Rhetoriker, Politiker, Philosoph und Schriftsteller
Mit dieser Arbeit will ich versuchen, die heutigen Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union aber auch die jetzt gegebenen Widersprüchlichkeiten aus der Historie Europas heraus zu erklären. Es sollen die Wurzeln der derzeitigen Situation aufgezeigt werden; kulturelle Besonderheiten, die sich im Laufe der Jahrtausende geformt haben, aber auch Gegebenheiten, die aus der jeweils historischen Sicht unserer Vorfahren richtig oder zumindest akzeptabel erschienen, für uns Heutige aber wie Ballast beim Versuch wirken, eine friedvolle Zukunft zu organisieren. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, will ich versuchen darzulegen, warum es aus meiner Sicht keine sinnvolle Alternative zu dem Weg gibt, den die Väter des heutigen politischen Europas beschritten haben – trotz, oder vielleicht auch gerade wegen des nun seitens der britischen Bevölkerung mittels Referendum entschiedenen Austritts Großbritanniens aus der EU („Brexit“). Obwohl in Österreich die Wahl des konsequenten Vertreters der europäischen Entwicklung zum Staatsoberhaupt einen gewissen Lichtblick darstellt, muss man doch inzwischen immer mit Unbehagen an Neuwahlen denken, zuletzt in den Niederlanden, dann in Frankreich, im September in Deutschland und bald in Italien. Die Formulierung des niederländischen Politikers Geert Wilders, der gute Chancen hatte, mit seiner rechtspopulistischen „Partij voor de Vrijheid“ (Partei für den Frieden) stärkste politische Kraft in den Niederlanden zu werden, „Die Leute holen sich langsam ihre Länder zurück“, lässt erahnen, wo die Entwicklung hin gehen könnte. Marie le Pen will aus der EU und dem Euro raus und betrieb mit dieser Forderung Wahlkampf. All diese eher nationalistischen als nationalen Wahlkampfbestrebungen werden „befeuert“ durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA; sein Slogan „America first“ hat gezogen und hat eine starke Wirkung auf europäische Nationalisten. Somit könnte Europa, und zwar nicht „nur“ die EU vor einer Zeitenwende stehen.
Einführung
Friedrich II. (Preußen), der „Große“ oder auch der „Alte Fritz“ genannt, war eine der prägenden Gestalten des europäischen Kontinents im 18. Jahrhundert mit Auswirkungen bis in unsere Tage. So schrieb er kurz nach Regierungsantritt 1740 den berühmten Satz: „Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal nur ein Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue, denn hier muss jeder nach seiner Fasson selig werden.“1 Manchem Leser werden diese Worte aus seiner Schulzeit noch in Erinnerung sein, andere mögen schon davon gehört haben. An Aktualität hat diese Forderung nichts eingebüßt, wie so manches, was im Folgenden noch beschrieben werden soll. Dabei handelt es sich hier nicht um ein wissenschaftliches Werk. Es soll vielmehr vor allem auch der jüngeren Generation, die mit Geschichte leider häufig nicht so vertraut ist, darstellen, wie alles gekommen ist, bzw. in mancher Hinsicht auch kommen musste.
Nichts, und schon gar nicht der Frieden, ist in dieser Welt selbstverständlich! Dies erleben wir jeden Abend in den Nachrichten aus aller Welt. Menschen müssen leiden und sehnen sich nach nichts mehr als eben nach diesem Frieden – und wo, glauben sie ihn zu finden? In Europa, einem Kontinent, auf dem ganz sicher nicht alles in bester Verfassung ist, auf dem aber offenbar doch lebenswerte Zustände herrschen, Zustände, die wir selbst fast nur noch mit kritisch-leidender Miene beklagen! Wo ist der Optimismus derer geblieben, die fest daran glaubten, man könne diesen fast völlig zerstörten Kontinent wieder aufbauen und in eine bessere Zukunft führen? Nicht nur aus diversen Medien, nein, auch aus persönlichem Erleben, erfahre ich immer wieder, dass es offenbar mit dem Geschichtsbewusstsein jüngerer Menschen, zumindest, jüngerer als ich selbst es bin, nicht gut bestellt ist. Bei mir war im Abitur das Fach Geschichte noch mündliches Pflichtfach; heute wird es nur noch am Rande, bald vielleicht schon gar nicht mehr unterrichtet. Nun weiß auch ich, dass man sich mit profundem Geschichtswissen allein nicht unbedingt ernähren kann, es sei denn, man unterrichtet, auf welcher Ebene auch immer, interessierte Menschen. Und trotzdem dürfte es jedem denkenden Menschen klar sein, dass man aus der Geschichte lernen kann, zumindest lernen können sollte. Wenn es denn stimmt, was immer wieder in den Print-Medien berichtet wird, dass nämlich immer weniger Schüler mit Begriffen wie Französische Revolution, SED, Weimarer Republik oder auch mit Namen wie Walter Ulbricht, Konrad Adenauer usw. etwas anfangen können, bzw. nicht in der Lage sind, diese zeitlich und inhaltlich richtig zu verorten, dann ist ganz sicher Alarm angesagt2. Bildung hilft uns vielfach, über Probleme des Alltags, über verwirrende Politik, über persönliche Schwierigkeiten hinweg zu kommen. Dazu muss man nicht ständig Verdun, Auschwitz, die Roten Khmer, oder auch den Abwurf von Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im Kopf haben. Aber derzeit scheinen diese Geschehnisse im Nebel zu verschwinden und damit ihre Schrecken zu verlieren; sie lassen damit Entwicklungen, die in jener Zeit zu diesen Katastrophen geführt haben, als nicht mehr für uns relevant erscheinen. Hier muss angesetzt werden; mit diesem Buch will ich deshalb versuchen, bedeutende Persönlichkeiten der Geschichte vorzustellen, Geschehnisse erzählend, nicht belehrend, einzuordnen und so, auf dem Weg über die Historie, gelebte Gegenwart der „Selbstverständlichkeit“ zu entreißen.
Dabei gilt: Bücher über Europa füllen vermutlich Bibliotheken. Herausragende Autoren sind dabei, diese zu ergänzen. Vor wenigen Monaten hat Ian Kershaw, ein britischer Historiker von höchstem Rang, sein Buch „To hell and back“ unter dem Titel „Höllensturz – Europa 1914 bis 1949“3 in Deutschland vorgelegt. Dort heißt es im Vorwort, dass dies das mit Abstand schwierigste Buch sei, an das er sich je herangewagt habe. Er verweist dabei auf hervorragende Kenner der entsprechenden Historie wie, z. B. auf Harold James, Bernard Wasserstein, aber eben auch auf Heinrich August Winkler, den großen deutschen Historiker der Gegenwart. Er führt weiter aus, dass er sich in diesem Buch (dem ein zweiter Band folgen soll, der Verf.) nur mit der ersten Hälfte eines außerordentlichen und dramatischen Jahrhunderts beschäftigt, mit der Epoche also, in der Europa zwei Weltkriege führte, die Grundfesten der Zivilisation bedrohte und wild entschlossen schien, sich selbst zu zerstören4. Heinrich August Winkler, hat im September d. J. ein, neues Buch mit dem Titel „Zerbricht der Westen?“, vorgelegt. Hierbei handelt es sich um eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme, die der Autor offenbar als eine Art „Weckruf“ verstanden wissen will. Und nun ich, der historisch-literarische „nobody“ mittendrin! Woher der Mut, sich in diese von überragenden Profis besetzte Thematik zu stürzen? Warum ein weiteres Buch, das sich mit Europa beschäftigen will, zumal geschrieben von einem „nur“ interessierten Zeitgenossen? Alles ist eigentlich gesagt, alles verinnerlicht und damit über Generationen selbstverständlich geworden; und eben hier liegt aus meiner Sicht das Problem! Im Diskurs der Bevölkerung – hier ausdrücklich der deutschen – spielt Europa als Europäische Union eigentlich keine Rolle mehr; seit Jahrzehnten herrscht hier Frieden, problemloses Überschreiten von Grenzen, eine weitgehend einheitliche Währung, mögliche Anerkennung von Studienabschlüssen innerhalb der Union usw. usw. Alles selbstverständlich und gut entwickelt, wenn, ja wenn da nicht die Bürokratie in Brüssel bzw. Straßburg wäre, wenn da nicht Lücken in der Konstruktion des Euro wären, wenn da nicht beim Beitritt zur Union getrickst und betrogen worden wäre usw. usw. So will und kann ich hier kein wissenschaftliches Werk, basierend auf Grundlagenforschung und möglicherweise daraus folgenden neuen Erkenntnissen vorlegen, sondern ich möchte eher von den, wie ich denke, wichtigsten Geschehnissen der europäischen und deutschen Geschichte erzählen, bzw. hierüber holzschnittartig, und womöglich kurzweilig berichten – ohne Apparat, ohne Assistenten, ohne ein hierzu vielleicht berechtigendes Studium. Mit viel Glück wird es mir dann gelingen, durch Persönlichkeiten und aus den Geschehnissen einer teils schon lange versunkenen Vergangenheit wichtige Erkenntnisse für die Gegenwart und vor allem solche für eine noch möglichst lange friedvolle Entwicklung Europas und damit natürlich auch Deutschlands zu gewinnen. Auch in den Print-Medien setzt man sich immer wieder mit dem „Problemfall“ Europa auseinander. Leider meist nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Skandalen, oder „fehlerhaften“ Entscheidungen, die an der Konstruktion des Apparates oder an den derzeit handelnden Politikern festgemacht werden. Das Erreichte fällt, wie schon mehrfach erwähnt, unter den Tisch, es passt nicht ins Weltbild. Ein Zerrbild Europas? Sicher nicht nur, aber die Gefahr, dass sich dieses Bild allein in den Köpfen der Leser festsetzt, ist eben riesengroß! Hier scheint mir manches Mal die so oft beschworene Verantwortung der Medienvertreter irgendwie ins Schlingern zu geraten. Nicht, dass es keiner Kritik bedürfte, aber diese sollte dann schon erkennen lassen, was denn wie, wo, wann und von wem hätte besser, bzw. nachhaltiger entschieden werden sollen. Einen Artikel, oder ein solches Buch zu schreiben, ist halt etwas anderes, als im Konzert mit heute 27 Mitspielern die richtige, tragende Melodie und dann auch noch in der stimmigen Tonart zu finden.
Nun aber endlich zum Thema! Dabei wird sehr schnell deutlich werden, wie sehr Europa mit der Geschichte bis hin in die Antike verwoben ist – und zwar sogar bis hinein in unser tägliches Leben. Aber: Gab bzw. gibt es in Europa überhaupt so viele Gemeinsamkeiten aus der jahrtausendealten Geschichte, um ernsthafte Probleme gemeinsam nachhaltig lösen zu können? Würden geschichtliche Übereinstimmungen ausreichen, neuere Problemstellungen, wie z. B. Kriege mit der Vernichtung und Ermordung von Millionen Menschen zu überlagern? Oder würden Differenzen, die aus jahrhundertealten Animositäten resultieren, die Lösung aktueller Probleme gar verhindern? Um diese Fragen auch nur ansatzweise beantworten zu können, soll ein Teil dieser Betrachtung dem Versuch gelten, zu verstehen, was dieses „Europa“ überhaupt ist, und wo es herkommt. Wo es hin will bzw. wo dieser Kontinent „enden“ wird, mag sich letztendlich aus dieser Betrachtung ergeben - oder eben auch nicht. Dabei wird der Blick zum Teil bis in die Antike zurückgehen. Diese Betrachtung von Entwicklungssträngen im Altertum, aber auch die beispielhaft herangezogenen Geschehnisse im Mittelalter und in der Neuzeit können natürlich nur holzschnittartig sein und keinesfalls einen irgendwie gearteten wissenschaftlichen Anspruch erheben bzw. einem solchen genügen; zur Beurteilung von aktuellen Schwierigkeiten und eben auch Erfolgen sind sie allerdings unverzichtbar und reichen hierfür hoffentlich aus.
Teil 1
„Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung.“ Dietrich Bonhoeffer
Ein Blick zurück
Bevor man all diesen sehr aktuellen und somit eben sehr praktisch-politischen Fragen nachgeht, ist wohl zu klären, was man eigentlich unter dem Begriff „Europa“ versteht. Der Begriff selbst ist uns aus der griechischen Mythologie, der jüngeren Geschichte, aber auch aus der Geografie und der aktuellen Politik geläufig. Da sich sicher die Zusammenhänge all dieser Themenkreise und Entwicklungen nicht eindeutig und unwidersprochen erklären lassen, ist zu Beginn der Betrachtung aktueller europapolitischer Fragen der Versuch einer Art Begriffsbestimmung sicher angebracht, ohne dabei jeder Spur in „extenso“ bis zu ihren Wurzeln zu folgen.
Oft wird in aktuellen politischen Karikaturen Europa als eine auf einem Stier sitzende weibliche Person dargestellt, und zwar in der Form, wie sie dem jeweiligen Zeichner aus seiner subjektivpolitischen Sicht dazu dient, seine Betrachtung des „Problems“ zu erläutern. Der Stier schaut dann mehr oder weniger freundlich, die auf ihm sitzende „Jungfrau“ mehr oder weniger erfahren bzw. glücklich oder auch erwartungsvoll drein. Immerhin war sie einst die Geliebte des Zeus, des allmächtigen griechischen Göttervaters, der sie, in Gestalt eines Stieres, nach Kreta entführt hat. Derartige Sichtweisen entziehen sich in unserer Zeit einer konkreten Bewertung, da die diesen Bildern zugrunde liegenden „Ereignisse“ seit langem „versunken“ sind. So hat heute deren Betrachtung eher „bildungspolitischen“ Charakter. Ihre Nachhaltigkeit und damit eben auch deren aktuelle politische Präsenz sind jedoch nicht zu übersehen. Man könnte auch feststellen, dass Griechenland, so wie schon vor Jahrtausenden, auch heute für die Geschicke Europas irgendwie „maßgebend“ ist; doch dazu später mehr. Jetzt erst einmal zurück zur Gegenwart!
Die positiven wie negativen Begleiterscheinungen der Europäischen Union lassen erkennen, dass der Weg von 1945 bis in unsere Tage steinig gewesen sein muss, steinig und voller Untiefen politischer und wirtschaftlicher Art. Das, was seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 und deren Inkraftsetzung zum 01. Januar 1958 erreicht und 2008, zum 50. Jahrestag, gefeiert wurde, ließ die Hoffnung aufkeimen, dass der europäische Nationalismus als Grundübel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das immerhin zu zwei verheerenden Weltkriegen mit Millionen von Toten geführt hatte, endlich besiegt und damit Vergangenheit sei!
Seitens der Wirtschaft schien es möglich, mit großen Nationen wie den USA, zuerst noch der Sowjetunion und, aufkommend, der Volksrepublik (VR) China, konkurrieren zu können. Der Euro wurde eine weitere Leitwährung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und schien damit seine internationale Bewährungsprobe bestanden zu haben! Also alles gut? Leider nein! Als 2008 die internationale Finanzkrise, u. a. ausgelöst durch das Platzen der Immobilienblasen in den USA und in Spanien sowie mit dem Zusammenbruch der US-Großbank „Lehman Brothers“ ihren Höhepunkt erreichte, wurden Fakten auch für die Allgemeinheit und eben nicht nur für „Insider“ an die weltwirtschaftliche Oberfläche gespült, deren Existenz bisher schlicht negiert oder gar verleugnet wurde. In der Folge dieser Entwicklung und befeuert durch die Bemühungen, überschuldete Banken weltweit zu retten, wurde diese Bankenkrise zu einem der Auslöser für eine immer dramatischere Staatsverschuldung, denn mit den „toxischen“ Papieren der Bankenwelt hatten eben nicht „nur“ Privatleute, sondern leider auch Privat- und Nationalbanken spekuliert. Aber die Gründe für diese Entwicklung und für das Problem, dieser Herr zu werden, lagen tiefer. Eine konzertierte Aktion der Länder im Euro-Raum war schon deshalb schwierig, weil selbst Staaten, die von Anfang an dabei waren, z. B. Deutschland und Frankreich, die Konvergenzkriterien „gerissen“ und sich auch noch mit Vehemenz erfolgreich gegen eine „Abmahnung“ der EZB gewehrt hatten. Zu alledem kamen dann noch die Tricks weiterer Länder, um die Aufnahme in den Euro-Raum zu erreichen. Alles Geschehnisse, die dem Gedanken an ein wirklich geeintes Europa abträglich waren. Hierauf wird später näher einzugehen sein.
Kaum schien die Währungskrise so einigermaßen überschaubar und – vielleicht sogar – beherrschbar, da brach der Flüchtlingsstrom, der, im Wesentlichen aus Afrika kommend, schon latent vorhanden war, mit voller Wucht aus dem Vorderen Orient über Europa herein. Jetzt wurde mit einem Mal fast brutal deutlich, dass es mit der Solidarität innerhalb der EU dramatisch schlecht bestellt ist. Nicht, dass alle Mitglieder prüften, was denn zur Bewältigung dieser Krise zu tun sei, nein, es wurde nur darüber diskutiert, wie man sich am besten abschotten könnte, wie man erreichen kann, dass am besten alle Flüchtlinge nach Deutschland geschickt würden und wie und wo man am besten Mauern errichten könne! Dabei ging es immer um Werte, die es zu verteidigen gelte. Werte? Welche Werte? In Europa wohl die, die wir so ganz allgemein als die des christlichen Abendlandes ansehen. Aber wo kommen die her? Werden sie in Europa, oder konkreter, innerhalb der EU wirklich gelebt? Diese Flüchtlingswelle scheint mit all den Fragen, die sie aufwirft und die beantwortet werden müssen, die EU zu lähmen, wenn nicht gar zu zerreißen! Darf das passieren? Doch wohl nicht! Aber wie ist dieser Entwicklung beizukommen? Zuerst wird man feststellen müssen, dass all die Kompromisse auf dem Weg von der EWG hin zur EU und deren zahlenmäßigen „Erweiterung“ nicht zu Ende verhandelt waren. Konkursrecht für Staaten fehlt, geregelte Austrittsmöglichkeiten aus dem Euro sind nicht vertraglich vereinbart und die Sicherung der Außengrenzen wird zwar vertraglich in den Schengen- und Dublin-Abkommen festgelegt, aber nicht das Verfahren, wie dies erreicht werden soll bzw. kann.
Eine große deutsche Sonntagszeitung beschäftigte sich im Dezember 2015 mit der Frage, ob und, wenn ja, welche in der Vergangenheit liegenden Zusammenhänge und Fakten im Geschichtsunterricht an deutschen Schulen vermittelt werden. Hintergrund war die Frage, ob die heutige Schüler- aber auch Geschichtslehrergeneration in der Lage sei, die Problematik der gegenwärtigen politischen Lage in Europa und vor allem deren möglicherweise katastrophalen Konsequenzen eines Zerfalls der EU zu beurteilen. Die offensichtlich negative Beantwortung dieser Frage ist zumindest bedrückend. Hierzu gehört natürlich auch der Versuch, die Frage zu beantworten, was die Wurzeln unserer heutigen europäischen Realität sind, wie und warum vor allem sie so zustande kam und was zu tun ist, das mühsam Errungene zu bewahren und weiter zu entwickeln.
Warum aber haben sich Männer wie z. B. Jean Monet und Robert Schuman darangemacht, eine in weit zurückliegender Vergangenheit geborene Zwietracht aufzulösen und den Versuch eines grundsätzlichen Neuanfangs gewagt? Darf die so ausgelöste epochale Entwicklung in der Tagespolitik späterer Jahre untergehen?
Jetzt, da dieses Buch entsteht, ist zu erkennen, dass womöglich alle Bemühungen um einen geeinten Kontinent umsonst gewesen sein könnten. Ganz aktuell (23.06.2016) hat ein Referendum in Großbritannien ergeben, dass dessen Bürger wollen, dass das UK aus der EU austritt. Warum dieser Austritt, warum eine Rückkehr nationaler, ja teils nationalistischer Tendenzen in einer ganzen Reihe von EU-Mitglieds-Staaten?
Fragen über Fragen. Dieses kleine Büchlein soll Antworten versuchen und vor allem die wachrütteln, die mit den Geschehnissen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, geschweige denn mit weiter zurück im Dunkel der Geschichte liegenden Epochen kaum etwas anfangen können, oder, schlimmer noch, diese nicht kennen und/oder damit nichts mehr zu tun haben wollen.
„Die zentrale Stellung des Menschen in der abendländischen Philosophie und Theologie scheint mir der Kern der eigentlichen europäischen Kultur in allen ihren Ausdrucksformen zu sein.“
Dr. Konrad Adenauer, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949-1963.
Die kulturelle Basis Europas
Folgt man diversen Deutungsversuchen, dann ist die entführte „Europa“ wohl „die (Frau) mit der weiten Sicht“. Einige Etymologen gehen allerdings davon aus, dass der ursprünglich aus einer semitischen Sprache stammende Begriff durch mehrere sprachliche „Übernahmen“ zu „erob“ gleich „dunkel“ oder „Abend“ wurde, woraus wiederum ein Hinweis auf das „Abendland“ gegeben wäre. Ein interessanter Erklärungsansatz, wenngleich umstritten. Weniger geheimnisvoll ist da die schon erwähnte Erklärung, vom Göttervater, und der von ihm entführten Tochter des phönizischen Königs Agenor, die „Europa“ hieß. Eine in sich schlüssige und allein stimmige Erklärung für die Herkunft des Begriffes „Europa“ gibt es wohl bis heute nicht.
Ganz anders Ferdinand Seibt: „Europa ist nicht die Erfindung moderner Politiker. Es entstand auch nicht 1952 mit den Vorläufern der Römischen Verträge. Europa besteht als politische Größe seit mehr als tausend Jahren. Es unterscheidet sich allerdings von jenem alten, vom klassischen Europa in der antiken Welt vor zweivor dreitausend Jahren, das man gern als seine Grundlage bezeichnet, benannt nach der Jungfrau, die der Stier von Asien nach Kreta entführte. Doch die antike Mythologie ist letztlich kein hinreichender Beitrag zur neueren europäischen Selbstdefinition.“ Mit diesen Worten beginnt Ferdinand Seibt sein Werk mit dem Titel „Die Begründung Europas“5.
Die griechische Hochkultur
und deren Einfluss auf die weitere Entwicklung in der Region, die wir heute „Europa“ nennen
Es kann vor dem Hintergrund dessen, was dieses Buch bezwecken will, nicht auf all die überragenden Repräsentanten der griechischen Geistes- und Naturwissenschaft im Einzelnen eingegangen werden – das würde den Rahmen sprengen. Einige Gedankengänge bzw. Reflexionen dieser unsterblichen Männer müssen allerdings schon dargestellt bzw. erläutert werden. Dabei zeigt allein unser heutiger Sprachgebrauch, wie selbstverständlich, wenn auch meist unbewusst, wir manche unserer Einstellungen und Bewertungen aus der griechischen Mythologie schöpfen. Auf wen im einzelnen Sprachgebrauch und ähnliches zurückzuführen sind, mag der interessierte Europäer im Anhang nachlesen.
Einen wohl ersten geografischen Hinweis auf „Europa“ findet man offenbar bei Herodot, dem laut Cicero als „Vater der Geschichtsschreibung“ geltenden griechischen Gelehrten, der im 5. vorchristlichen Jahrhundert lebte. Er bezog diesen Begriff erstmals auf die Räume, die nördlich des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres liegen und gab ihm so auch eine Art „geografischer“ Einordnung, vielleicht sogar Bedeutung. Es gab ja schließlich auch eine Besiedlung all dieser Gebiete rund um das Mittelmeer und wohl auch um das Schwarze Meer durch die Griechen. „Die Griechen“, das war nicht etwa ein wie auch immer gearteter Staat, sondern dies waren eher die jeweiligen Stadtstaaten, von denen, aus demographischen oder auch sonstigen lebenswidrigen Gründen, Menschen „auswanderten, um sich neue Lebensräume zu suchen“6. Damit ist festzuhalten, dass der Einfluss Griechenlands auf unser heutiges Leben bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich der griechischen Antike und damit einer uralten Hochkultur geschuldet und damit eher philosophisch als länderbezogen oder gar politisch gewesen ist. Die europäische Gegenwart sieht da ganz anders aus!
So viel zu griechischen Philosophen, Denkern und Politikern. Es soll hier einfach festgehalten werden, inwieweit diese noch – bewusst oder unbewusst – unser Denken und Handeln beeinflussen. So leben wir bis heute im „Abendland“, der aus damaliger griechischer Sicht der untergehenden Sonne am nächsten gelegenen Teil Europas. In diesem „Abendland“ haben sich die griechischen Ansätze bzw. auch Maxime eines demokratisch verfassten Staates nachhaltig realisiert usw. Im Anhang wird näher auf diese kulturhistorischen Zusammenhänge eingegangen.
Das römische Weltreich
und der Einfluss seiner Philosophen und Politiker bis in unsere Zeit
Ganz anders das Römische Reich, das neben seinem ebenfalls überragenden philosophischen Einfluss auch geografisch nachhaltige, uns bis heute beeinflussende Entwicklungen, nicht zuletzt auch machtpolitischer, sprich kriegerischer Art, in Gang gesetzt hat. Während sich die Griechen im Altertum im Wesentlichen um die Küsten des Mittelmeeres „kümmerten“ – Alexander der Große war Makedonier und spielt in unseren Überlegungen zu Europa trotz seiner bemerkenswerten Eroberungen keine spezielle Rolle –, dehnten die Römer ihren Machtbereich bis hin nach Großbritannien und Germanien im Norden, Frankreich im Westen und auf die Iberische Halbinsel im Süden Europas sowie in den Norden des afrikanischen Kontinents aus. Hier entstand ein Staatsgebilde, das nach einheitlichen Regeln aufgebaut war und wohl auch funktionierte. Nicht zuletzt eine kluge Politik, die die Eliten der Unterworfenen förderte und deren Bewohner zu römischen Bürgern machte, bewirkte eine erstaunliche Stabilität dieses Staatswesens, das auch durch ein den gesamten Staat zusammenführendes Straßennetz sowie Aquädukte, Brücken und beeindruckende Städte gekennzeichnet war7.
Wer waren aber die großen, die bedeutenden Denker und Staatsmänner dieses Kulturbereiches und Staatswesens? Sie alle, die über Jahrhunderte das damalige – geografische – Europa dominierten bzw. beeinflussten, hier zu nennen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Ich verweise hierzu auf den Anhang, wo zu diesem Thema interessante Stichworte zu finden sind.
Am Anfang der für uns noch heute so bedeutenden Entwicklung soll dabei deren Ausgangspunkt, nämlich die Gründung Roms, stehen. Als Schüler lernten wir: „753 – Rom kroch aus dem Ei.“ Bis 507 v. Chr. bestand das von dort regierte Königreich. Insgesamt sieben Könige hinterließen mehr oder weniger nachhaltige Spuren. Kulturell war es stark von den Etruskern beeinflusst, einem Volk, dessen Herkunft und innere Strukturen bis heute Rätsel aufgeben. Es folgte das Zeitalter der Republik, in der jeweils zwei Konsuln an der Spitze des Staates standen; sie wurden für jeweils ein Jahr gewählt. Außerdem gab es Senatoren, die in der Regel auf Lebenszeit gewählt wurden und über großen Einfluss verfügten; sie bildeten gemeinsam den „Senat“ (It. Fremdwörterduden „Rat der Alten“).
Den Übergang von der Republik zum Kaiserreich kann man mit Cäsar „personalisieren“. Allein sein Name – Cäsar, Kaiser, Zar – prägte bis in die Neuzeit hinein „moderne“ Staatsformen. Nach Feldzügen in Gallien und in Afrika und der abschließenden Auseinandersetzung mit seinem „Mitregenten“ wurde er auf dem Höhepunkt seiner Macht in Rom ermordet.
Stärker im Bewusstsein der heutigen Menschen als einzelne der im Anhang erwähnten Persönlichkeiten, ist die Tatsache, dass vor allem das Rechts- und Staatswesen Europas stark vom Römischen Recht geprägt ist. Das gilt vor allem für elementare „antike“ zivil- und strafrechtliche Verfahrensvorschriften, die vom Grundsatz her in die modernen Rechtsnormen eingeflossen sind. So war das „Römische Recht“ in unterschiedlicher Ausprägung seit seiner Entstehung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts von ausschlaggebender Bedeutung für die Rechtsprechung in weiten Teilen Europas, also auch im Deutschen Reich. Erst mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 1900 wurde einheitliches deutsches bürgerliches Recht geschaffen. Nicht zu übersehen ist hier auch das „Kanonische Recht“, also das kodifizierte Kirchenrecht. Promovierte ein Jurist an einer deutschen Universität, so erhielt er, wenn die Voraussetzungen gegeben waren, den Titel „Dr. beider Rechte“. So stammt offenbar auch der heute noch gültige Rechtsgrundsatz „Verträge müssen eingehalten werden“ (pacta sunt servanda) aus dem kanonischen, also Kirchenrecht. Selbst in diesem BGB, das am 01. Januar 1900 in Kraft gesetzt wurde, sind klare Grundsätze des römischen und wohl auch kanonischen Rechts erkennbar. So galt schon beim römischen Kaiser Justinian I., dass der den Beweis erbringen muss, der etwas behauptet, nicht der, der leugnet. Und im Grundsatz, „im Zweifel für den Angeklagten“ mag der römische Rechtsgrundsatz „in Zweifelsfällen ist immer die wohlwollendere Auslegung vorzuziehen“, nachwirken. Auch dass nicht zweimal in derselben Sache entschieden wird, geht offenbar auf römisches Recht zurück.
Aber auch die Macht und die Gestaltungskraft der Römer waren endlich. 395 n. Chr. wurde das Imperium Romanum, wenn auch nicht rechtlich, so doch faktisch in zwei Teile geteilt.
Untergang des Römischen Reiches
(um 480 n. Chr. Westrom; 1453 n. Chr. Ostrom)
„Westrom“ wurde von Rom, aber auch oft von Ravenna und teils von Mailand aus regiert. Warum „Westrom“ bereits um 480 n. Chr. unterging, ist in der Altertumswissenschaft umstritten. Sowohl äußere als auch innere Umstände und Geschehnisse werden dafür verantwortlich gemacht. Vom Einfall der Hunnen und Perser bis hin zu Bürgerkriegen und Dekadenz der römischen Gesellschaft reichen die Begründungen. Aber auch die germanischen Stämme haben sicher das Ihre dazu beigetragen. Auf jeden Fall starb 480 n. Chr. mit Julius Nepos der letzte von „Ostrom“ anerkannte weströmische Kaiser.
„Ostrom“, auch „Byzantinisches Reich“ genannt, hielt sich dagegen bis 1453 n. Chr., hatte dann allerdings den muslimischen Heeren des Sultans Mehmed II. nichts mehr entgegenzusetzen; Konstantinopel, auch Byzanz und heute Istanbul genannt, fiel in die Hände der Osmanen. Allerdings war das „Byzantinische Reich“ auch schon im Laufe der Jahrhunderte, also nach der Trennung von „Westrom“ kein einheitliches geographisches Gebilde. Im Kampf gegen arabische Heere konnte man sich letztlich nicht behaupten. Die Einnahme von Konstantinopel war da nur der letzte osmanisch-muslimische „Streich“!
Trotzdem steht fest, dass das antike Römische Reich (Imperium Romanum), das man in die Zeit von 800 v. Chr. bis 500 n. Chr. einordnen kann, prägend für Europa gewirkt hat. Dieses Reich erlangte seine größte Ausdehnung zu Zeiten des Kaisers Trajan um 117 n. Chr. Es erstreckte sich bis in den Norden Britanniens, wo sein Nachfolger, Kaiser Hadrian, den berühmten Hadrianswall, der bis in unsere Tage zu sehen ist, zum Schutz vor immer wieder einfallenden Feinden, errichten ließ. Das römische Reich umfasste zu dieser Zeit auch die heutige deutsche Nordseeküste, die Niederlande und Belgien sowie ganz Frankreich und die Iberische Halbinsel. In Afrika gehörten die maghrebinischen Länder und Ägypten, in Asien die Mashrek-Länder, Mesopotamien, die Türkei und nahezu die gesamte Schwarzmeer-Küste zum römischen Reich. Der Kreis schließt sich mit Rumänien und Bulgarien, Griechenland, dem Balkan und natürlich Italien selbst. Germania, wie gesehen mit Ausnahme der Nordseeküste, soweit es östlich des Rheins und nördlich der Donau lag, gehörte nicht zum Römischen Reich. Dessen sicherlich zu Recht als „Imperium“ bezeichnetes Herrschaftsgebiet wurde unter Kaiser Hadrian konsolidiert. Er sorgte für den Bau von Städten, Straßen, Wasserleitungen, er verbesserte die Verwaltung und führte eine Heeresreform durch. Latein wurde zur Amtssprache, die lange über den Bestand des Römischen Reiches hinaus wirkte. Noch heute gelten in vielen Bereichen der modernen Wissenschaft lateinische Fachausdrücke als exakte Beschreibung von Tatbeständen usw. Lange war in Europa Latein die Sprache der Gebildeten und noch heute ist es Amtssprache der römisch-katholischen Kirche. Auch die modernen „romanischen“ Sprachen leiten sich vom lateinischen ab und viele Lehensworte in den germanischen und slawischen Sprachen sind aus dem Lateinischen übernommen worden.
Im Unterschied zum „Römischen Reich“ spricht man seit Mitte des 13. Jahrhunderts auch vom „Heiligen Römischen Reich“ (Sacrum Imperium Romanum), das bis 1806 bestand. Dieses „Heilige Römische Reich“ hat nun allerdings mit den alten Römern so direkt nichts mehr zu tun! Diese Bezeichnung für den damaligen Machtbereich der Ottonen und späterer Geschlechter wollte zum einen die Tradition des antiken Römischen Reiches für sich in Anspruch nehmen, zum anderen aber auch den weltlichen Herrschaftsanspruch durch göttlichen Segen legitimieren. Die römischdeutschen Kaiser, von S. Fischer-Fabian auch „Die deutschen Cäsaren“ genannt, herrschten allerdings nicht über einen Nationalstaat im heutigen Sinne, sondern über ein Gebiet, in dem mehrere Sprachen, vor allem deutsch, italienisch und französisch gesprochen wurden, also mehrere Völker „vereint“ waren; wenn man so will, eine Art mittelalterlicher Vorläufer der „Europäischer Union“, nur dass man da noch nicht von Nationen resp. Nationalismen sprach, bzw. sprechen und somit deren Eigenheiten beachten musste.
Die allmähliche Entwicklung hin zum „Heiligen Römischen Reich“ wird u. a. auch auf das Treffen von König Karl und Papst Leo III. 799 in Paderborn und die dort vereinbarte Krönung Karls zum Kaiser durch Leo III. in Rom im Jahre 800 zurückgeführt. Nicht zuletzt haben wir diesem Geschehen und der meist gewaltsamen Christianisierung seines Herrschaftsbereiches durch Karl den Großen und seine Nachfolger die für das heutige geografische Europa so prägende Entwicklung des Christentums zu verdanken. Wenn auch das Christentum ganz sicher eine eigenständige, in sich geschlossene „Weltanschauung“ ist, fußt es klar erkennbar auf dem Judentum, ist allerdings auch von den antiken Denkern des Römischen Reiches und der Griechen stark beeinflusst worden. Nimmt man diesen Denkansatz bzw. diese Erklärung eines Zusammenhanges zwischen der griechischen Mythologie, staatsbildenden Einfluss der Römer und den, von diesen letztlich geförderten, Glaubensansatz des Christentums als gegeben hin, dann lässt sich schon darstellen, dass diese drei historischen „Überbauten“ eine gemeinsame Grundlage für die Entwicklung des späteren, sprich heutigen Europas bilden können oder gar müssten.
„Religionen sind eine Ausgeburt der Angst. Sie sind die Antwort auf eine unverständliche und grausame Welt.“
Arthur C. Clark (1917–2008), britischer Schriftsteller
Macht und Religion
Die Geschichte, soweit wir sie in die Vergangenheit zurückverfolgen können, zeigt immer auf, dass Menschen, sobald ein Geschehen nicht leicht mit Vernunft zu erklären ist, zur Mystik greifen, ja sich an Gottheiten wenden und von diesen Schutz und Hilfe erwarten. In deren Namen versuchen sie allerdings auch oft ihre Vorstellung vom Leben durchzusetzen – notfalls mit Gewalt! Dabei stellt sich auch in der Tat die Frage, ob, wie wir es in der Bibel lesen können, Gott den Menschen nach seinem „Bilde“ formte, oder ob sich nicht der Mensch, so wie er es in den jeweiligen Situationen benötigt, sich „seinen“ Gott so formt, wie er ihn gerade benötigt?
So ist der Missionsauftrag des Christentums, aber auch die Lehre des Islam sicher meist dahingehend verstanden worden, dass die Vertreter dieser Religionen, versuchten, ihren Glauben, wenn nötig, mit Gewalt zu verbreiten. Dabei ist festzuhalten, dass der Islam eine Missionierung im Sinne des Christentums nicht kennt, sondern davon ausgeht, dass alle Menschen als Muslime geboren werden, eine Erkenntnis allerdings, zu der die Menschen gezwungen werden mussten und offenbar müssen. Die Christen, und damit ihr Glaube, wurden von den Muslimen aus dem, den Christen Heiligen Land gewaltsam vertrieben, diese wiederum versuchten in mehreren Kreuzzügen ihre Stammlande zurückzuerobern. In Lateinamerika haben die Vertreter der europäischen Seemächte Portugal und Spanien, beide tief vom Christentum geprägt, in dessen Namen, d. h. im Zeichen des Kreuzes, dortige, schon sehr lange bestehende Religionen und Kulturen ausgerottet, und das nicht nur, um den (friedliebenden) christlichen Glauben zu verbreiten, nein, auch und vor allem wohl, um die Macht ihrer Heimatländer, bzw. die deren Herrscher, zu stärken und dabei so ganz nebenbei auch noch deren Glauben zu verbreiten. Ist also das, was wir heute in Syrien und den Stammlanden der Menschheit erleben müssen, wirklich so neu, wirklich so „unchristlich“? Verniedlichen wir das damalige Geschehen im Namen des Kreuzes, weil wir noch heute die spärlichen Reste großer südamerikanischer Kulturen bewundern können, verbunden mit der leicht gruselig angehauchten Frage, wie und warum sie denn wohl verschwunden seien. Vor allem der Spanier Francisco Pizarro steht für diese nicht sehr ruhmreiche Zeit des Christentums und der staatlich eingesetzten spanischen „Conquistadores“
Der Islam ist mit Gewalt über Nordafrika hergezogen und hat sich auch über die Meerenge von Gibraltar nach Europa verbreitet – jedoch, wie man aus der Geschichte Spaniens lernen kann, nicht immer zu dessen Nachteil. Spätere, auch mit Waffengewalt voran getriebene Machtbestrebungen dieser Religion gingen in Richtung Frankreich und über die Mashrek-Länder eher in nördliche Richtung, wobei sich der Islam dann schlussendlich dauerhaft im Mittleren Osten, in Teilen Afrikas und in der Türkei festsetzte.
Diese, sicher etwas vereinfachende Betrachtung der Verbreitung zweier großer monotheistischer Religionen soll nur belegen, dass Religion, also Friedfertigkeit und Nächstenliebe, eben sehr oft auch mit Gewalt verbunden sind – „Und willst Du nicht mein Bruder sein, …!“ Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch innerhalb der Religionen erbitterte Kämpfe – im wahrsten Sinne des Wortes – ausgefochten wurden und werden: Katholiken versus Protestanten; Sunniten versus Schiiten usw.! Aber auch im Judentum existieren tiefverwurzelte Feindschaften zwischen orthodoxen und liberalen Vertretern dieses Glaubens. Immer im Namen Jahwes, immer im Namen Gottes, immer im Namen Allahs! Dabei berufen sich diese drei Religionen ja auf einen Stammvater – aber es ist wie im wirklichen Leben: Wo kein Testament, gibt es zwischen den Erben eben Streit, und den manchmal sogar bis aufs Messer! Lessing hat dieses Problem sehr eindrucksvoll und eben auch zeitlos thematisiert (s. auch Seiten 43 und 44).
Im Jahr 2000 erschien ein Werk mit dem Titel „Wo Gott wohnt“. Hier werden prähistorische Kultstätten, jüdische Synagogen, christliche Kirchen, buddhistische und hinduistische Tempel, japanische Schreine sowie islamische Moscheen vorgestellt, die die Suche der Menschheit nach Schutz und Geborgenheit belegen. Eine entsprechende Ausstellung hierzu fand im Bertelsmann Haus, Unter den Linden 1, in Berlin statt. Die Verfasser des Buches sind Claus Jacobi und sein Sohn Tom als Fotograf8. Einladend hieß es am Gebäudeeingang:
WO GOTT WOHNT
HEILIGE STÄTTEN DER MENSCHHEIT
Die Menschen benötigten Götter
und Religionen zum Überleben wie
Essen und Trinken. Sie gaben ihnen Halt,
Trost und Hoffnung, sie lieferten
ein Koordinatenkreuz für gut und böse,
richtig und falsch. Seit die Gestalt
des Zweibeiners im Zwielicht
vorgeschichtlichen Dunkels auftauchte,
hat er sich Plätze geschaffen, seinen
Göttern nah zu sein und deren Macht zu
spüren. Um zu bitten und zu beten,
zu opfern und zu ehren, errichtete
er Monolithen und Pyramiden, Dome und
Tempel. Wo komme ich her, wo gehe ich hin,
was ist der Sinn meines Lebens?
Antworten auf die ewigen
Fragen werden auch heute noch an
diesen Stätten gesucht, die das Siegel
der Einmaligkeit tragen.
„Der Mensch macht die Religion, nicht die Religion macht den Menschen.“
Karl Marx (1818–1883)
Religion und Kirche
Nun muss man allerdings etwas relativieren. Irgendwie sind es eben wohl doch nicht die Stifter selbst, die nach weltlicher Macht streben; ihnen geht es, so zumindest die Verkündung der biblischen Schriften, in erster Linie um das Seelenheil des einzelnen Menschen, besser des (künftigen) Gläubigen – manches Mal aber halt auch mit Druck! Die „Gefolgsleute“ der Stifter, haben dann allerdings bis in unsere Tage diese Verkündung und diese Hinweise auf ggfls. notwendigen Druck als Machtinstrument über den einzelnen Gläubigen eingesetzt. So wurde die Religion für die Kirche, oder wie es heute vielfach heißt, die „Amtskirche“, auch zum Machtinstrument über den einzelnen Menschen und damit über die Gesellschaft, in welcher dieser lebt, und darüber hinaus auch noch zum Machtinstrument über andere Staaten! Das „Gehet hin und lehret alle Völker“9, mit dem Jesus zur Mission aufruft, steht unter dem Gebot der Nächstenliebe und der Bergpredigt, anders im Islam, der davon ausgeht, dass alle Menschen als Muslime geboren werden; eine „Tatsache“, der allerdings notfalls auch mit Gewalt Geltung zu verschaffen ist. Die damit verbundene Vertreibung der Christen aus ihren „Stammlanden“ führte dann, wenn auch auf Umwegen und vergleichsweise spät, zu den Kreuzzügen, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind und zunehmend im religiösen Dialog, oder besser den gegenseitigen Schuldzuweisungen, zwischen den Religionen an Bedeutung gewinnen.
Krieg im Namen Gottes statt Nächstenliebe, Mitgefühl, Versöhnung. Seit es Religionen gibt, fühlen sich fanatische Anhänger zu den schlimmsten Verbrechen gegen „Ungläubige“ berechtigt, ja verpflichtet. Sind Glaube und Gewalt untrennbar verbunden? Entsteht diese Frage vor allem da, wo monotheistische Religionen aufeinandertreffen? Der Glaube an einen einzigen Gott könnte hier die Begründung liefern und das offenbar selbst dann, wenn der Gott der jeweiligen Religion irgendwie doch „derselbe“ ist. Was muss geschehen, damit die Friedensbotschaft der Religionen Gehör findet?“10 In diesem Beitrag zum Thema „Wie gefährlich sind Religionen – Glaube und Fanatismus“ wird u. a. die Analyse eines amerikanischen Psychologen und Philosophen zitiert, die dieser bereits 1901 in seinem Buch „Die Vielfalt religiöser Erfahrungen“ veröffentlicht hat. Mit dieser Analyse wird deutlich, wie großartig und erschreckend Religionen zugleich sein können. Er schreibt, dass Religionen, ähnlich wie Liebe und Ehrgeiz, bei ihren Anhängern „einen Zauber ins Leben (bringen), der nicht rational oder logisch ableitbar ist“. Damit gehe die Bereitschaft einher, „zu verstummen und zu einem Nichts zu werden in den Fluten und Orkanen Gottes.“.11
Derartige Haltungen und Ausprägungen wurden und werden natürlich begünstigt durch mangelndes Wissen des Einzelnen und natürlich damit auch der Menschheit in alter Zeit bis hin in die Gegenwart. Wissenschaftliche Erkenntnisse wurden ausgeblendet, oder schlicht mit dem Kirchenbann belegt, um es vereinfacht auszudrücken. Naturerscheinungen, Krankheiten usw. als Strafen Gottes auszulegen, war vergleichsweise einfach. Die Realitäten anzuerkennen, bzw. damit ein Stück weit Machtverlust über die Menschen hinzunehmen, fällt der „Amtskirche“ bis heute schwer, wobei hier, zumindest für die Gegenwart, hauptsächlich die katholische „Spielart“ des Christentums angesprochen ist; eine Feststellung, für die die Geschehnisse in Nordirland nicht unbedingt als Gegenbeweis gelten können. So versucht die katholische Kirche bis heute den Protestantismus „auszugrenzen“, in dem sie diesem abspricht, eine „Kirche“ zu sein, und auch die Ökumene „herunterzuspielen“, indem sie das gemeinsame Abendmahl verweigert. Geschiedene Katholiken werden (noch?) nicht zur Kommunion zugelassen, oder dürfen sich auch kein zweites Mal kirchlich trauen lassen. Warum eigentlich all das? Schauen wir uns im Kleinen Katechismus nur einmal das 5. und das 6. Gebot an. Im 5. Gebot heißt es „Du sollst nicht töten“ und im 6. Gebot „Du sollst nicht ehebrechen. Beides in einer „zivilisierten“ Gesellschaft eigentlich Selbstverständlichkeiten. Beim Thema „Ehebruch“ trifft den Verursacher die harte Kirchenstrafe mit voller Wucht, werden aber Mörder, zumindest sobald sie überführt sind, mit harten kirchenrechtlichen Maßnahmen bestraft? Alles irgendwie schwierig, eben menschengemacht, vielleicht sogar je nach Gusto! Derartige Gedanken kann man übrigens zu allen Geboten des Katechismus ableiten; natürlich dient deren Befolgung allemal einem friedlichen Zusammenleben in einer Gemeinschaft, ohne religiös überhöht werden zu müssen. Will man deren Einhaltung allerdings religiösen Nachdruck verleihen, so wird ein irgendwie geartetes Strafmaß relevant. Unabhängig von dessen Art stellt sich dann allerdings sofort die Frage nach dem gütigen, dem verzeihenden Gott – oder?
Der Verfasser kann sich sicher nicht als „bibelfest“ bezeichnen, d. h. er ist weder Theologe noch als solcher Dogmatiker, oder auch in der Exegese bewandert. Allerdings ist ihm als allgemein interessiertem Christen nicht bekannt, dass der Religionsstifter, also Jesus, dies alles irgendwann verlangt oder auch niedergeschrieben hätte; alles also von fehlbaren Menschen gemacht – gemacht in seinem Namen, um Einfluss zu gewinnen, bzw. um zu disziplinieren! Hätten die „Renaissance-Päpste“ nicht aus Wollust und Gier nach materiellen Gütern ihren eigenen Glauben „verraten“, wer weiß ob es die Reformation, zumindest die lutherische, gegeben hätte. Ob dies dann zum Wohle der Menschheit gewesen wäre, sei hier erst einmal dahingestellt – untersucht werden kann es an dieser Stelle ohnehin nicht!
Betrachtet man allerdings die religiöse Wirklichkeit der drei großen monotheistischen Glaubensrichtungen, so ist festzuhalten, dass es derzeit, also zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Hass und Extremismus vor allem im Judentum und im Islam gibt. Beider Gegensätze entzünden sich vor allem immer wieder in Israel und in Palästina, wobei es wieder um die Symbolkraft der „heiligen“ Stadt Jerusalem geht; das Christentum spielt in diesen Auseinandersetzungen, Gott sei Dank, nur eine untergeordnete Rolle – so hat es zumindest den Anschein! Immerhin handelt es sich um „biblisches“ Land!
Die Art und Weise, in der zur Zeit der Entstehung dieses Buches vor allem der Islam in Syrien und den dieses Land umgebenden Staaten praktiziert wird, wird vielfach „Steinzeitislam“ genannt. Die besonders extreme Rolle, die dabei der sog. „Islamische Staat“, eine Terrorgruppierung besonders widerwärtiger Art, spielt, muss hier außen vor bleiben. Das Töten im Namen Allahs wird jedoch von dort in alle Welt getragen und auch praktiziert. Es ist nur schwer vorstellbar, dass derartige Praktiken mit Gedanken des Religionsstifters in Einklang stehen könnten – oder? Aber bleiben wir ehrlich: Auch das Christentum hat mit seinen Kreuzzügen eine Art „Heiligen Krieg“ praktiziert; auch im Christentum galt die Frau bis in die Neuzeit hinein wenig bis gar nichts, und in der katholischen Kirche wird die Frau bis heute aus „geistlichen“ Ämtern ferngehalten – trotz Marienverehrung, die bis hin zum Kult praktiziert wird. Verlässt man bei dieser Bewertung der Rolle der Frau einmal den religiösen Bereich und „taucht“ in die praktische Einordnung der Frau in einem Staatswesen ein, so muss festgehalten werden, dass die ach so aufgeklärten „westlichen“ Gesellschaften Frauen teils bis weit in das 20. Jahrhundert hinein das Wahlrecht vorenthielten. Auch schrieb z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch der Bundesrepublik bis 1977 vor, dass der Ehemann es „erlauben“ musste, wenn seine Frau arbeiten wollte. Auch mussten es Ehemann oder Vater vor 1955 gestatten, wenn eine Frau den Führerschein machen wollte. Es gilt also eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, wenn wir „Christen“ aus heutiger Sicht Urteile über das Verhalten anderer Kulturkreise fällen. Und, nota bene, die gesetzlich im europäischen Kulturkreis inzwischen Gott sei Dank geregelte „Gleichheit“ von Mann und Frau ist noch lange nicht in allen relevanten Bereichen der europäischen Gegenwart angekommen. Darüber darf auch nicht die Tatsache hinwegtäuschen, dass Frauen inzwischen in höchste Ämter in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft aufgestiegen sind! Kann man also sagen, dass die auch noch in unseren Tagen gegebene Ungleichheit von Mann und Frau biblischen Ursprungs ist – Eva aus der Rippe Adams? Weit hergeholt? Vielleicht! Und doch: Religionen, geprägt vom Weltbild ihrer „Schöpfer“, haben durchaus nicht nur segensreich für die Menschen gewirkt.
Bei alledem, was hier kritisch angemerkt wurde, darf natürlich die Notwendigkeit eines gewissen Koordinatenkreuzes nicht übersehen werden, des Koordinatenkreuzes für „gut und böse, für richtig und falsch“, wie es Claus Jacobi in seinem Buch „Wo Gott wohnt“ (s. S. 20) nennt. So wird dem Menschen Halt gegeben, ein Halt, den er umso dankbarer annimmt, je begründeter ihm dieser erscheint und je charismatischer die Menschen (Anführer) sind, die ihn verkünden, besser noch vorleben.
„Alles kommt in der Religion aufs tun an!“
Immanuel Kant (1724-1804)
Religion bzw. Kirche als staats- und machtpolitischer Faktor
Es ist äußerst bemerkenswert, dass es die Botschaft Jesu’ trotz heftigster Verfolgungen und Folterungen geschafft hat, drei Jahrhunderte zu überleben und dann, nämlich 380 n. Chr., unter The-odosius I. (auch „der Große“ genannt) zur Staatsreligion im römischen Reich aufzusteigen. Es heißt, er habe damit die integrative Kraft dieses Glaubensbekenntnisses nutzen wollen, um die Einheit seines Reiches wiederherzustellen, was kurzfristig ja wohl auch gelang. Mancher Historiker sieht hierin die Grundlagen für die Entwicklung Roms zum „Imperium Romanum Christianum“. Wie stark dieser römische Kaiser, also Theodosius I., nicht nur die Politik jener Tage bestimmte, sondern eben auch in das stärker werdende und aufblühende Christentum hineinwirkte, ist daran zu erkennen, dass er offenbar einen nachhaltigen Einfluss auf die Formulierung des „Nizäischen Glaubensbekenntnisses“ ausgeübt hat. Dieses Glaubensbekenntnis gilt bis heute für die katholische wie auch die evangelische, und, mit Einschränkungen, sogar für die orthodoxen Kirchen. Gleichwohl konnte er die nach seinem Tod von den beiden Söhnen vollzogene Aufteilung in West- und Ostrom nicht verhindern.
Etwas ganz anderes ist allerdings von größter Bedeutung: Waren Gottheiten, basierend auf Naturereignissen oder sonstigen Phänomenen, eher von regionaler Bedeutung, so galt die neue Staatsreligion „Christentum“ allumfassend und wurde damit zu einem Machtfaktor! Diese Stellung hat das Christentum in seinen unterschiedlichen Ausprägungen nie wieder verloren, im Gegenteil: Sie war über die Jahrtausende hinweg immer wieder Quell und Ergebnis nachhaltiger Machtpolitik. So muss gesehen werden, dass auch den diversen Teilungen dieser Religion letztlich meist machtpolitische Überlegungen, bzw. kriegerische Auseinandersetzungen zu Grunde lagen – von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Die Religion, d. h. die sie repräsentierende „Amtskirche“ saß seit jenen Tagen, und das nicht nur bis zur Säkularisierung durch Napoleon, bei den großen Entscheidungen als eine Art „dritte Kraft“ oder auch „graue Eminenz“ immer mit am Tisch! Von einer Mitverantwortung der kulturellen Spaltung Europas ist sie sicher nicht ganz freizusprechen, wenn auch das Christentum mit seinen Grundgedanken das eigentliche gemeinsame Fundament Europas ausmacht.
Neben, oder gerade auch wegen wie auch immer gearteten Machtansprüchen der Kirchen bildeten sich auf unterschiedlichster Basis Klöster heraus, Einrichtungen, die bestimmten christlichen Idealen folgten. Es waren meist einige wenige, in der Regel männliche Gläubige, die, geführt von einer starken Persönlichkeit in die „Wüstenei“ zogen, um dort in der von ihnen bevorzugten Weise Gott zu dienen. Dieser „Gottesdienst“ wurde dann meist zu einem Dienst am Menschen, indem er Land urbar machte oder auch Wissen verbreitete. Diese Klöster haben, seien sie von Zisterziensern (z. B. Kloster Maulbronn), Benediktinern (z. B. Kloster Corvey bei Höxter), Augustinern, Dominikanern, Jesuiten, Kapuzinern, Trappisten usw. gegründet worden, Großes für die Bildung der Menschen, der anwendbaren Medizin usw. bewirkt. Hier wurden Bücher, meist Bibeln vervielfältigt, da die Mönche lesen und schreiben konnten. Aber auch Frauenklöster haben eine bemerkenswerte Rolle gespielt. Hier wären zu nennen: die Augustinerinnen und die Benediktinerinnen, aber auch die Karmeliterinnen und die Ursulinen. Auch sie haben alle in ihren jeweiligen Bereichen sehr segensreich für ihre Mitmenschen gewirkt. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass es natürlich auch hier Missbrauch gegeben hat. Das Buch „Der Name der Rose“ von Umberto Eco mit der Schilderung religiöser, politischer und menschlicher Konflikte im Mittelalter mag hier beispielhaft stehen.
Bei aller Kritik, die in der Tat an der Institution „Christliche Kirche“, sei sie katholisch oder protestantisch, geübt werden kann oder eben auch muss, einen irgendwie gearteten „Glauben“ scheint der Mensch zu brauchen. Allein die Suche nach Trost und der Beistand in existentiellen Krisen bis hin zum Tod, machen den Menschen empfänglich für, ich nenne es einmal „Überirdisches“. Es sei erlaubt, hier ein sehr persönliches Erleben beizuziehen: Als meine Mutter todkrank in einem zufällig katholischen Krankenhaus lag, fragte mich eines Tages die „Mutter Oberin“, eine sicher schon recht alte Dame in klösterlicher Tracht, ob ich denn schon mit meiner Mutter über das nahende Ende gesprochen hätte. Als ich verneinte und ihr sagte, dass ich das nicht könne, fragte sie mich, ob sie es denn für mich tun dürfe. Ich nickte, und sie ging in das Krankenzimmer. Nach ca. einer halben Stunde kam sie wieder heraus und bat mich nun doch zu meiner Mutter zu gehen. Die Veränderung, die in der Haltung meiner Mutter vorgegangen war, machte mich in gewisser Weise fassungslos; ohne auf das Gespräch einzugehen, sprach meine Mutter mit mir über alles Mögliche, was ich tun solle, wie ich mich gegenüber meiner Familie (Frau und zwei Kinder) verhalten solle usw. usw. – eine völlig veränderte fast „fröhliche“ Frau! Erwähnt sei hier noch, dass wir uns zwar zum Christentum bekennen, aber als Protestanten doch eher „zurückhaltend“ damit umgehen.
„Was bin ich? Was soll ich tun? Was kann ich glauben und hoffen? Hierauf reduziert sich alles in der Philosophie.“
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), deutscher Physiker und Schriftsteller;
und
„Dass es die Welt, dass es den Menschen, dass es die menschliche Person, dass es dich und mich gibt, hat göttlichen Sinn.“
Martin Buber (1878–1965), jüdischer Religionsforscher und Religionsphilosoph
Die großen monotheistischen Religionen
Hierzu zählen das Judentum, das Christentum und der Islam. Alle drei beziehen sich auf den im Judentum definierten Abraham als den Urvater der Menschheit. So nennt ihn das Judentum in der Thora, Teil des Tanach, der „Bibel“ der Juden, „Stammvater Israels“, während ihn die Muslime als Stammvater der Araber bezeichnen, von dessen Sohn Ismael der Prophet Mohammed abstammen soll. Im Christentum erfährt man im 1. Buch Mose (Genesis) von der Rolle Abrahams im Rahmen der göttlichen Verkündung. Jesus gilt dann den Juden nicht als der erwartete Messias, wird aber als (jüdischer) Prophet anerkannt. Auch im Islam spielt Jesus eine Rolle, wenn auch ganz gewiss nicht als Gottessohn. Man könnte sagen, dass der ja nun schon über Jahrtausende andauernde Streit zwischen diesen Religionen eine Art Familienstreit ist, und zwar um die richtige Auslegung des „väterlichen“ Testamentes. Lessing hat sich in seinem Drama „Nathan der Weise“ mit diesem Streit literarisch auseinandergesetzt. Die dort formulierte „Ringparabel“ ist eines der großartigsten und wohl auch ersten Zeugnisse des Toleranzgedankens in Bezug auf die drei großen monotheistischen Religionen. Allerdings war Lessing nicht der erste Dramatiker, der dieses Problem thematisierte – auch Boccaccio in seinem „Decamerone“ und einige andere taten dies; so auch inhaltlich vergleichbare Geschichten, auch Wandersagen genannt, die sich Juden wohl schon am 11. Jahrhundert in Spanien erzählten.
„Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, mich Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war.“
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)
Das Judentum als Basis großer Weltreligionen
Das Judentum gilt als die erste große monotheistische Weltreligion. Die Stadt Ur reicht, aktuellen Erkenntnissen zufolge, bis in das 5. Jahrtausend v. Chr. zurück. Von hier aus soll der Vater des Erzvaters Abraham in Richtung der heutigen Türkei gezogen sein. Eine konkrete zeitliche Einordnung hierfür – außerhalb der biblischen Berichte – ist offenbar nicht bekannt. Die moderne Geschichtsforschung geht allerdings davon aus, dass Abraham, wenn es ihn denn überhaupt gegeben hat, zu Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. gelebt hat. Allerdings beginnt die jüdische Zeitrechnung nach rabbinischer Tradition bereits im Jahr 3761 v. Chr. mit der Erschaffung der Welt. Im Herbst des Jahres 2014 christlicher Zeitrechnung hat danach das jüdische Jahr 5775 begonnen. Das Alte Testament, aus dem diese jüdische Zeitrechnung stammt, liefert mit den 10 Geboten, die von Gott am Sinai Moses direkt „übergeben“ worden sind, die Basis auch für das Christentum.
Nur insoweit hat das Judentum für das Europa unserer Tage, um das es hier geht, eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Diese Feststellung sagt nichts darüber aus, wie jüdische Mitbürger in verschiedenen europäischen Regionen bzw. Ländern prägend für die jeweilige Gesellschaft wirken konnten, bzw. darüber, wie versucht wurde, diesen in aller Regel überaus positiven Einfluss zu unterdrücken, ja, Juden sogar zu verfolgen und auch zu vertreiben – bis hin zur Shoa während des Dritten Reiches in Deutschland.
Bis zum „Erscheinen“ von Jesus Christus gilt den Juden unangefochten das, was Christen „Altes Testament“ nennen, als Basis ihres Glaubens. Die dort niedergelegte Erwartung des „Messias“ (Maschiach) ist im Gegensatz zum Christentum eben nicht mit dem Erscheinen Jesu Christi erfüllt, die Thora, also die fünf Bücher Mose, Teile des christlichen Alten Testamentes, gelten also maßgeblich fort. In unseren Tagen erhält das Judentum seine regional- und damit staatspolitische „Bedeutung“ vor allem in der kompromisslos ausgetragenen Gegensätzlichkeit mit dem Islam im Nahen Osten. Dabei ist zu sehen, dass auch das Judentum, wie das Christentum und der Islam, unterschiedliche, z. T. extreme Ausprägungen kennt. So wird in der Gegenwart der Gegensatz zwischen (ultra-)orthodoxen und liberalen Juden immer deutlicher; er spiegelt sich auch in der aktuellen Situation des Landes Israel wieder und beherrscht dort – mit weltweiten Auswirkungen – offenbar neben dem täglichen Leben auch die Tagespolitik der Parteien.
„Niemand glaubt etwas, ohne vorher nachzudenken, ob man es glauben muss.“
Augustinus, 354–430, bedeutendster, weil vielleicht allgemein bekanntester Kirchenvater
„Wer ist denn noch heutzutage ein Christ, wie Christus ihn haben wollte?“
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Gedichte: An Carl Friedrich Zelter, Weimar 1816