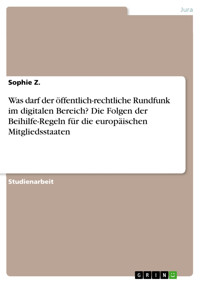
Was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Bereich? Die Folgen der Beihilfe-Regeln für die europäischen Mitgliedsstaaten E-Book
Sophie Z.
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Jura - Medienrecht, Multimediarecht, Urheberrecht, Note: 2,0, Freie Universität Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die enorme technische Dynamik der heutigen Zeit besitzt fast jeder Haushalt ein eigenes Fernsehgerät, dennoch wurde das mediale Angebot auch noch durch die stetige Annahme von internetfähigen Computern in den privaten Haushalten ergänzt. Trotz dieser Tatsache ist aber in den letzten Jahren die Fernsehdauer bis heute stabil geblieben. Es lässt sich also feststellen, dass es sich bei der Erweiterung durch das Medium Internet und seinen verschiedenen multimedialen Angeboten nur um eine Erweiterung des Rundfunkangebots handelt und es bisher zu keiner Verdrängung des Mediums Fernsehens gekommen ist. Aber dennoch werden bei speziellen Angeboten im Internet schon ähnliche Hörer- bzw. Zuschauerzahlen wie bei anderen Rundfunkangeboten erreicht. Aber das duale Rundfunksystem, welches in vielen Ländern Europas wie Deutschland und Österreich existiert, bietet zahlreiche mögliche Spannungspunkte. In Folge der Diversifizierung der Felder des Rundfunks zum Ausgleich des Wettbewerbsdrucks durch neue Marktteilnehmer kam es so zu einer enormen Anzahl an Beschwerden durch kommerziellen Marktteilnehmer, also auch den privaten Rundfunkveranstaltern, über die mögliche Wettbewerbsverzerrung durch die staatlichen Beihilfezahlungen. So wurde 2003 in Deutschland durch den Verband Privater Rundfunk-und Telemedien e.V. bei der Europäischen Union eine Beschwerde eingereicht, die die Verfälschung des Marktes durch die Beihilfezahlungen an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter beinhaltete. Auf Grund dieser Umstände musste sich die europäische Kommission fragen, was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den multimedialen Medien? Welche rechtlichen Vorschriften gibt es und mit welchen Mitteln und Verfahren werden diese umgesetzt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rechtslage auf europäischer Ebene
3. Public Value – Ein Definitionsversuch
3.1 Der Public-Value-Test der BBC
3.1.1 Beispiel zum Public Value-Tests
3.2 Der Drei-Stufen-Test in Deutschland
3.2.1 Das Beispiel der Tagesschau-App
3.3 Der Value-Test in Dänemark
3.4 Weitere europäische Länder mit dem Public Value-Ansatz
4. Fazit
5. Literatur
1. Einleitung
Durch die enorme technische Dynamik der heutigen Zeit besitzt fast jeder Haushalt ein eigenes Fernsehgerät, dennoch wurde das mediale Angebot auch noch durch die stetige Annahme von internetfähigen Computern in den privaten Haushalten ergänzt. Trotz dieser Tatsache ist aber in den letzten Jahren die Fernsehdauer bis heute stabil geblieben.[1] Es lässt sich also feststellen, dass es sich bei der Erweiterung durch das Medium Internet und seinen verschiedenen multimedialen Angeboten nur um eine Erweiterung des Rundfunkangebots handelt und es bisher zu keiner Verdrängung des Mediums Fernsehens gekommen ist. Aber dennoch werden bei speziellen Angeboten im Internet schon ähnliche Hörer- bzw. Zuschauerzahlen wie bei anderen Rundfunkangeboten erreicht.[2]
Aber das duale Rundfunksystem, welches in vielen Ländern Europas wie Deutschland und Österreich existiert, bietet zahlreiche mögliche Spannungspunkte. In Folge der Diversifizierung der Felder des Rundfunks zum Ausgleich des Wettbewerbsdrucks durch neue Marktteilnehmer kam es so zu einer enormen Anzahl an Beschwerden durch kommerziellen Marktteilnehmer, also auch den privaten Rundfunkveranstaltern, über die mögliche Wettbewerbsverzerrung durch die staatlichen Beihilfezahlungen. So wurde 2003 in Deutschland durch den Verband Privater Rundfunk- und Telemedien e.V. bei der Europäischen Union eine Beschwerde eingereicht, die die Verfälschung des Marktes durch die Beihilfezahlungen an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter beinhaltete.[3]
Auf Grund dieser Umstände musste sich die europäische Kommission fragen, was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den multimedialen Medien? Welche rechtlichen Vorschriften gibt es und mit welchen Mitteln und Verfahren werden diese umgesetzt?
2. Rechtslage auf europäischer Ebene
Die Grundvoraussetzungen für die Rechtsvorschriften im Internet für den öffentlichen Rundfunk gehen auf das Europarecht zurück. Als der EG-Vertrag beschlossen wurde, wurde dieser zunächst rein wirtschaftlich ausgerichtet. Die wichtigsten Kompetenzen für den gemeinsamen Binnenmarkt wurden durch die Mitgliedsstaaten auf die Europäische Union übertragen.
Auch die Medien werden hier als Ware betrachtet und unterliegen somit dem Beihilfeverbot des Gemeinschaftsrechts der EU. Aus diesem Grund muss jede finanzielle Zuwendung an einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter auch am Beihilfeverbot gemessen werden. Auch die Rundfunkfinanzierung in Deutschland muss einen konkreten Programmauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter gegenüber stehen. Dafür sind klare Anforderungen an den Rundfunkbetreiber formuliert worden. Dazu gehört, dass es sich bei der betreffenden Dienstleistung um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse handelt. Außerdem sollte das Unternehmen von dem jeweiligen Mitgliedsstaat ausdrücklich beauftragt werden und das Verbot der Beihilfe müsste das Unternehmen an der Umsetzung der angenommenen Aufgabe hindern. Weiterhin darf die Freistellung von dieser Regelung die Handelsentwicklung nicht beeinträchtigen.[4]





























