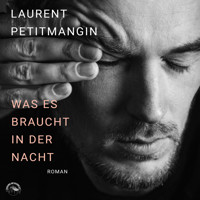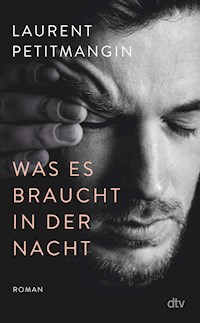
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mein Sohn, trotz allem Fus und Gillou, 10 und 7, sind sein ganzer Stolz. Doch als seine Frau stirbt, steht er mit seinen Jungs allein da. Die Arbeit als Monteur, Haushalt, Erziehung: Er gibt sein Bestes, bringt die Jungs zum Fußball, zeltet mit ihnen in den Ferien. Die ersten Jahre läuft alles glatt. Nur Fus wird in der Schule schlechter, sodass er danach nicht in Paris studieren kann. Der Vater tröstet sich damit, dass sein Ältester nicht wegzieht – bis er entdeckt, dass der 20-Jährige neuerdings mit einer rechtsextremen Clique rumhängt. Wie fühlt man sich, wenn der Sohn in falsche Kreise gerät? Was kann man tun? Er weiß sich nicht anders zu helfen, als mit erbittertem Schweigen seine Missbilligung kundzutun. Ein Drahtseilakt, der in einer Tragödie gipfelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Laurent Petitmangin
Was es braucht in der Nacht
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
1
Fus rennt los, setzt zum Tackling an. Das macht er gern, und er macht es gut: Er greift den Gegner an, bringt ihn aber nicht zu Fall, ist nur bissig genug, um ihm einen leichten Tritt zu verpassen. Manchmal muckt der Kerl auf, aber Fus ist groß, und wenn er spielt, wirkt er bedrohlich. Er nennt sich Fus, seit er drei ist. Fus für Fußball. Auf Luxemburgisch. Niemand nennt ihn mehr anders. Er ist Fus für seine Lehrer, seine Freunde und für mich, seinen Vater. Ich sehe ihn jeden Sonntag spielen. Selbst bei Regen oder Schnee. Auf den Handlauf gestützt, mit Abstand zu den anderen.
Der Platz liegt weit außerhalb, eingerahmt von Pappeln, unterhalb davon der Parkplatz. Letztes Jahr wurde der Schuppen für die Ausrüstung neu gestrichen; er dient auch für die Apéros nach dem Spiel. Der Rasen ist neuerdings prächtig, ohne dass man wüsste, warum. Und die Luft immer frisch, auch im Hochsommer. Kein Lärm, nur die Autobahn in der Ferne, ein leises Rauschen, das uns mit der Welt verbindet. Ein schöner Platz. Fast als spielten hier die Reichen. Man muss fünfzehn Kilometer weit fahren, bis nach Luxemburg, um einen gepflegteren zu finden.
Ich stehe immer an derselben Stelle. Abseits der Bänke, fern von der kleinen Gruppe der treuen Fans. Auch weit weg von den Anhängern der Gastmannschaft. Mit direktem Blick auf die einzige Werbung am Spielfeldrand, Werbung für die Dönerbude, die alles macht, Pizza, Tacos, Burger, Steaks oder Lothringer Bratwurst mit Fritten oder einen »Stein«, die Sandwich-Spezialität unserer Region, alles immer serviert im halben Baguette. Manche kommen vor dem Spiel herüber, um mir die Hand zu schütteln, so wie Mohammed: »Heute machen wir sie nass, inschallah! Ist Fus in Form?«, und gehen dann wieder zu ihrem Platz zurück. Ich rege mich nie auf, brülle nie herum wie die anderen, ich warte ruhig darauf, dass das Spiel zu Ende geht.
Mein Sonntagmorgen sieht so aus: Um sieben Uhr stehe ich auf, mache Kaffee für Fus, dann wecke ich ihn. Er ist sofort munter, ohne je zu murren, auch wenn es in der Nacht zuvor spät geworden ist. Ich würde ihn nur ungern drängen oder wachrütteln wollen. Ist bisher auch noch nie vorgekommen. Ich rufe durch die Tür: »Steh auf, Fus, es ist Zeit«, und ein paar Minuten später steht er in der Küche. Wir reden nicht, und wenn doch, geht es um das Spiel von Metz am Vortag. Wir leben im Département 54, Meurthe-et-Moselle, aber in unserer Region sind wir keine Anhänger der AS Nancy, sondern des FC Metz. So ist das nun mal hier. Wenn wir in Metz in der Nähe des Stadions parken, passen wir auf unser Auto auf. Es gibt überall Arschlöcher, Deppen, die sich aufregen, sobald sie ein 54er-Nummernschild sehen, und dann dein Auto zerkratzen. Wenn am Vortag ein Spiel stattfand, lese ich Fus den Sportbericht vor. Wir haben beide unsere Lieblingsspieler, die nicht verkauft werden sollten. Und die letztlich doch immer weggehen. Der FC kann sie nicht halten. Sobald sie sich hervortun, schnappt man sie uns weg. Erhalten bleiben uns immer nur die Minderbegabten, diejenigen, von denen wir bei jedem Spiel zwanzigmal denken, sie sollten besser Leine ziehen, weil ihr Gekicke einfach erbärmlich ist. Trotzdem, solange sie ihre Trikots nass machen, können sie bleiben, auch wenn sie Klumpfüße haben. Wir wissen, wo wir stehen, und sind damit zufrieden.
Wenn ich Fus sonntags spielen sehe, denke ich oft, dass es kein anderes Leben gibt, kein anderes, das über diesem steht. Dieser Moment, wenn die Zuschauer zu schreien beginnen, das Geräusch der Stollen, die sich in den Rasen drücken und wieder von ihm lösen, das Schimpfen der Mitspieler, wenn einer nicht früh genug losspurtet, nicht in die Tiefe spielt, diese aus vollem Hals hinausgebrüllten Gefühle, wenn sie ein Tor schießen oder eines kassieren … Dieser Moment, in dem es für mich nichts zu tun gibt, ist einer der wenigen Augenblicke, in denen ich mich mit Fus noch verbunden fühle, ein Moment, den ich um nichts in der Welt hergeben würde, dem ich die ganze Woche über entgegenfiebere. Ein Moment, der mir nichts bringt, außer der Freude, ihn spielen zu sehen, sonst allerdings nichts löst. Rein gar nichts.
Nach dem Spiel geht Fus nicht gleich nach Hause. Ich warte nicht auf ihn. Manchmal sind sein Bruder und ich schon fast fertig mit dem Essen, wenn er kommt.
»Kannst du meine Trikots waschen, Dicker?«
»Geht’s noch?! Warum sollte ich?«
»Weil du mein kleiner Bruder bist. Keine Sorge, ich revanchiere mich.«
Und dann schnappt er sich seinen Teller, lädt ihn voll und setzt sich damit vor das Nachmittagsprogramm.
Wenn ich mich aufraffen kann, gehe ich danach, gegen fünf, zur Partei. Seit man dort keinen Apéro mehr bekommt, werden wir von Mal zu Mal weniger. Die Treffen waren belanglos geworden; die Jüngeren von uns hatten keine Arbeit mehr und warteten nur noch darauf, dass man die Flaschen hervorholte. Jetzt sind wir meist vier oder fünf, selten mehr. Und auch nicht immer dieselben. Es ist nicht mehr nötig, die Klapptische aufzustellen wie noch vor zwanzig Jahren. Die meisten müssen montags nicht arbeiten, sind Rentner. Unter ihnen Lucienne, die wie zu Zeiten ihres Mannes mit einem Kuchen kommt, den sie netterweise selbst anschneidet. Niemand spricht, bevor sie nicht acht schöne, gleichmäßige Stücke geschnitten hat. Auch ein oder zwei Jüngere sind manchmal dabei, arbeitslos seit Ewigkeiten. Die Themen sind immer dieselben. Die Schule vor Ort, die es nicht mehr lange geben wird, da sie alle drei Jahre eine Klasse verliert, die Geschäfte, die eines nach dem anderen schließen, die Wahlen. Wir haben seit Jahren keine mehr gewonnen. Keiner von uns hat für Macron gestimmt. Auch nicht für die andere. Am Wahlsonntag sind wir alle zu Hause geblieben. Ein wenig erleichtert waren wir schon, dass sie nicht gewählt wurde. Und dennoch frage ich mich, ob es einigen von uns nicht insgeheim lieber gewesen wäre, wenn es einen großen Knall gegeben hätte.
Wir verteilen noch immer Flugblätter, das muss einfach sein. Ich glaube zwar nicht, dass es viel nützt, aber wir haben einen jungen Mann, der zu formulieren versteht. Der mit treffenden Worten sagen kann, in welcher Scheiße wir stecken, mit dem Bergbau, der Stahlproduktion und unserem Leben. Er heißt Jérémy. Seine Eltern sind vor fünfzehn Jahren hierhergezogen, als die Fabrik für Motorengehäuse eine neue Fertigungsstraße einrichtete. Vierzig Neueinstellungen auf einmal, völlig unverhofft. Die Fertigungsstraße musste gleich mehrmals eingeweiht werden, damit es auch jeder glaubte. Die ganze Region kam schwanzwedelnd zu uns, der Präfekt, der Abgeordnete, alle Schulklassen. Bis hin zum Pfarrer, der gleich ein paarmal vorbeischaute, um sie unauffällig zu segnen. Die Reporterin vom ›Républicain Lorrain‹ machte sich immer wieder auf den Weg, um von all den Leuten vor dieser Fertigungsstraße zu berichten, als wäre sie ein Symbol für »Lothringen ist und bleibt ein Industriestandort«. Eine hübsche Blondine, die ihre Arbeit gut gemacht hat, mit Worten der Hoffnung, die viel Anklang fanden. Sie schoss auch die Fotos und variierte dabei die Blickwinkel, damit der Lokalteil für Villerupt und Audun-le-Tiche nicht jeden Tag gleich aussah. Es hat allerdings lange gedauert, bis die Fertigungsstraße dann in Betrieb genommen wurde. Vielleicht zu lange. Als man endlich alle Vorarbeiter und Arbeiter fürs Band eingestellt hatte, endlich einen Weg gefunden hatte, mit dem verdammten Lösungsmittel vernünftig umzugehen – ein paar Zentiliter waren pro Tag entwichen und hatten die Inbetriebnahme blockiert –, spielten die Banken nicht mehr mit, fiel alles in sich zusammen, und wir waren wieder einmal in der Krise, einer Krise, die der Fertigungsstraße mit ihren Rückständen kurzerhand den Garaus machte. Die Anlage hätte radioaktives Material ausspucken können, und es ist sicher nicht gelogen, wenn ich sage, dass das hier völlig egal gewesen wäre, dass wir lieber Abwasser getrunken hätten, als den Start der Fertigungsstraße noch länger hinauszuschieben. Es gab dazu auch keine Debatte in der Partei, zu der Zeit waren wir noch nicht ökomäßig drauf; wir sind es bis heute nicht.
Jérémy gehörte zum Frühlingsjahrgang, wie er damals genannt wurde. Etwa zwanzig Kinder, die im März und April mit ihren frisch eingestellten Eltern hergezogen waren, sodass es im folgenden Schuljahr eine Grundschul- und eine Mittelschulklasse zusätzlich gab.
Mittlerweile ist Jérémy dreiundzwanzig Jahre alt. Er ist ein Jahr jünger als Fus. Anfangs waren die beiden dicke Freunde. Fus mochte ihn. Er hat ihn ein paarmal mit nach Hause gebracht. Was er mit anderen Kindern nur selten gemacht hat. Ich glaube, er hat sich ein wenig geschämt. Für seine Mutter, die damals kaum noch das Bett verlassen konnte. Vielleicht auch für mich. Wenn Jérémy kam, war es ein schöner Tag für meine Frau. Hatte sie genug Kraft, stand sie auf und machte Waffeln oder Krapfen. Sie meckerte Fus ein wenig an, er hätte ihr früher Bescheid sagen sollen, dann hätte sie den Teig am Vortag gemacht und er wäre viel besser geworden, aber schließlich buk sie die Krapfen, knusprig und mit Zuckerglasur. Es gab einige zum Abendessen und eine Schüssel voll für den nächsten Tag.
Bis zu Fus’ zwölftem Lebensjahr waren er und Jérémy viel zusammen. Im Collège begann Fus dann weniger zu lernen. Hörte auf zu büffeln. Schwänzte ab und zu die Schule. Er fand immer eine Ausrede. Das Krankenhaus. Seine Mutter. Die Krankheit seiner Mutter. Die wenigen besseren Phasen, die es zu nutzen galt. Die letzten Tage seiner Mutter. Die Trauer um sie. Drei Jahre Scheiße, seine sechste, siebte und achte Klasse, in denen ich hilflos und vollkommen überfordert war. Ich schaffte es nicht mehr, daran zu glauben, verlor jede Hoffnung auf eine Genesung, die auch nicht mehr kam. Konnte nicht einmal mit dem Rauchen aufhören. Mich nicht mehr neben ihn setzen, wenn er weinend auf seinem Bett hockte, ihn nicht mehr belügen, sagen, dass es der Mutti bestimmt bald besser gehen und sie wieder heimkommen würde. Ich war gerade noch in der Lage, ihm und seinem Bruder Essen zu machen. Und mir vorzuwerfen, dass wir die Kinder viel zu spät bekommen hatten. Wir waren beide schon vierunddreißig, als unser Gillou geboren wurde.
In der achten Klasse kam Fus nicht mehr mit. Er verprellte die letzten seiner Freunde aus der guten Zeit, seiner Grundschulzeit, als die Lehrer ihn noch mochten. Die Lehrer auf dem Collège hatten weniger Nachsicht mit ihm. Sie haben einfach so getan, als ob nichts wäre: als ob der Junge die Sonntage nicht im Krankenhaus Bon-Secours verbringen würde. Zuerst nahm er seine Hausaufgaben noch mit ins Krankenhaus, dann machte er es wie ich, er saß einfach da, starrte auf das Bett, auf seine Mutter darin. Vor allem aber auf das Bett, die Decken und das Bettzeug, dessen Gewebe sich vom vielen Kochen und Bleichen verzogen hatte. Stundenlang saßen wir so da. Es war schwer, die Mutti anzuschauen, sie war hässlich geworden. Und vierundvierzig Jahre alt. Man hätte ihr gut zwanzig oder dreißig mehr gegeben. Manchmal schminkten die Krankenschwestern sie ein wenig, aber das Ockergelb war nicht zu kaschieren, das sich Woche für Woche mehr auf ihrem müden Gesicht ausbreitete, und auch auf ihren Armen, die reglos auf dem Betttuch lagen, als es mit ihr zu Ende ging. Wie ich muss auch er sich manchmal gewünscht haben, einmal nicht ins Krankenhaus fahren zu müssen, einen normalen Sonntag zu verbringen oder, im Gegenteil, mal etwas Außergewöhnliches zu erleben, das uns daran gehindert hätte, aber das kam nie vor, wir hatten nie etwas Besseres, Dringenderes zu tun, also haben wir die Mutti im Krankenhaus besucht. Nur unseren Gillou konnten wir manchmal den Nachmittag über bei den Nachbarn lassen. Schlag acht Uhr, nach dem Abendessen, gingen wir wieder heim, erleichtert, dass wir bei ihr gewesen waren. Im Sommer waren wir bisweilen schon froh, dass wir das Fenster öffnen und eine dieser Stunden nutzen konnten, in denen sie ganz bei Bewusstsein war, um mit ihr den Geräuschen im Hof zu lauschen. Wir belogen sie, sagten ihr, sie sehe besser aus und der Oberarzt habe sich zufrieden gezeigt, als wir ihm auf dem Flur begegnet waren.
Ich hätte Fus gegenüber trotzdem mehr Druck ausüben sollen. Stattdessen sah ich tatenlos zu, wie es allmählich mit ihm abwärtsging. Seine Schulhefte waren schlampig geführt, aber welche Bedeutung hatte das schon? Meine wenige Energie brauchte ich für meine Arbeit bei der Bahn, um vor den Kollegen und dem Chef zu bestehen und meinen verdammten Monteursjob zu behalten. Erschöpft wie ich war, ab und an auch ein wenig angetrunken, musste ich aufpassen, dass ich keine Dummheiten machte. Keinen Kurzschluss verursachte. Nicht runterfiel. Ist weit oben, so eine Fahrleitung. Ich musste aufpassen, dass ich heil nach Hause kam. Denn ich musste für meine beiden Jungs sorgen, durchhalten, ohne zu trinken, bis sie im Bett waren. Erst dann konnte ich mich gehen lassen. Nicht immer. Aber ziemlich oft.
So sind diese drei Jahre vergangen. Das Krankenhaus, das Eisenbahn-Depot in Longwy, manchmal das in Montigny, die Strecke Aubange – Mont-Saint-Martin, der Rangierbahnhof in Woippy, unser Häuschen, die Partei und wieder das Krankenhaus. Hin und wieder wurde ich auch weiter weg eingesetzt, musste in Sarreguemines oder Forbach übernachten, wofür ich mich mit den Nachbarn abstimmte, damit sie ein Auge auf Gillou und Fus hatten. Fus musste dann kochen, Fertiggerichte aus der Dose zum Aufwärmen: »Pass gut auf, vergiss nicht, das Gas abzustellen, damit uns nicht das Haus abbrennt. Bleibt nicht zu lange auf. Und wenn du was brauchst, geh rüber zu Jacky, er und seine Frau wissen, dass ihr heute Nacht allein seid.«
Mit seinen dreizehn Jahren war Fus damals schon ganz schön erwachsen. Übernahm Verantwortung. Ein guter Junge, alles war immer blitzblank, wenn ich am nächsten Abend nach Hause kam. Nicht ein einziges Mal musste er Jacky zu Hilfe rufen. Selbst nicht, als der Hagel mit faustgroßen Hagelkörnern das große Küchenfenster zerschlug. Oder Gillou nicht schlafen konnte, weil er Angst hatte und nach seiner Mutter verlangte. Fus war immer gut zurechtgekommen. Er tat, was getan werden musste. Er redete Gillou gut zu, weckte ihn am nächsten Morgen, machte ihm Frühstück. Und fand sogar noch Zeit, um für ihn aufzuräumen. Unter anderen Umständen hätte ich Fus für einen wahren Musterknaben gehalten, ihn zwanzigfach, hundertfach, tausendfach belohnt. Damals, bei allem, was passierte, kam es mir nie in den Sinn, mich bei ihm zu bedanken. Alles, was ich sagte, war ein: »Hat alles geklappt? Ist nichts schiefgegangen? Sonntag gehen wir wieder ins Krankenhaus.«
Die Mutti hatte immer gewusst, wie man sich gut um Fus und Gillou kümmerte. Sie ging zu allen Elternabenden in der Schule, bestand darauf, dass ich mir freinahm und mitkam. Wir waren immer die Ersten, setzten uns in die erste Reihe, hinter die kleinen Kinderpulte. Lauschten aufmerksam den Ratschlägen der Lehrerin. Die Mutti machte sich Notizen und las sie den Kindern am nächsten Abend vor. Sie hatte Fus zu Latein angemeldet, denn nur die Besten lernten das, mit Latein konnte man die Grammatik besser verstehen, Latein war logisch aufgebaut wie Mathematik. Latein und Deutsch sollte er lernen. Für Englisch hätten die Kinder ab der achten Klasse noch Zeit genug. Sie hatte ehrgeizige Pläne für die beiden. »Ihr werdet mal Eisenbahn-Ingenieure. Das ist ein guter Job. Arzt natürlich auch, aber mehr noch Ingenieur bei der SNCF.«
Als man die Krankheit bei ihr entdeckte, sprach sie anfangs mehrfach mit mir über die Zukunft der Kinder. Ich habe nicht an diesen Krebs geglaubt, und ich denke, sie auch nicht. Ich ließ sie reden, achtete nicht besonders darauf, was sie sagte; dann baute sie ziemlich schnell ab, ergab sich ihrem Leiden und kam nicht mehr darauf zurück. In den letzten Wochen, als sie wusste, dass es zu Ende ging, blickte sie nicht mehr zurück. Und enthielt sich zudem jeden Ratschlags. In der wenigen Zeit, in der sie noch bei Bewusstsein war, begnügte sie sich damit, uns zu betrachten. Uns einfach anzusehen, ohne ein Lächeln. Ich hatte ihr nichts versprechen müssen. Sie ließ uns in Ruhe. Drei Jahre lang hatte sie gegen den Krebs gekämpft. Ohne je zu verkünden, dass sie ihn besiegen würde. Die Mutti hat nicht die Heldin gespielt. Einmal habe ich zu ihr gesagt: »Du wirst es schaffen, für die Kinder.« »Ich schaffe es schon für mich allein«, war ihre Antwort gewesen.
Ich glaube, sie war den Ärzten auf die Nerven gegangen. Weil sie ihnen nicht motiviert genug war, jedenfalls redete sie in deren Augen zu wenig. Sie erwarteten, dass sie gegen den Krebs rebellierte, dass sie wie andere Krebspatienten laut erklärte, sie werde ihm den Garaus machen, ihn im Keim ersticken. Von ihr war jedoch nichts dergleichen zu hören gewesen. Kein Wort, wie man es vom Film her kannte, nichts für die ihr Nahestehenden. Auch keine letzten Ratschläge. Das alles war zu viel für sie. Es war nicht das wahre Leben, ihr Leben war jedenfalls nicht so.
Deshalb fand bei ihrer Beerdigung wohl auch niemand lobende Worte für ihren Mut. Dabei hatte sie drei Jahre Krankenhaus, drei Jahre Chemo, drei Jahre Bestrahlungen durchgestanden. Man redete mit mir über mich, über die Kinder, was wir jetzt tun würden, aber so gut wie nicht über sie. Als verübelte man ihr ihre Resignation, dass sie so ein jämmerliches Bild abgegeben hatte. Der Oberarzt zuckte nur mit den Schultern, als ich ihn fragte, wie ihre letzten Stunden verlaufen seien.
»Nicht anders als die Tage zuvor. Wissen Sie, Ihre Frau hat sich nie wirklich gegen ihre Krankheit gewehrt. Das ist nicht jedem gegeben … Ob das einen Unterschied gemacht hätte? Das kann niemand wissen.«