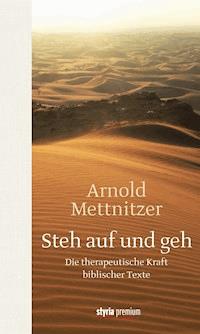Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wovon ein Mensch überzeugt ist, erscheint manchmal so felsenfest und unumstößlich wie ein Gebirgsmassiv. Dann aber bringt der unvermutete Lauf des Lebens diese innere Ordnung ungefragt durcheinander. Die Welt gerät ins Wanken, der Boden unter den Füßen trägt nicht mehr. Was gibt dann Halt? Was lässt noch hoffen? Der Theologe und Psychotherapeut Arnold Mettnitzer versucht aus der Fülle seiner Erfahrungen persönliche Überzeugungen herauszufiltern und diese auf ihre Alltagstauglichkeit hin zu überprüfen. Er warnt vor jeder Art gedanklicher Geiselhaft ewig gültiger Wahrheiten. Was ihn trägt, auf was er baut, was ihn hoffen lässt, findet er nicht in Lehrbüchern, sondern in der Schatzkammer persönlicher Erfahrungen. Dort wird ihm bewusst, wie sehr er Tag für Tag darauf angewiesen bleibt, anderen zu vertrauen, und wie wenig es oft braucht, dass dieses Vertrauen erschüttert wird. Was aber hält, trägt, ermutigt dann? Was bewahrt vor der Resignation? Fragen, die Mut machen, im Innersten danach zu suchen, was das Leben eines Menschen reich, einzigartig und unverwechselbar macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnold Mettnitzer
Was ich glaube
Überlegungen & Überzeugungen
Mit Bildern von Gottfried Mairwöger
A
Anfang
nur leben entwirft vom leben lebendige bilder
Kurt Marti
Wer im Inhaltsverzeichnis zu diesem Buch eine Orientierungshilfe, vielleicht sogar einen „roten Faden“ sucht, mag sich darüber wundern, dass er dort nichts dergleichen finden kann. Lediglich eine fein säuberlich alphabetisch gereihte Auflistung von Überschriften findet man hinten im Buch vor, die sich dem freien Spiel von Zufälligkeiten verdankt.
Das hat mit jener eigenartigen Beliebigkeit zu tun, mit der auch therapeutische Gespräche beginnen. Dabei werden die Gesprächspartner dazu eingeladen, frei assoziativ über all das zu erzählen, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Das geschieht im Vertrauen darauf, dass das gemeinsame Gespräch mit etwas Glück dorthin führt, wo im weiten Land der Seele die Wegkreuzungen für wichtige Lebensentscheidungen liegen. Diese therapeutische Methode ist nicht neu und wurde auch nicht, wie viele meinen, von Sigmund Freud erfunden. Um die Antwort auf wichtige Fragen des eigenen Lebens zu finden, ist es eine uralte religiöse Praxis, die Bibel an einer beliebigen Stelle aufzuschlagen und so lange zu lesen, bis darin Ermutigung, Zuversicht und Trost gefunden werden können.
Mit dieser Art „Shuffle-Funktion“, mit der auch auf Tonanlagen das Abspielen von Musikstücken dem Zufall überlassen wird, wollte ich auch hier versuchen, der Leserin und dem Leser den Inhalt dieses Buches anzubieten. Es besteht aus einer bunten Mischung von gefundenen literarischen Kostbarkeiten und daraus entstandenen persönlichen Gedanken und Überlegungen, deren Überzeugungsgrad keinen Absolutheitsanspruch erhebt. Denn immer wieder, wenn ich mich hinsetze, um aufzuschreiben, was mir seit ein paar Stunden oder Tagen so klar und gewichtig erscheint, will das Schreiben nicht gelingen und die vermeintlich so wichtigen Gedanken zerrinnen wie der Sand zwischen meinen Fingern … Warum, so tröste ich mich dann, sollte nicht gerade das Schreiben Teil des Lebens sein, von dem John Lennon meinte, es passiere, während wir andere Pläne schmieden?
„Warum haben Sie kein Buch mehr geschrieben?“, fragt „Schwester Maria“ den Schriftsteller im Schlussteil des Films „La Grande Bellezza“ von Paolo Sorrentino (2013). Er gibt ihr zur Antwort: „Ich suchte nach der großen Schönheit. Aber ich hab sie nie gefunden.“ Darauf fragt sie ihn: „Wissen Sie, wieso ich immer nur rot sehe?“ – „Nein. Nein, wieso?“, fragt er zurück. „Weil Wurzeln sehr wichtig sind!“, gibt sie ihm zur Antwort. Während der beklemmenden Stille, die dieses Gespräch erzeugt, haucht „Schwester Maria“ die Vögel an, die daraufhin auf und davon fliegen, so, als wollte sie damit sagen: „Wurzeln sind wichtig, aber was tu ich mit ihnen, wenn mir daraus keine Flügel wachsen?“ Es sind die Worte, die wir zueinander sprechen und miteinander tauschen, die uns Mut machen und unseren Gedanken Flügel verleihen …
Am Schluss dieses vielfach preisgekrönten Films weiß ich, wie ich mein Buch beginne: mit diesem inneren Grund fürs Schreiben. Mit dem Mut, Gedanken wie Vögel anzuhauchen in der Hoffnung, dass der eine oder andere sich aufmacht, davonfliegt, irgendwo landet und etwas bewegt. Schreiben kann nur in der Hoffnung gelingen, dass unter den vielen Gedanken, die wir täglich zu Gehör und erst recht zu Papier bringen, einer, wenn auch nur ein kleiner, wäre, der in uns selbst und damit vielleicht auch in anderen Menschen etwas in Bewegung zu bringen vermag. Dann soll die Mühe des Schriftstellers beim Gedankenfischen im Wörter-See des Alltags nicht vergebens gewesen sein. Wer nämlich schreibt, sei es einen Brief, ein Buch, ein Tagebuch oder auch „nur“ einen Brief, den er nie abschickt, macht damit zuallererst einen Weg in sein Inneres frei, dorthin, wo der Brei der alten, hin und her gewälzten Fragen liegt, deren beste Antwort auf diese Fragen präziser gestellte Fragen sind. Wer so durch sein Schreiben eine Spur in sein Inneres legt, mag dadurch vielleicht Gedanken entdecken, die auch den Weg zu seinen Leserinnen und Lesern finden. So betrachtet sollte der Titel dieses Buches nicht als Glaubensbekenntnis gelesen werden, sondern als eine persönliche Momentaufnahme ohne Absolutheitsanspruch.
Seit über zwölf Jahren wird mir immer wieder die Gelegenheit gegeben, im Österreichischen Rundfunk und Fernsehen Fünf-Minuten-Gedanken zu äußern, Überlegungen anzustellen und Überzeugungen zu präsentieren. Eine dieser Sendungen trägt den Titel dieses Buches: „Was ich glaube.“ Die Wahrheit, um die es mir dabei geht, ist kein erratischer Block ewiger Gültigkeit, vielmehr eine bunte Mischung bescheidener Gedanken, die zu artikulieren mir Freude bereitet und anderen vielleicht Mut macht, sich auch mit ihren kleinen und großen Gedanken herauszuwagen auf den Marktplatz des Meinungsaustausches, wo alte zu neuen Überzeugungen gelangen, diese wieder verworfen oder korrigiert, im besten Fall präzisiert werden. Je öfter ich das tue, desto deutlicher erkenne ich, dass ich damit ein Leben lang nicht ans Ende kommen kann. All das mag nicht mehr bedeuten, als uns gegenseitig einen Gedankenflohmarkt zu bereiten, der einen weiten, vielleicht sogar unterhaltsamen Bogen vom Ramsch bis hin zur raren Kostbarkeit einer plötzlich in der Leserin oder im Leser auftauchenden Überlegung zieht. Was ich glaube, was mir im Moment wichtig ist, mich trägt und innerlich stark macht, ist selten gesicherter Besitz. Meine kleinen und großen Überzeugungen sind täglicher Hinterfragung ausgeliefert, lassen mich immer wieder auch unsicher sein, ruhelos, skeptisch mir selbst und anderen gegenüber. Und wenn ich dann, wie jetzt, dasitze und über das, was ich glaube, schreiben möchte, fällt mir – wie dem Schriftsteller in Sorrentinos Film – zunächst nichts ein, was aufzuschreiben mir wertvoll erschiene. Wenn ich es trotzdem versuche, dann deswegen, weil das Schreiben eine Art Zwiesprache mit mir selbst bedeutet und eine Nachdenklichkeit auszulösen vermag, die mir über weite Strecken nutz- und zwecklos, aber tröstlich und sinnvoll erscheint. In solcher Paradoxie ist dieses Buch entstanden. Eine Zumutung, mögen einige sagen, vielleicht sogar im mehrfachen Sinn des Wortes. Mir jedenfalls bedeutet es den Versuch einer immer wieder fälligen Ordnung im Zettelkasten meiner persönlichen Notizen. Die lohnt sich genauso wie das gelegentliche Entrümpeln des Weinkellers. Auch dabei lassen sich im Laufe der Zeit vergessene und inzwischen hervorragend gereifte Kostbarkeiten entdecken.
Außerdem merke ich dabei immer wieder, wie einladend Kommunikation sein kann. Gefundenes, Wiederentdecktes mit anderen zu teilen und es gemeinsam zu genießen oder sich darüber den Kopf zu zerbrechen ist ansteckend. Darüber hinaus merkt derjenige, der sich hinsetzt und seine Gedanken zu Wort bringt sehr bald, wie viel er von dem, was er als sein Eigentum wähnt, anderen verdankt. Das Schreiben ist so gesehen auch und zuallererst ein ganz besonderer psychohygienischer Liebesdienst sich selbst gegenüber, gleichzeitig nimmt er dadurch Kontakt auf mit der ganzen Welt. Aber er tut es nicht in erster Linie, um von anderen gelesen zu werden, vielmehr in der Hoffnung, durch sein Schreiben für ein kleines Stück mehr innerer Klarheit sorgen zu können. Darüber hinaus will wohl jeder Mensch mit dem, was er tut, einen Beitrag leisten für die Schönheit in dieser Welt, in der er dazugehören und zeigen will, was ihn beschäftigt und bewegt. Wenn es ihm dabei gelingt, etwas von dem, was ihm wichtig ist und am Herzen liegt, aufzuzeigen, wenigstens anzudeuten, vielleicht sogar so ins Wort zu bringen, dass er während des Schreibens seine wahre Freude daran hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ihm am nächsten Tag das alles nicht doch wieder nichtssagend vorkommt, der Mühe und Anstrengung nicht wert. Es gibt ja doch, wie der biblische Autor Kohelet anmerkt, nichts Neues unter der Sonne. Alles schon da gewesen. Aufgewühlt. Aufgeblüht. Verwelkt und hinweggefegt. Windhauch. „Alles nur Windhauch!“ (Koh 1,2)
Sorrentinos Film endet mit den Worten: „So hört es immer auf. Mit dem Tod. Davor aber war das Leben, begraben unter all dem Bla, bla, bla, bla, bla. Alles wird überlagert von Geschwätz und Lärm: Stille und Empfindsamkeit, Gefühl und Angst, die spärlichen unsteten Augenblicke von Schönheit. Und dann das trostlose Elend und der erbärmliche Mensch. Alles zugedeckt vom Mantel der Verlegenheit, auf der Welt zu sein. Bla, bla, bla, bla. Anderswo. Gibt es das Anderswo? Ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Anderswo. Also: Möge der Roman beginnen! Im Grunde ist es nichts als ein Trick. Ja! Es ist nur ein Trick!“
Der Trick in diesem cineastischen Meisterwerk besteht darin, dass ein Mensch, der das tägliche Geschwätz als vergeudete Zeit entlarvt und geschriebene Zeilen als eitles Machwerk brandmarkt, trotzdem beginnt, dagegen anzuschreiben, in der Hoffnung, dass von dem, was er da schreibt, ein Funke bleibt, der das Geschwätz überdauert. Er will nicht für die Ewigkeit schreiben, er will auf der Suche bleiben nach einem Wort, das in einem anderen Menschen mehr auszulösen vermag als die Ödnis des Bla, bla, bla.
Während ich das schreibe, kommt ein Brief, von einem, der mir in langen Gesprächen großes Vertrauen geschenkt hat. Seine Zeilen machen mich glücklich: „Ich denke oft an dich und an die Zeit, in der du mich unterstützt hast. Mein Weg war steinig, aber jetzt glaube ich auf dem richtigen Weg zu sein, und ich arbeite wieder mit Begeisterung und Hingabe. Ich habe mich von alten Wertvorstellungen losreißen und in neue hineinbegeben können. Dafür bin ich unendlich dankbar.“ Wie gesagt: Es sind die Worte, die wir im Vertrauen zueinander sprechen und miteinander tauschen, die den Gedanken Flügel verleihen und uns damit, wie es in einem Gedicht von Hermann Hesse heißt, „neuen Räumen jung entgegensenden“.
Augustin
Im siebten Wiener Gemeindebezirk, Ecke Kellermanngasse/Neustiftgasse, befindet sich der Augustinbrunnen, benannt nach dem Dudelsackpfeifer und Bänkelsänger Markus Augustin, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts durch die Gassen und Lokale der Stadt zog und die Menschen mit Spiel, Gesang und oftmals auch derben Scherzen zu unterhalten wusste. Auf meinen Spaziergängen komme ich oft an diesem Brunnen vorbei. Schmunzelnd lese ich dort: „I wor hin, jetzt hobts mi wieda, drum hörts auf meine Lieder!“
Zur Institution wird „Der liebe Augustin“, als er im Jahre 1679 während der Pest trotzdem seinen Humor nicht verliert und anfängt, auch den nahen Tod und die damit verbundene Not zu besingen. Aber aus Angst vor der Ansteckung ziehen sich die Menschen aus den Lokalen zurück. Augustin singt und spielt in den einsamen Gassen und in leeren Gaststätten. Von den Wirten trotzdem verpflegt und vor allem mit Alkohol versorgt, trinkt er nicht selten mehr, als er verträgt, und bleibt auf dem Weg nach Hause auf offener Straße liegen. Dort finden ihn die Pestknechte: „Do schau her!“, ruft einer und bekreuzigt sich dreimal. „Des is jo der Augustin! Wenn’s den a scho erwischt hat, steht die Welt nimma lang!“ Die Männer packen die vermeintliche Leiche auf den Wagen, den Dudelsack dazu, karren ihre Fracht zur Pestgrube nach St. Ulrich und kippen sie hinein. Als Augustin die Augen aufschlägt, weiß er nicht recht, wo er ist. Zuerst glaubt er, das Brummen, das er hört, komme aus seinem Schädel. Bald aber merkt er, dass er von Tausenden Fliegen umschwirrt wird. Und was für ein Gestank um ihn herum! Dass er so weich sitzt, macht ihn stutzig. Da ist ein Mensch unter ihm! Einer? Nein, ein ganzer Haufen, Männer, Frauen, Greise, Kinder – alle mit schwarzen Pestflecken übersät! Den Augustin packt die Panik. „I wü auße do!“, schreit er. „Helft’s ma! Hüüüüfe!!!“ Doch niemand hört ihn. In seiner Verzweiflung greift er zum Dudelsack. „Der Augustin soll sterben, wie er g’lebt hat“, sagt er zu den Toten. „Spü’ auf!“ Und so sitzt er in der Grube und spielt in seiner Angst ein Lied nach dem anderen …
Einige Kirchgänger bleiben verwundert stehen. Die Musik, die sie hören, kommt nicht aus der Kirche. Sie gehen den Klängen nach, finden Augustin in der Pestgrube und helfen ihm heraus. So jedenfalls erzählt es eine der vielen Auffindungsgeschichten. Dass er die Nacht unter all den Toten verbracht hat, ohne sich anzustecken, verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Wien. Die Menschen schöpfen wieder Hoffnung. Augustin bleibt „pumperlgsund“ und beweist damit, dass die Pest nicht unbesiegbar ist. Aus dieser Episode entsteht das Wiener Volkslied mit dem bekannten Refrain: „Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin! Oh, du lieber Augustin! Alles ist hin!“
Augustins Geschichte mag makaber klingen, in ihr aber steckt viel Weisheit und viel vom sogenannten Wiener Gemüt. Der Wiener, wenn es ihn im Sinne Augustins noch gibt, liebt es, sich mit dem Tod zu beschäftigen, ihn als „Freunderl“ zu besingen. Um sich den Tod vom Leib zu halten, trinkt er augenzwinkernd mit ihm „Bruderschaft“! In feinen oder gröberen humoristischen Nuancen finden wir das aber wohl sonst auch. Ein russisches Sprichwort etwa meint: „Was fürchtest du den Tod, Väterchen? Es hat noch keiner erlebt, dass er gestorben ist.“
Mark Twain wundert sich, wozu wir eine Friedhofsmauer brauchen. „Die, die draußen sind, wollen nicht hinein, die, die drinnen sind, können nicht mehr hinaus. Wozu also eine Mauer?“
Zwei Lektionen bleiben den Wienern, die sie ihrem Augustin verdanken:
Erstens, es scheint sich in allen Situationen des Lebens zu lohnen, auch die andere Seite der Medaille anzuschauen. Gerade darin liegt ja die wohltuende Wirkung des Humors. Wer konfrontiert mit Bedrohung und Gefahr nicht vor Angst erstarrt, sondern „engagiert gelassen“ bis zuletzt nach möglichen Auswegen sucht, hat zum Schluss die besseren Karten in der Hand. Humor hat, wer ihn auch angesichts des Todes nicht verliert. Augustin jedenfalls hat ihn als die beste Medizin gegen die Pest erfahren. Vielleicht liegt ja gerade darin auch der innere Grund für die Verbundenheit der Wiener zu ihrem „lieben Augustin“. Zweitens, Augustins Pestgrubenerlebnis aus dem Jahre 1679 bestätigt auch eine Entdeckung, die erst rund 200 Jahre später dem großen Chemiker und Mikrobiologen Louis Pasteur (1822–1895) gelungen ist. Seine entscheidenden Beiträge zur Vorbeugung gegen Infektionskrankheiten fasst er in dem Satz zusammen: „Der Keim ist nichts, das Terrain ist alles!“
B
Begeisterung
Das menschliche Gehirn wird so, wie es der Mensch benutzt, aber ganz besonders so, wie er es mit Begeisterung benutzt. Was in seinem Gehirn mit Nachdruck hängen bleibt, hängt mit Erlebnissen zusammen, die ihn berühren, bewegen, ihm „unter die Haut“ gehen. Und hier tut sich schon ein erstes ernstes Problem auf: Viele Menschen haben in ihrem Leben nicht nur die Begeisterung, sondern mit ihr auch die Lebensfreude verloren. Und weil ihnen in der Folge nichts mehr unter die Haut geht, glauben sie sich den Luxus der Begeisterung auch nicht mehr leisten zu können. Sie haben sich wunderbar angepasst an das, was täglich von ihnen verlangt wird. Dadurch haben sie sich selbst funktionalisiert. Sie „funktionieren“ nur mehr, und ihr glatter Panzer, mit dem sie sich dabei umgeben, ist kaum noch durchdringbar. Bereits beim Erwachen wissen sie, was der Tag bringen und was an diesem Tag zu vollbringen sein wird. Aber trotz allem befindet sich auch bei diesen Menschen als wunderbar angepasste und stereotyp funktionierende Zeitgenossen hinten auf dem Rücken eine kleine Stelle, an der sie noch berührbar und damit auch verwundbar sind, die Stelle, wo beim Bad des Siegfried im Drachenblut das Lindenblatt gelegen hat. Dort steht geschrieben: „Es gibt kein gutes Leben ohne Begeisterung!“ Der Begriff „Begeisterung“ ist in diesem Zusammenhang auch deshalb so wichtig, weil daran zu erkennen ist, woran eine Gesellschaft, der nichts mehr nahegeht, besonders zu leiden hat. Es fehlt vielen Menschen das innere Feuer, der Antrieb und die Motivation, etwas, das sie bewegt und von innen her anrührt …
Wo aber allzu lange nichts mehr passiert, erlischt das Leben, berührt uns das Unvorhergesehene, das Überraschende, das Wohltuend-Andere nicht mehr, das, wovon wir in glücklichen Momenten so gerne berichten und von dem wir dann sagen, dass wir nie gedacht hätten, solches (noch einmal) erleben zu können. Wo solche Erlebnisse nie stattfinden oder zur absoluten Rarität verkommen, ist es gut zu verstehen, dass Menschen, denen es an Begeisterung fehlt, krank werden. Wenn die WHO den westlichen Industriestaaten für die nächsten zwanzig Jahre den Anstieg von Angststörungen und depressiven Erkrankungen vorhersagt, dann kann die Schlussfolgerung daraus doch wohl nur lauten: Die Gesellschaft, in der wir leben, schreit geradezu nach Veränderung. Dabei geht es nicht um ein gemütlich-oberflächliches „Schau-ma-mal-dannseh-ma-schon“, sondern um unser aller nacktes Überleben. Der Umgang mit der Natur muss noch deutlicher ins Bewusstsein rücken, menschliches Miteinander in allen Lebensbereichen neu überdacht werden, die Behandlung von Kranken in einen größeren Zusammenhang gestellt und junge wie alte Menschen aus einer völlig neuen Perspektive betrachtet werden. Was eine seelisch gesunde Gesellschaft braucht, sind Beispiele des Gelingens, an denen deutlich wird, wie es gemacht werden kann und wie es anders gemacht werden muss, damit es gelingen kann.
Ein sozial hochkarätig wirksames Medikament lautet: Rede jeden Tag wenigstens einmal mit einem Menschen, der viel älter ist als du, und bemühe dich gleichzeitig, jeden Tag wenigstens einen Gesprächspartner zu finden, der weit jünger ist als du. Das Interesse an den Erfahrungen und Sichtweisen anderer Menschen macht uns reich, offen, hellhörig und weit. „Wir müssen füreinander Sorge tragen und füreinander da sein“, sagte ein Indianerhäuptling. „Deshalb fragen wir uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, welche Folgen sie für spätere Zeiten hat und ob sie den kommenden Generationen nützt oder schadet. Wir arbeiten mühevoll auf unseren Feldern, von deren Früchten wir leben; genauso müssen wir jede Mühe auf uns nehmen, für die Menschen zu sorgen, die um uns sind – denn auch von ihnen leben wir.“
Die Basis aller Begeisterung ist der richtige Geist
„Be-Geist-erung“ lebt aus dem richtigen Geist. Und diesen Geist gibt es nur in Gruppen. Einer allein losgelöst und völlig isoliert von anderen Menschen kann sich nicht begeistern. Was also jeder Mensch, der sich für irgendetwas begeistern will/kann, dringend braucht, ist eine Gruppe, in der ein Gruppengeist gepflegt wird, der nicht nur toleriert und akzeptiert, sondern einlädt, aufmuntert, ermutigt, inspiriert und mitreißt.
Wenn es zur Ermöglichung von Begeisterung also den richtigen Geist braucht, und wenn sich dieser Geist nur in Gruppen finden lässt, dann ist es leicht zu verstehen, wie wichtig es für den einzelnen Menschen ist, sich immer wieder gründlich zu fragen, in welcher Gruppe von Menschen er sich aufhält, mit wem er sich umgibt, wem er täglich begegnet und davon (zunächst kaum bemerkbar, aber nach und nach unübersehbar) nachhaltig geprägt wird.
Geist gibt es in einer Familie, im Kindergarten, in der Schule, im Fußballverein, im Unternehmen, im Krankenhaus, in der politischen und religiösen Gemeinde. Alle diese Gruppen brauchen ihren ganz bestimmten Geist, denn ohne Geist gibt es keine Gemeinschaft, geschweige denn Begeisterung! Geist ist das, was Menschen verbindet und was den Rahmen bietet für die Erfahrung, die die Menschen in diesem System machen können. Wir sprechen deshalb ja auch vom „Familiengeist“, vom „Gruppengeist“, vom „Gemeinschaftsgeist“, vom „Teamgeist“ und der notwendigen „Be-Geist-erung“ der einzelnen Gruppenmitglieder, die dafür Sorge tragen müssen/sollten, dass heiliger, heilender, guter Geist in den Gruppen bleibt und sich dort ausbreitet. Um diesen Geist, um den „guten Geist“ muss man sich täglich kümmern, und wenn sich zu lange niemand darum kümmert, dann verschwindet, verkümmert dieser gute Geist und auf dem leer gewordenen Platz zieht der Ungeist der reinen Verwaltung, der „Verwaltungsgeist“, ein.
Der Verwaltungsgeist nimmt dann nach und nach das System in Geiselhaft und bestimmt alles, was in der Gemeinschaft gemacht oder aber auch nicht mehr gemacht werden kann. Der Buchstabe des Gesetzes übernimmt das Kommando und der jetzt herrschende Geist gebiert als „Ungeist“ neue Haltungen. Statt die Mitglieder zu fördern, erfolgt die Bedürfnisbefriedigung einzelner weniger, die es sich zu richten wissen. Was die Gruppenmitglieder dabei erleben, ist keine Ermutigung mehr, sondern das Erlebnis „verwaltet“ zu werden. Aus dieser Erfahrung des „Verwaltet-Werdens“ entsteht dann eine Haltung, die, um nur ein Beispiel zu nennen, aufseiten der Schüler meint, dass es die Aufgabe des Lehrers wäre, dafür zu sorgen, dass Schüler ohne Anstrengung möglichst schnell möglichst viel lernen. Dass mit einer solchen Einstellung das Lernen unmöglich wird, versteht sich von selbst! Oder es entsteht aufseiten der Lehrer die Hoffnung auf das baldige Ende des Unterrichts. Was dabei Lehrer mit Schülern noch miteinander verbindet, ist die Hoffnung, dass sie bald nichts mehr miteinander verbindet! Zu guter Letzt passt dann der Ungeist, der eingezogen ist, zu den Haltungen, die er selbst erzeugt hat. Das ist ein systemisches Problem, das nur schwer wieder aufzulösen ist, weil die beiden Seiten sich gegenseitig stabilisieren. Und dann kommt ein neuer Chef und will alles anders machen, aber er beißt sich dabei die Zähne aus!
Viele Visionäre und Lichtgestalten der Geschichte sind daran zerbrochen, dass sie zu schwach waren, für einen Geist zu sorgen, der ihren Visionen hätte Raum verschaffen können. So ist zum Beispiel Papst HadrianVI. (1459–1523) alles andere als ein schwacher Mann gewesen, aber leider war er nicht stark genug, seiner visionären Kraft zum Durchbruch zu verhelfen. Mit seinem Wunsch, Luthers Reformideen aufzugreifen und sich mit ihm zu versöhnen, musste er scheitern. Die römische Kurie, sein unmittelbares Umfeld wusste dafür zu sorgen, dass seine Regierungszeit nach knapp zwölf Monaten zu Ende war. Für den Besucher seiner Grabstätte in der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima in Rom, unweit der Piazza Navona, ist dieses geschichtliche Faktum pointiert formuliert in dem Satz zusammengefasst: „Ach, wie schade! Wie viel hängt doch davon ab, in welche Zeitumstände, in welche zeitgeistige Atmosphäre die Kraft auch des besten Menschen fällt!“
Ein Gegenbeispiel dafür, was Gruppengeist zu fördern imstande ist, findet sich zehn Gehminuten davon entfernt im Pantheon. Dort befindet sich in einem antiken Sarkophag aus griechischem Marmor das Grab Raffaels (1483–1520), aus dessen Inschrift der Stolz seiner Zeit auf seine großen künstlerischen Leistungen abzulesen ist:
„Dieser hier ist Raffael, von dem die Natur zeit seines Lebens fürchtete, übertroffen zu werden und jetzt, da er gestorben ist, glaubt sie, selbst sterben zu müssen.“
Alles, was geschieht, ereignet sich in den Koordinaten von Zeit und Raum. Aber es ereignet sich auch in der Atmosphäre eines ganz bestimmten Geistes, der einlädt und beflügelt oder aber verhindert und zerstört, und darüber entscheidet, ob diese Koordinaten von Raum und Zeit auch zu Glückskoordinaten werden konnten.
Beten
Gemeinsam zu beten ist mir seit früher Kindheit vertraut. Samstagabends saßen wir um den Küchentisch, vor allem zu den großen Festtagen wie Weihnachten und Ostern. Besonders lang und gründlich wurde zum Jahreswechsel gebetet. „Danken für das alte Jahr und bitten um ein glückseliges neues Jahr!“ So habe ich die Stimme meiner Mutter im Ohr. Unvergesslich auch unser Beten in der Familie bei Unwettern. Nach der Montage eines Blitzableiters hat das Rosenkranzgebet bei Unwettern allerdings stark nachgelassen, ganz verschwunden aber ist es in meinen Kindertagen nie. Mein persönliches Beten kennt auch heute noch drei Blickrichtungen: nach vorne, nach oben und zurück. Lehrmeister dazu war mir schon zu Schulzeiten der Volksmund: „Drei Blicke tu zu deinem Glück: vorwärts, aufwärts und zurück!“ Beten bedeutet für mich, zum Ausdruck zu bringen, was in mir vor sich geht. Bitten und Danken, Frohlocken und Singen, Weinen und Klagen, das alles ist ein menschliches Grundbedürfnis. „Orare“, das lateinische Wort für „beten“, bedeutet ja im Grunde nichts anderes als „den Mund auftun“ und zum Ausdruck zu bringen, was im Innersten vor sich geht.
Jeder Mensch verdankt sich anderen, er steht auf den Schultern derer, die vor ihm waren und ohne die er nicht auf der Welt wäre. Wer nicht zurückschaut, wer sich um die Wurzel seiner Existenz nicht kümmert, wer so tut, als wäre er ewig aus dem Nichts gekommen oder gar das Produkt seiner selbst, wird im tiefsten Sinn des Wortes „rücksichts-los“. Der Blick zurück ist eine der drei Grundrichtungen menschlichen Daseins. In diesem Blick zurück ist das „Danken“, das bewusste „Daran-Denken“ (aus diesem Wort hat sich das deutsche Wort „danken“ entwickelt) die eine der drei Grundmelodien des Menschen, wenn er seinen Mund auftut und artikuliert, was in ihm vor sich geht. Die zweite Grundrichtung menschlichen Daseins ist der Blick nach vorne und die daraus resultierende Grundmelodie die Bitte. Menschsein heißt zu wissen, dass wir aufeinander angewiesen bleiben. Niemand kann sagen, was morgen sein wird, was von seinen Wünschen und Vorsätzen in Erfüllung geht. Wer glaubt, alles selbst leisten und niemanden um etwas „bitten“ zu müssen, wer das Vertrauen nicht kennt, anderen etwas überantworten zu können, weiß nichts von einem großen Teil der Schönheit des Lebens. Ein armer Teufel, wer das „Bitten“ verlernt hat und schließlich stattdessen eine Versicherung abschließt. Schon seit Jahren stelle ich mir die Frage, was ich eigentlich versichere, wenn ich in der momentan so eklatant unsicheren weltwirtschaftlichen Gesamtlage eine „Lebensversicherung“ abschließe. Was versichern uns Versicherungen? Je unsicherer die Wirtschaftslage, desto höher die Versicherungssumme. Im Grunde versichern wir unsere eigene Verunsicherung und auf diese schließen wir dann noch eine sogenannte „Rückversicherung“ ab.
Die dritte Grundrichtung menschlichen Daseins ist der Blick „nach oben“. Die daraus resultierende Grundmelodie sind Jauchzen vor Freude, Singen, Tanzen und Springen, „Außer-sich-Sein“.
Ihren Gipfel erreicht diese dritte Grundmelodie, wenn es einem Menschen die Sprache verschlägt, wenn er mit offenem Mund und wie angewurzelt vergebens ums Wort ringt und staunt. Wer staunt, gerät nicht in Gefahr, sich mit Gott zu verwechseln. Ihm fehlen die Worte, sein Mund bleibt offen, staunen nur kann er und staunend sich freuen …
Benedikt und Ignatius
Was mich in meiner Zeit als Seelsorger bei Gottesdiensten immer wieder besonders beeindruckt hat, waren beim Austeilen der Kommunion mir entgegengestreckte, offene, von schwerer Arbeit gezeichnete Hände.
„Ora et labora“ (bete und arbeite!): Mit diesen drei Worten bringt es die Ordensregel des Benedikt von Nursia auf den Punkt. Die von Ignatius von Loyola rund tausend Jahre später daraus abgeleitete, geradezu tiefenpsychologisch relevante Formel lautet: „Bete, als hinge alles von dir ab, handle, als hinge alles von Gott ab!“ Dieses Leitmotiv des Ignatius wird oft falsch zitiert, ist dadurch dann zwar leichter nachvollziehbar, bleibt aber weit hinter dem Kern der ursprünglichen Aussage zurück und klingt im Vergleich dazu banal: „Bete, als hinge alles von Gott ab, handle, als hinge alles von dir ab!“ Im Grunde lässt sich das auch mit einem anderen geflügelten Wort zum Ausdruck bringen: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!“ Ignatius aber wollte „mehr“, und dieses „magis“ besteht für ihn nicht darin, mehr zu tun, sondern darin, bei den vielen Angeboten und Möglichkeiten die richtige Entscheidung zu treffen. Denn, so sagt er, man hätte es ja nicht einfach damit zu tun, zwischen „gut“ und „schlecht“ zu unterscheiden, sondern zwischen dem einen Guten und dem anderen. Wie oft würden wir am liebsten beides tun! In solchen Situationen der Unsicherheit entdeckt Ignatius „magis“ als Entscheidungshilfe. In seinem „Exerzitienbüchlein“1, das ich (obwohl dafür von vielen Psychotherapeuten milde belächelt) für ein psychokriminologisches Meisterwerk halte, entwickelt er eine Methode, in Lebensentscheidungsfragen, an wichtigen Wegkreuzungen des eigenen Lebens sich einem dreißigtätigen Nachdenkprozess auszusetzen, um auf dieser Basis die zentralen Fragen des Lebens nicht durch „Vielwissen“, sondern durch das „Verkosten der Dinge von innen her“2 zu beantworten.
Beten und Arbeiten erscheinen so betrachtet als die beiden Grundhaltungen eines Menschen. Durch Kontemplation und Aktion, kraft seiner geistigen und körperlichen Arbeit bleibt er so auf der Suche nach seinen unverwechselbaren Weltmitgestaltungsmöglichkeiten. Bei all seinen persönlichen Begabungen vergisst er aber nicht, dass diese ihm zuallererst geschenkt sind. Darum schreibt Paulus den Korinthern: „So soll keiner sich wichtigmachen für den einen und gegen den anderen. Denn wer gibt dir Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du nicht empfangen?“ (1 Kor 4, 6–7 in der Übersetzung von Fridolin Stier)
Blau
Blau ist meine Lieblingsfarbe. Sie bewirkt von allen Farbempfindungen die tiefste Beruhigung. Experimente beweisen, dass bei längerem Betrachten von Dunkelblau die Atmung langsamer wird, der Puls abnimmt und der Blutdruck sinkt. Wassily Kandinsky hat das Blau als „konzentrische Bewegung“ beschrieben und gemeint, dass diese Farbe vom Mitmenschen weg ins eigene Zentrum führe. In allen Ländern Westeuropas, ja sogar der gesamten westlichen Welt ist die Farbe Blau seit mehreren Jahrzehnten die am häufigsten getragene Modefarbe. Sie wird es vermutlich noch lange bleiben, meint Michel Pastoureau, dessen Buch „Blau. Die Geschichte einer Farbe“ 2013 in deutscher Sprache erschienen ist.3 Der Himmel und das Meer, die tiefsten unserer Betrachtung zugänglichen Räume, erscheinen uns blau. Das macht Blau auch zur Farbe des Fernwehs. So wird „blau“ auch oft gebraucht, um etwas Fernes, Unbestimmtes zu bezeichnen. „Ins Blaue hineinreden“, sagen wir, und meinen damit „ohne jeden Plan und Zweck“. In unserer Sprache kennen wir „eine Fahrt ins Blaue“ und vor allem den Wunsch, einmal „blau“ zu machen und nicht zu arbeiten. Andererseits verwenden wir die blaue Farbe aber auch, um Ausreden und Lügenmärchen zu umschreiben: Schon im 16. Jahrhundert war von „blauen Argumenten“ die Rede. Heute sagen wir dazu, dass einer „das Blaue vom Himmel herunterlügt“ oder aber, dass einer den anderen anlügt, „dass er blau wird“. Wenn der Briefträger einen „blauen“ Brief bringt, bedeutet das meistens nichts Gutes, ebenso, wenn einer „vom blauen Affen gebissen“ wird. Positiv besetzt hingegen ist das Himmelblau als Gegensatz zum Alltagsgrau.
In unserem Wortschatz ist „blau“ zu einem Zauberwort geworden, zu einem Begriff, der verführt, der beruhigt, der zum Träumen einlädt. Der Klang des Wortes allein schon ist schön, sanft, angenehm, fließend. Wir denken dabei ans Meer, den Himmel, Erholung, Liebe, Reisen, Urlaub und Unendlichkeit. Und das gleich in mehreren Sprachen: bleu, blue, blu, blau – überall klingt es poetisch und beruhigend … Eine der wesentlichen Eigenschaften der Farbe Blau liegt darin, dass sie ruhig ist und kein Aufsehen erregt, friedlich, fast neutral erscheint. In der Romantik regt sie zum Träumen an, heute ist die Farbe an Krankenhauswänden und als Bluebox im Fernsehen beliebt. Blau ist nicht lästig, verstößt gegen nichts, vermittelt Sicherheit und verbindet. Viele große internationale Organisationen haben gerade deshalb die Farbe Blau als ihre Farbe gewählt: die UNO zum Beispiel, die UNESCO, der Europarat und die Europäische Union. Die Farbe Blau wurde so nach und nach zu einer internationalen Farbe mit dem Auftrag, den Frieden und das Verständnis unter den Völkern zu fördern.
Inhalt
Cover
Titel
A
Anfang
Augustin
B
Begeisterung
Die Basis aller Begeisterung ist der richtige Geist
Beten
Benedikt und Ignatius
Blau
C
Carnuntum
Christine Lavant
Constantin Rudolf
D
Dädalus und Ikarus
Dankesrede anlässlich der Verleihung des Berufstitels „Professor“
E
Endlich angekommen
engel kommen selten allein
Wo Engel landen müssen
Essen mit Leib und Seele
Ende
F
Faden nach oben
Fasten! Bitte anschnallen!
Friedrich Heer
Frösche …
Fünf statt drei
Fürchte dich nicht!
G
Gänse
Gelb
Grün
Geschenk des Herzens
Geschenk zur Hochzeit
Gott begreifen
Gott und der Mensch, sein Mitgestalter
Großvater
H
Heilige Schriften
Herzzeit
Hiob
Humor
I
Im falschen Zug
Inquisition als Hilfe für die Institution
J
Janus
Jennie
Johannes XXIII.
Josef Winkler
K
Kardinal König
Kinderfragen
Klang der Stille
L
Labyrinth
Laurentiuskirche
Lehrer, wie wir sie uns wohl alle gewünscht hätten
Leihgabe auf Lebenszeit
Liesl und Hans
Lob der Bescheidenheit
M
Mahler
Mario
Milchmädchenrechnung oder himmlische Mathematik
Muße
Mutter Teresa
N
Narrenfreiheit
Nasreddin Hodscha
Neunundzwanzigster August Zweitausendfünfzehn
Not macht erfinderisch
O
Offene Grenze
Onkel Kajetan
P
Pranger
Problem
Politiker
Q
Quellensucher
R
Rechnitz
Roermond
Romero
Rot
S
Secession
Segnen
Spiritualität und Mystik
U
Über die Dörfer
V
Väter
Versöhnung statt Rache
Verdrehte Welt
Vier Siebe
Violett
W
Warten bis zur Ernte
Wiederentdeckung der Langsamkeit
Weihnachten
Weiß
Weltmaschine
Wunder
wwww: Mit wem ich wo in Wien wohne
Z
Zwei Brüder
Zwischenzeilenleser
Zu guter Letzt
Anmerkungen
Zu den Bildern
Weitere Bücher
Impressum
ISBN 978-3-990-40398-3
© 2015 by Styria premium in der Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG
Wien · Graz · Klagenfurt
Alle Rechte vorbehalten
Bücher aus der Verlagsgruppe Styria gibt es in jeder Buchhandlung und im Online-Shop
LEKTORAT: Elisabeth Wagner
UMSCHLAGGESTALTUNG: Bruno Wegscheider
COVERFOTO: Claudia Prieler
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015