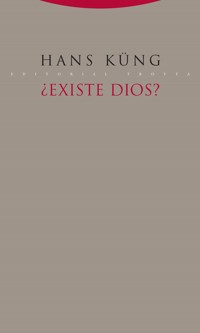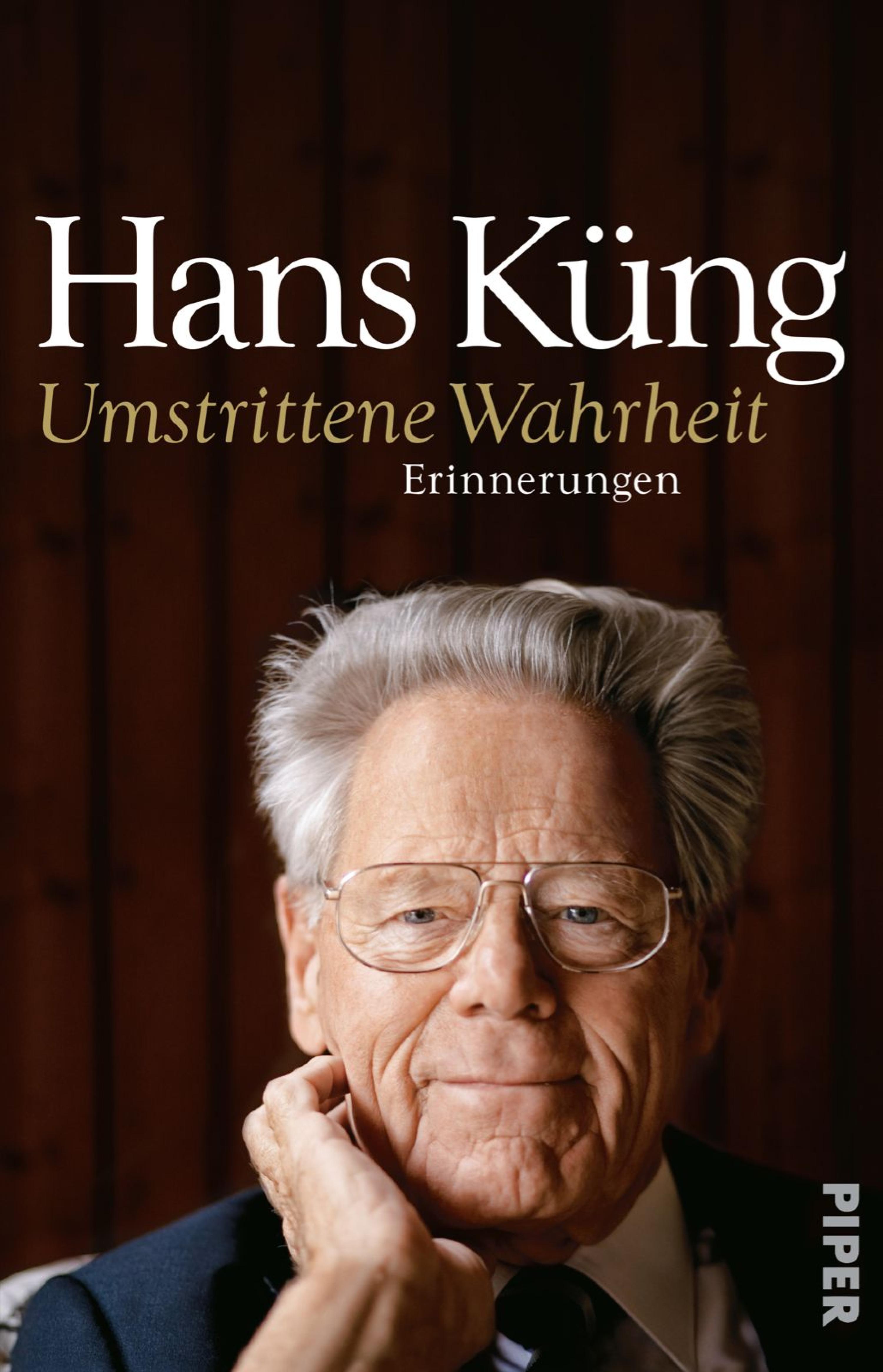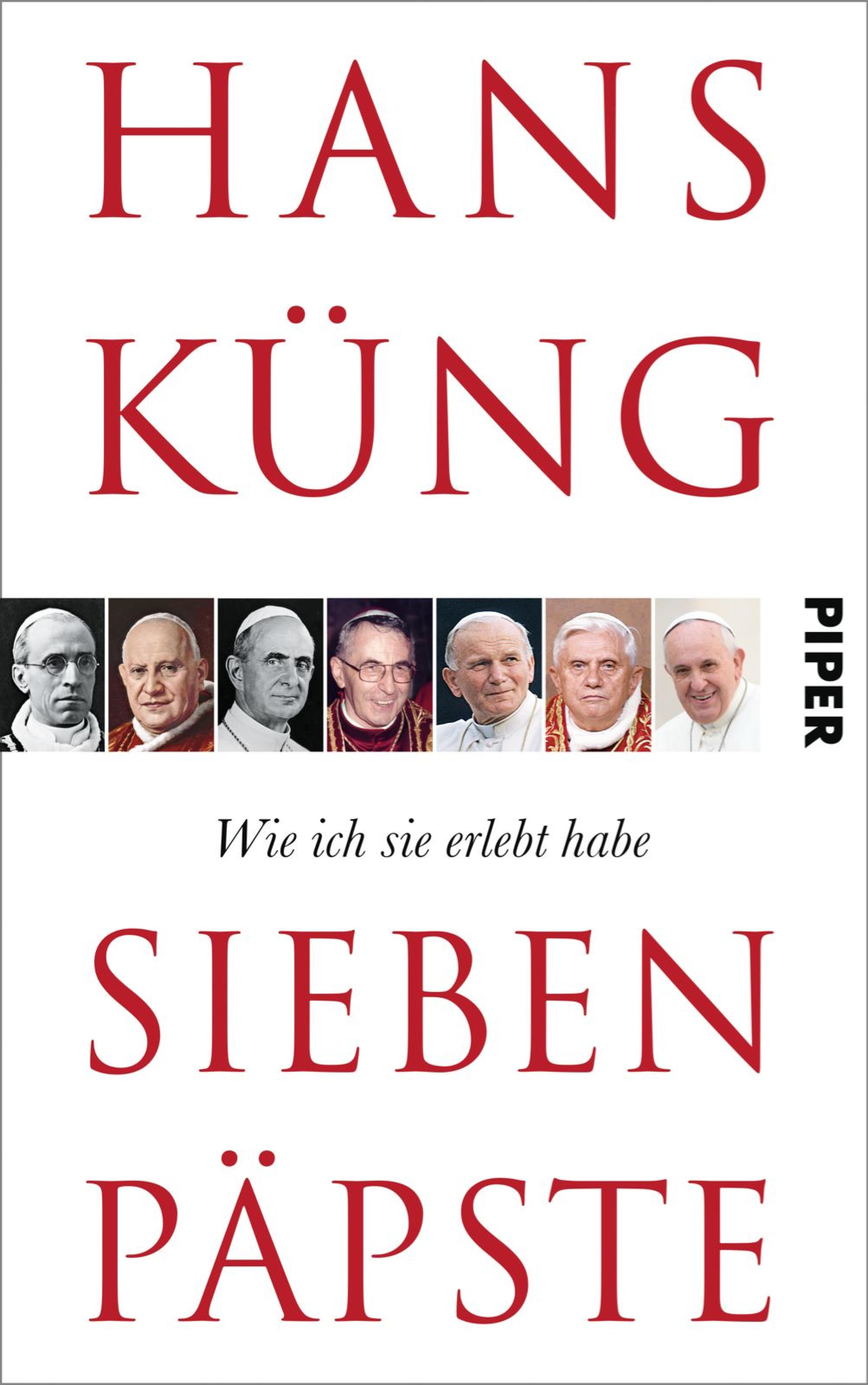13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was glaubt Hans Küng ganz persönlich? Er gilt als universaler Denker unserer Zeit; seine Bücher sind in hohen Auflagen in vielen Sprachen über die Welt verbreitet. Doch dieses Buch ist anders, auch wenn es auf seinem gesamten Werk aufbaut. Es ist das persönliche Glaubensbekenntnis eines Mannes, der das theologische Denken weltweit stärker verändert hat als andere. Wenn man aber die ganze gelehrte Wissenschaft, die theologische Formelsprache, die kunstvollen Theoriegebäude, wenn man das alles hinter sich lässt, was bleibt dann als Kern des Glaubens? Was brauche ich für mein Leben? Was ist mir unverzichtbar? Von »Lebensvertrauen« über »Lebensfreude«, »Lebenssinn« und »Lebensleid« schreibt Küng und schreibt so eine »summa« seines Glaubens – und Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95045-9
Februar 2016
© Piper Verlag GmbH, München 2009
Covergestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de
Coverabbildung: Maurice Weiss/Ostkreuz
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Eine ganzheitliche Weltsicht
»Mal ganz offen, was glauben Sie persönlich?« So oder ähnlich wurde ich ungezählte Male in meinem langen Theologenleben gefragt. Ich versuche diese Frage zu beantworten, nicht nur formelhaft plakativ, sondern persönlich und doch umfassend.
Ich schreibe für Menschen, die auf der Suche sind. Die nichts anzufangen wissen mit dem Traditionalistenglauben römischer oder protestantischer Herkunft. Die aber auch nicht zufrieden sind mit ihrem Unglauben oder ihren Glaubenszweifeln. Die nicht nach einer billigen »Wellness-Spiritualität« oder kurzfristigen »Lebenshilfe« verlangen. Ich schreibe aber auch für alle, die ihren Glauben leben, aber sich darüber Rechenschaft abgeben möchten. Die nicht einfach »glauben«, sondern auch »wissen« möchten und deshalb eine Glaubensauffassung erwarten, die philosophisch, theologisch, exegetisch, historisch begründet ist und praktische Konsequenzen hat.
Im Laufe meines langen Lebens hat sich meine Glaubensauffassung geklärt und geweitet. Ich habe nie etwas anderes gesagt, geschrieben, verkündet, als was ich glaube. Durch viele Jahrzehnte konnte ich Bibel und Tradition, Philosophie und Theologie studieren, und es hat mein Leben erfüllt. Die Ergebnisse finden sich verarbeitet in meinen Büchern. Eines ist auch dem »Apostolischen Glaubensbekenntnis« gewidmet: ein Bekenntnis, das freilich erst seit dem 5. Jahrhundert vollendet vorliegt. Wer Genaueres über diese zwölf höchst unterschiedlichen und vielfach umstrittenen Glaubensartikel (wie zum Beispiel Jungfrauengeburt, Höllenfahrt, Himmelfahrt …), schrift- und zeitgemäß verstanden, erfahren möchte, der lese jenes – für mich nach wie vor gültige – Buch »Credo« (Sonderausgabe unter dem Titel: »Einführung in den christlichen Glauben«). In diesem Buch hier verleugne ich nichts von dem, was ich dort oder im Band »Das Christentum. Wesen und Geschichte« (etwa über die christologischen Dogmen) geschrieben habe.
Aber eine Sache ist die »offizielle Religion« eines Menschen, die ihn mit seiner Religionsgemeinschaft verbindet. Eine andere die ganz individuelle Religion des Herzens (»heart religion«), die ein Mensch »im Herzen« trägt und die sich mit der »offiziellen Religion« nur teilweise deckt. Etwas von dieser unverstellten, persönlichen Lebensphilosophie zu wissen, ist psychologisch eine »via regia«, ein Königsweg, um den betreffenden Menschen in seiner Tiefe zu verstehen.
Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die in Glaubensfragen »das Herz auf der Zunge tragen« und bei jeder Gelegenheit anderen Menschen ihre Glaubensüberzeugungen mitteilen, gar aufdrängen. Takt und Fingerspitzengefühl sind gerade in Gesprächen über Religion erfordert und gefordert. Ohnehin darf ich als Theologe Argumente nicht durch allzu viel Emotionen oder vorschnelle Bekenntnisse ersetzen. Deshalb antwortete ich auf die heutzutage so beliebte Frage nach meiner »Spiritualität«, meiner »Geistigkeit«, häufig, darüber könne man in allen meinen Büchern genug nachlesen. Andererseits aber wollte ich mich dem häufig geäußerten Wunsch nach einer kurzen, zusammenhängenden, allgemein verständlichen Darlegung meiner Spiritualität nicht verschließen. Spiritualität – vom mittellateinischen Wort »spiritualitas« – ist ja sehr viel umfassender als Glaube im religiösen Sinn. Umschließt dieser Begriff doch alle geistigen Prägungen von der orthodoxen Mystik und kirchlichen Dogmatik bis hin zu esoterischen Strömungen und New Age. So verführt er allerdings auch zur Beliebigkeit.
Deshalb will ich denn die zahlreichen spirituellen Elemente, die auf meinem Lebensweg reiften und sich in meinen Büchern finden, sichten, kritisch reflektieren und in eine Synthese bringen. »Was ich glaube«? Ich möchte jedes Wort im weitesten Sinn verstanden wissen.
»Ich« verstehe ich nicht subjektivistisch: Ich fühlte mich nie als stolzen Einzelgänger, gar Auserwählten. Mir liegt seit jeher daran, solidarisch zu denken und zu wirken mit vielen in meiner Glaubensgemeinschaft, in der Christenheit, in den Weltreligionen, ja auch in der säkularen Welt. Ich wäre froh, wenn dieses Buch über weite Strecken auszudrücken vermöchte, was auch die Überzeugung vieler anderer ist.
»Glauben« interpretiere ich also nicht kirchlich verengt oder intellektualistisch verkopft. Einfach annehmen, »was mir die Kirche zu glauben vorschreibt« – diese traditionalistische Formel gilt heute selbst für konservative Katholiken kaum noch. »Glauben« meint ja mehr als nur ein Fürwahrhalten bestimmter Glaubenssätze. Glauben meint, was Vernunft, Herz und Hand eines Menschen bewegt, was Denken, Wollen, Fühlen und Handeln umfasst. Blinder Glaube allerdings ist mir seit meiner römischen Studienzeit verdächtig, wie blinde Liebe; blinder Glaube hat viele Menschen und ganze Völker ins Verderben geführt. Mein Bemühen galt und gilt einem verstehenden Glauben, der zwar nicht über strenge Beweise, aber doch über gute Gründe verfügt. Insofern ist mein Glauben weder rationalistisch noch irrational, wohl aber vernünftig.
»Was« ich glaube, umfasst also erheblich mehr als ein Glaubensbekenntnis im traditionellen Sinn. »Was« ich glaube, meint die Grundüberzeugungen und Grundhaltungen, die mir im Leben wichtig waren und sind, von denen ich hoffe, dass sie auch anderen helfen können, sich im Leben zurechtzufinden: eine Hilfe zur Lebensorientierung. Nicht nur psychologisch-pädagogische Ratschläge zum »Sich- Wohlfühlen« und »Sein-eigenes-Leben-leben«. Aber auch keine Predigt von oben herab, keine Erbauungsrede; ich bin weder Heiliger noch Eiferer. Vielmehr eine von persönlicher Erfahrung getragene, seriös informierende Besinnung zum sinnvollen Lebensvollzug.
Wenn man will: »Meditationen«! »Meditari« heißt wörtlich »ermessen«, »geistig abmessen« und von daher »nachdenken«, »nachsinnen«, »Betrachtungen anstellen«. Meditationen allerdings nicht aus der Perspektive eines Mönches, der aus Gottes Gegenwart heraus redet, sondern aus der eines Weltmenschen, der Gott sucht. Es möge dabei nicht nur mit dem Kopf zugehen, sondern auch unser Herz aufgehen für andere Dimensionen der Wirklichkeit. Meine Spiritualität nährt sich aus Alltagserfahrungen, wie sie viele Menschen haben oder haben können. Doch geklärt durch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sie sich in einem langen Theologenleben ansammeln. Und dabei betroffen von schicksalhaften Welterfahrungen, die ich nicht loslösen kann von einer Kampf- und Leidensgeschichte, wie ich sie in meinen beiden Bänden »Erinnerungen« beschrieben habe.
Glauben als geistige Lebensgrundlage ist heutzutage nicht mehr der Normalfall, christlicher Glaube erst recht nicht. Doch mehr denn je bedürfen wir, von Informationen überflutet, in unserer oft irren wirren Zeit nicht nur des reinen Informationswissens, sondern des Orientierungswissens: klare Koordinaten und Zielpunkte. Dabei braucht freilich jeder Mensch zugleich seinen eigenen inneren Kompass, der in der harten Realität des Alltags für die konkreten Entscheidungen den Ausschlag gibt. Dieses Buch möge zu solcher Grundorientierung verhelfen.
Die Überfülle der sich stellenden Fragen und Themen versuche ich zusammenzuhalten und zu strukturieren durch den vielfarbigen, umfassenden Begriff des Lebens, wie er sich realisiert in der Entwicklung des Lebens überhaupt, im Lauf eines einzigen Menschenlebens, in meiner eigenen Lebensgeschichte. Selbstverständlich lassen sich dabei nicht alle Aspekte und Themen christlichen Glaubens ansprechen. Vieles davon wird in der am Ende aufgeführten Literatur behandelt.
Wozu ich den Leser, die Leserin einladen möchte, ist kein harmloser theologischer Spaziergang auf flachem Land mit Ausflügen in verschiedene Lebensprovinzen. Vielmehr – die Metapher, bildhafte Übertragung, sei mir gestattet – eine spannende geistige Bergtour: in langsamem Bergsteigertritt geduldig bergauf, mit leichteren und mit gefährlichen Passagen, leider ohne Ruhepause bei Berghütten, aber immer klar das Ziel vor Augen, das vom Gipfel her winkt: eine ganzheitliche Weltsicht. Deshalb beginne ich im ersten Kapitel ganz einfach, elementar und persönlich, ich fliege nicht mit einem theologischen Helikopter vom Himmel her ein, sondern beginne unten im Tal des Alltags mit der Vorbereitung: Notwendig für den Menschen, jeden Menschen, ist zunächst einmal das Vertrauen zum Leben, ein Grundvertrauen.
Tübingen, im Juli 2009Hans Küng
1. Lebensvertrauen
»Das Grund-Vertrauen ist der Eckstein der gesunden Persönlichkeit: eine auf Erfahrungen des ersten Lebensjahres zurückgehende Einstellung zu sich selbst und zur Welt.«
Der deutsch-amerikanische Psychologe ERIK H. ERIKSON, führender Vertreter der Jugendpsychologie (»Identity and the Life Cycle«, 1959).
Was ist mir als geistige Grundlage für den Menschen wichtig? Ein Grundvertrauen, ein Lebensvertrauen. Das Vertrauen zum Leben hat in jedem Menschen seine eigene Geschichte. Sie beginnt spätestens in dem Moment, da das Kind das Licht der Welt erblickt.
Der Eckstein einer gesunden Persönlichkeit
Lebensvertrauen freilich ist nicht einfach »da«, es will gelernt sein. Erik Erikson und andere Entwicklungspsychologen haben es empirisch untersucht: Das Kind lernt buchstäblich an der Mutterbrust, dem Leben zu trauen. Für eine gesunde physisch-psychische Entwicklung des Kleinkindes ist der Erwerb von Grundvertrauen von vitaler Bedeutung. Ist ein Kind schon im Säuglingsalter geschädigt – durch psychogene Krankheiten, durch Entzug der Bezugsperson oder durch emotionale Defizite von uninteressierten oder überbeschäftigten Pflegerinnen (der von René Spitz schon früh untersuchte »Hospitalismus«) –, dann kann ein Grundvertrauen gar nicht erst entstehen. Für Erik Erikson ist das erste Stadium in der Entwicklung des kleinen Kindes (ungefähr das erste Lebensjahr) geradezu identisch mit dem Stadium des Grundvertrauens (»basic trust«).
Weitere Forschungen haben gezeigt, dass die Mutter (oder eine entsprechende Ersatzperson) geradezu die Vertrauensbasis bildet für alle Welterforschung des Kleinkindes. Man braucht nicht wie ich fünf jüngere Schwestern und einen jüngeren Bruder gehabt zu haben, um genau beobachten zu können, wie ein Kind, wenn es krabbelnd zur Welterkundung und zum Kontakt mit anderen Personen fähig wird, doch immer wieder den Blickkontakt mit der Mutter sucht und zu weinen beginnt, sobald es ihn verliert. Und wie es im zweiten Jahr, zwar jetzt fähig, sich auch außerhalb der Sicht der Mutter zu bewegen, doch immer wieder zur Mutter zurückkehrt und, falls nicht, Trennungsangst zeigt.
Indem das Kind sich so zunächst der Mutter öffnet, öffnet es sich – unter langsamer Ablösung von der Mutter – den Menschen, den Dingen, der Welt. Neue Forschungen untermauern, wie wichtig die frühe Bindung für ein starkes Ich ist. Je unsicherer ein Kind in seiner Mutterbindung, desto mehr ist es im Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen blockiert, da es ganz damit beschäftigt ist, mindestens eine zuverlässige Mutterbindung aufzubauen. Und umgekehrt: Vom Vertrauen zur Mutter (oder ihrer Ersatzperson) her bildet sich in einem komplexen Prozess – auf die Stellung des Vaters und so manches andere gehe ich hier nicht ein – das zunächst naiv-fraglose Grundvertrauen des Kindes, das ihm einen Stand im Leben ermöglicht, aber ständig gefährdet ist und auf die Probe gestellt wird. Und ich selber?
Lebensvertrauen auf dem Prüfstand
Ich gehöre zu den zahllosen Menschen, die aufgrund einer keineswegs problemlosen, aber intakten Beziehung zu Mutter, Vater und anderen Bezugspersonen ein starkes Lebensvertrauen mitbekommen haben. Doch auch mein Vertrauen wurde immer wieder vom Leben selbst auf die Probe gestellt. Von Anfang an lernen wir Menschen nicht nur durch Erziehung, sondern durch eigenes Erfahren und oft auch persönliches Erleiden. »Gebranntes Kind scheut das Feuer« heißt nicht zufällig ein altes Sprichwort.
Als vielleicht frühestes Erlebnis am eigenen Leib bleibt mir: Als Drei- oder Vierjähriger stecke ich meinen linken Zeigefinger in eine Brotschneidemaschine, um ein kleines Brotfetzchen herauszuklauben und drehe gleichzeitig mit der rechten Hand die Kurbel – die Fingerkuppe samt Nagel liegt abgeschnitten in der Maschine. Damals war ein hervorragender Hausarzt noch fähig, die Kuppe mit Hilfe von Haut vom Bein meines Vaters wieder an meinen Finger anzunähen, sodass man heute kaum einen Unterschied bemerkt.
Auch die erste Tote blieb mir, dem damals Sechsjährigen, in ständiger Erinnerung: Meine Großmutter, umgekommen bei einem tragischen Autounfall, mein Großvater war am Steuer. Bleich, ruhig und schön lag sie da; nur ein kleiner roter Punkt von Blut auf der Stirn zeugte von ihrer Verletzung. Man sagte mir, sie sei jetzt »im Himmel« … Doch solche und viele andere Erfahrungen haben bei mir kein psychisches Trauma hinterlassen und konnten mein Lebensvertrauen nicht erschüttern.
Aufgrund vieler persönlicher Erfahrungen bin ich deshalb – bei aller Hochschätzung der Psychotherapie – zurückhaltend gegenüber jenen Psychoanalytikern, die bei allzuvielen späteren Problemen ein frühkindliches Trauma entdecken wollen. Natürlich weiß ich, dass es schon früh und immer mehr zu schweren Vertrauenskrisen kommen kann: durch Versagen in Schule, Ausbildung und persönlichen Beziehungen. Dann aber auch durch eine aussichtslose Zukunft, durch Arbeitslosigkeit, verratene Freundschaft und erste große Enttäuschung in der Liebe. Schließlich durch Scheitern im Beruf, Verlust der Gesundheit, die oft unerträgliche Last des Daseins …
So muss beim einen früher, beim anderen später aus dem fraglosen, vorbehaltlosen, unwillkürlichen Vertrauen des zunächst ganz von der Mutter abhängigen Kindes durch Krisen hindurch ein gereiftes, verantwortetes Grundvertrauen wachsen: das überlegte, kritische Vertrauen des selbständig gewordenen Erwachsenen zur undurchsichtigen, schwer fassbaren Wirklichkeit von Welt und Mensch. Echtes Selbstvertrauen ist Voraussetzung für eine starke und mitfühlende Persönlichkeit. Und je länger, desto weniger kommt man um eine bewusste Grundentscheidung herum, wie man sich zum Leben, zu den Mitmenschen, zur Welt, zur Wirklichkeit einstellt. Ohne ein gereiftes Grundvertrauen, ein Lebensvertrauen, kann man Lebenskrisen kaum bestehen.
Eine scheinbar sichere philosophische Basis
Zwei Jahrzehnte bevor ich zum ersten Mal ein Wort von Erik Erikson las, hatte ich mich – Theologiestudent am von Jesuiten geleiteten päpstlichen Collegium Germanicum in Rom – mit der Frage nach einem sicheren Standpunkt und einer sicheren Wissensbasis herumgeschlagen. Sechs Semester Philosophie mit einer Philosophiegeschichte, die hervorragende Einführungen in das Denken von Kant und Hegel mit einschloss. Mit einer Lizentiatsarbeit über Jean-Paul Sartres Existentialismus als Humanismus – in den 50-er Jahren à la mode – schloss ich mein Philosophiestudium ab.
In Rom gelernt habe ich, worauf ich bis heute keinesfalls verzichten möchte: lateinische Klarheit, terminologische Präzision, in sich kohärente Beweisführung und überhaupt strenge Arbeitsdisziplin. Und so war ich nach drei Jahren fest davon überzeugt, für mein Leben einen Standpunkt, für meinen Lebensweg eine absolut sichere wissenschaftliche Basis gewonnen zu haben, die ich jederzeit rational verantworten konnte.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich in Rom nach dem Lizentiat in Philosophie mit einem Schweizer Freund vom Pontificium Collegium Germanicum zum Pincio, Roms großem Park, hinaufspazierte. Wir fanden es großartig, dass wir uns, mühselig genug, ein klares, durch und durch rationales philosophisches Fundament für die Theologie erarbeitet hatten: eine natürliche Basis evidenter Seinsprinzipien und in methodischer Strenge abgeleiteter Schlussfolgerungen. Auf dieser natürlichen Basis von Vernunft und Philosophie bräuchten wir jetzt nur mit derselben Gründlichkeit den übernatürlichen Überbau des Glaubens und der Theologie aufzubauen. So wären wir für das Leben gerüstet: für den Umgang mit uns und mit den anderen Menschen, für unsere Arbeit, unser Weltverständnis, unsere Zeitgestaltung. Dachten wir. Aber gerade dieses Stockwerk-Schema von Vernunft und Glauben erwies sich als trügerisch. War diese neuscholastische »Philosophia perennis«, so zweifelte ich immer mehr, eine wirklich tragfähige, sichere Basis?
Woran ich zweifle
Einen letzten Zweifel, zunächst nicht sehr ernst genommen, hatte ich nie richtig ausgeräumt. Nun gehören Zweifel zum Denken. Es gibt dumme oder oberflächliche Zweifel, die sich leicht durch Information beseitigen lassen. Doch es gibt intelligente Zweifel, die tiefer gehen und sich in uns festsetzen. So wurde ich mir schon in meinen römischen Tagen klar darüber, dass ich nie so sanftmütig und »ausgeglichen« werden könne wie unser beispielhafter Mitstudent und Präfekt, der es später freilich zu einem höchst engstirnigen Bischof einer großen deutschen Diözese bringen sollte.
Auf der intellektuellen Ebene schien mir alles kristallklar, aber auf der existentiellen Ebene blieb eine verdrängte Ungewissheit. Sie drängte sich auch während der ersten theologischen Semester immer wieder auf und ließ mich bezweifeln, dass alles letztlich einleuchtend, abschätzbar und beweisbar sei: Ist es wirklich so klar, so einleuchtend, dass mein Leben einen Sinn hat? Warum bin ich so, wie ich bin? Ich habe Schwächen und Fehler, die ich nicht einfach wegwünschen kann. Warum muss ich mich so annehmen, wie ich nun einmal bin, mit meinen positiven und negativen Seiten? Die Annahme meiner selbst aufgrund vernünftiger Argumente erschien mir schwierig.
Und was will ich eigentlich? Was ist der Sinn meiner Freiheit? Warum ist sie nicht einfach auf das Gute ausgerichtet? Was treibt mich? Warum ist Schuld möglich? Und fällt die Möglichkeit des Versagens, Verfehlens, Schuldigwerdens nicht auf den zurück, der den Menschen so gewollt hat, sodass ich selber entlastet bin? Auch meine höchst ambivalente Freiheit aufgrund rein rationaler Einsicht zu bejahen, erschien mir unmöglich.
Angesichts solcher Fragen und Bedrängnisse, angesichts auch täglicher methodischer Gewissenserforschung halfen mir die angeblich evidenten Seinsprinzipien der griechisch-thomistischen Metaphysik wenig: dass Sein Sein ist und nicht Nichtsein. Aber ist das Sein wirklich nicht Nichtsein? Jedem Seienden komme als solchem Identität, Wahrheit und Gutheit zu. Aber ist das Seiende nicht vielfach widersprüchlich, unwahr, ungut? Wie steht es um das Böse in der Welt?
Die klassischen Seinsprinzipien konnte man im Zeitalter des Nihilismus und Existentialismus auch bestreiten – mit Verweis auf die Zwiespältigkeit, Vergänglichkeit, Verfallenheit, Verlorenheit, eben Nichtigkeit der menschlichen Existenz. Hat Jean-Paul Sartre, dessen Existentialismus sich als Humanismus versteht, den Menschen nicht als »trou d’être«, als »Seinsloch« beschrieben, der sich selber frei zu entwerfen hat? Und hat Nietzsche nicht eindringlich den »Verdacht«, den Argwohn, das Misstrauen formuliert gegenüber allem, was ist und wahr und gut sein soll, und besonders gegenüber jeglicher Metaphysik?
Lebenskrisen
Jedenfalls habe ich mich selber stets als ein in vielfacher Hinsicht widersprüchliches, zwiespältiges Menschenwesen mit Stärken und Schwächen erfahren, weit entfernt von der gewünschten Vollkommenheit. Keinesfalls als Idealmenschen, sondern als Menschen mit seinen Höhen und Tiefen, mit Tag- und Nachtseiten, mit all dem, was C. G. Jung den »Schatten« der Person nennt, eben das, was der Mensch statt aufzuarbeiten nur zu gern wegschiebt, verdrängt, unterdrückt. Und möchte nicht manch einer in seinem Herzen gerne anders sein? Ein ganz klein wenig intelligenter, reicher, schöner? Oft nimmt man die Welt leichter an als sich selbst, wie man nun einmal ist oder durch andere gemacht wurde. »Das Einfache aber ist immer das Schwierigste«, las ich bei C. G. Jung: »In Wirklichkeit ist nämlich Einfachsein höchste Kunst, und so ist das Sich-selbst-Annehmen der Inbegriff des moralischen Problems und der Kern einer ganzen Weltanschauung« (»Über die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge«, 1932).
Ich bin kein Vertreter eines Lebenspessimismus, der jedem Handeln von vornherein ein Scheitern unterstellt; es gibt auch Erfolge im Leben, Fortschritte, Geschenke, Glück. Aber – selbst erfolgreiche Menschen bleiben kaum von Lebenskrisen verschont, die alles fraglich machen. Das kann einen Menschen schon in jungen Jahren treffen. Oder auch erst in der Midlife-Crisis, in einer jederzeit möglichen tödlichen Krankheit oder einem beruflichen Fiasko, oder in einer Depression bei der Pensionierung und im hohen Alter. Wenn ein Mensch alles erreicht hat, was er erreichen konnte und jedenfalls nicht noch mehr erreichen kann, was dann …?
Das in meinen Studienjahren Empfundene sah ich ein Jahrzehnt später treffend beschrieben bei einem katholischen Theologen, der in Tübingen ein gutes Jahrzehnt vor mir ebenfalls außerhalb einer theologischen Fakultät dozierte. Es war Romano Guardini unter dem Titel »Die Annahme seiner selbst«, veröffentlicht 1960, in dem Jahr, da ich nach Tübingen berufen wurde: »Die Aufgabe kann sehr schwer werden. Es gibt die Auflehnung dagegen, man selber sein zu müssen: Warum soll ich es denn? Habe ich denn verlangt, zu sein? … Es gibt das Gefühl, es lohne nicht mehr, man selbst zu sein: Was habe ich denn davon? Ich bin mir langweilig. Ich bin mir zuwider. Ich halte es mit mir selbst nicht mehr aus. … Es gibt das Gefühl, mit sich selbst betrogen, in sich eingesperrt zu sein: Nur so viel bin ich, und möchte doch mehr. Nur diese Begabung habe ich, und möchte doch größere, leuchtendere. Immer muss ich das Gleiche. Immer stoße ich an die nämlichen Grenzen. Immer begehe ich dieselben Fehler, erfahre dasselbe Versagen. … Aus alledem kann eine unendliche Monotonie kommen; ein furchtbarer Überdruss.«
Wie aber kann ich, das ist nun meine große Frage, ohne in Irrationalität zu verfallen, zu einer positiven Grundeinstellung zu dieser fraglichen ambivalenten Wirklichkeit der Welt und meiner selbst kommen?
Eine aufgeschobene Lebensentscheidung
Es gibt Menschen, die tragen einen existentiellen, ihre menschliche Existenz betreffenden Zweifel jahrelang mit sich herum, ohne ihn beheben zu können oder zu wollen. Ich gehöre auch dazu. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an Martin Walser – mit Günter Grass mein Altersgenosse und einer der sprachgewaltigsten Schriftsteller der Gegenwart. Nur ein einziges, kurzes und freundliches Gespräch habe ich mit ihm geführt, und zwar in einer Pause während einer Bayreuther Festspielaufführung. Ob es nicht fällig wäre, einmal in einem Roman das Thema Religion aufzugreifen, fragte ich ihn. In der Tat, dieses Thema trage er unbereinigt mit sich herum, war seine Antwort, aber die Zeit dafür sei noch nicht gekommen. Nun sind wir 80 Jahre alt geworden. Und Martin Walser erzählt in seinem letzten Roman vom 74-jährigen Goethe, der in heftiger Altersleidenschaft zu einer jungen Frau entbrennt und an der Grenze zur Lächerlichkeit scheitert. Eine Spiegelgeschichte für Martin Walser? Ob er Goethes »Gretchenfrage«: »Wie hältst du’s mit der Religion?« endgültig »auf Eis gelegt« hat?
Meine Grundfrage damals war nicht etwa die Religion, sondern meine Einstellung zum Leben überhaupt. Wie kann ich zu einer konstruktiven Lebenseinstellung kommen, die nun einmal des Menschen ganzes Erleben, Verhalten, Handeln umgreift, wenn die höchst fragwürdige Wirklichkeit der Welt und meiner selbst sich in ihrer Sinn- und Werthaftigkeit gerade nicht zwingend mit Evidenz aufdrängt als das, was sie ist? Wie kann ich einen festen Standpunkt gewinnen und mein Leben gelingen lassen?
Offensichtlich geht es in dieser Grund-Frage um meine freie und gerade so verantwortete Stellungnahme. Bin ich doch weder total von meiner Erbmasse oder meinem Unbewussten vorprogrammiert noch total von meiner Umwelt konditioniert. Ich bin, in Grenzen, frei. Allen überzogenen Argumenten von Hirnphysiologen zum Trotz: Ich bin weder ein Tier noch ein Roboter. In den Grenzen des Angeborenen und des Umweltbestimmten bin ich frei im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Zugegeben: ich kann diese Wahl- und Entscheidungsfreiheit nicht theoretisch beweisen. Aber ich kann sie jederzeit unmittelbar praktisch erfahren, wann immer ich will: Ich kann jetzt schweigen – nein, ich will reden – oder soll ich doch lieber schweigen? Ich könnte also auch anders. Ich mache es jetzt anders. Eine Erfahrung nicht nur des Tuns, sondern auch des Lassens. Leider nicht nur des Erreichens, sondern bisweilen auch des Versagens.
Schon in den kleinen Fragen des Alltags kann ich mich so oder anders entscheiden, aber ich kann es auch in Grundsatzfragen, ja in der Frage meiner prinzipiellen Lebenseinstellung. Zwar kann ich ihr ausweichen, sie vertagen, sie verdrängen, kann in den Tag hineinleben, kann bestimmte Konsequenzen vermeiden. Psychologisch gibt es da viele Möglichkeiten, philosophisch gesehen aber die Grundalternative einer positiven oder negativen Option. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, sich diese beiden Möglichkeiten der Lebenseinstellung genau zu überlegen, die sich in einer Lebenskrise dramatisch aufdrängen.
Möglich ist ein grundsätzliches Lebensmisstrauen: Ich kann mehr oder weniger bewusst Nein sagen zu einem Sinn meines Lebens, zur Wirklichkeit überhaupt. Die nihilistische Alternative, ob philosophisch reflektiert als Einstimmen in das Nichts jeglichen Sinnes oder pragmatisch gelebt im Sinn eines »Alles eh egal« (um trivialere Worte zu vermeiden): Sie findet immer wieder genügend Negatives, um auf die Absurdität, Zerrissenheit, Leere, Wert- und Sinnlosigkeit des Lebens zu schließen. Solche grundsätzlich misstrauischen Menschen sind durch nichts zufriedenzustellen. Sie verbreiten auch um sich eine Atmosphäre von Unzufriedenheit, Quengelei, Zynismus.
Möglich ist aber auch ein grundsätzliches Lebensvertrauen: Ich kann trotz allen Unsinns bewusst Ja sagen zum Sinn meines Lebens, kann Ja sagen zur Wirklichkeit überhaupt, trotz aller Fraglichkeit, Widrigkeit, Nichtigkeit. Ein Wagnis freilich ist dies angesichts des offensichtlichen Risikos der Enttäuschung, angesichts eines immer wieder möglichen Scheiterns. Natürlich möchte ich, dass mein Leben gelingt, möchte trotz aller Schwächen und Fehler mit mir im Reinen, zufrieden sein. Nicht ein verfehltes, sondern ein geglücktes Leben: doch was hilft mir da?
Eine wenig hilfreiche Theologie
Mich verlangte also schon als Student nach einer klaren Antwort: Warum soll ich grundsätzlich Ja zu meinem Leben sagen? Meine römischen Lehrer helfen mir bei der Problemstellung, aber die Lösung muss ich selber finden. Ich erinnere mich genau, wie ich schon meinen ersten Exerzitienmeister mit dieser Frage in Verlegenheit bringe. Er verweist mich auf – Gott. Aber: die Fragen nach meinem eigenen Standpunkt, nach dem Sinn meines Lebens, meiner Freiheit, der Wirklichkeit überhaupt scheinen mir grundlegender, vordringlicher zu sein als die Frage nach Gott, die logischerweise doch erst in zweiter Linie zu überlegen wäre.
Er pariert mit dem Totschlagargument, ein solches Insistieren sei letztlich Rebellion gegen Gott. Was soll ich sagen? Ich verabschiede mich still und unbefriedigt: Wie soll ich an Gott glauben, wenn ich noch nicht einmal mich selber annehmen kann? Ich müsse eben »glauben«, höre ich. Aber andererseits: »Glauben«, lehrt man an der Päpstlichen Universität Gregoriana, gelte nur auf der »oberen« Ebene der eigentlichen, der christlichen Offenbarungswahrheiten (Dreifaltigkeit, Menschwerdung …). Glauben habe jedoch auf der »unteren«, natürlichen Ebene der Vernunft nichts zu suchen. Da müsse allein die Ratio, das Wissen herrschen: evidente Einsichten und rationale Argumente.
In meinen letzten römischen Jahren mache ich noch eine andere Erfahrung: Auch die evangelische Theologie, wie ich sie damals durch Karl Barths monumentale Dogmatik bewundernd kennenlerne, befindet sich diesbezüglich in einer Verlegenheit. In dieser Grundfrage soll ich mich von vornherein auf Gottes Wort verlassen? Einfach die Bibel lesen? Und wie ist es mit den Milliarden Nichtchristen, welche die Bibel nicht lesen, weil sie sie nicht lesen können oder nicht lesen wollen oder weil sie überhaupt nicht lesen können?
Das fragen sich auch viele evangelische Christen ernsthaft: Können alle diese Nichtchristen in der Tat überhaupt einen festen Standpunkt in ihrem Leben finden, ein Lebensvertrauen erreichen? Ist nicht der Glaube an den christlichen Gott Voraussetzung für jegliches Ja zum Leben und für jegliches Ethos, das darauf aufbaut? Lebensfragen, an welchen sich auch die evangelische Theologie bis auf den heutigen Tag abarbeitet.
Das Schicksal der »Ungläubigen«
Während ich damals an der Päpstlichen Universität brav Traktat um Traktat jener neuscholastischen Theologie studiere, lauter Thesen, die vierzig Jahre später im Wesentlichen auch wieder in den römischen »Weltkatechismus« eingegangen sind, fasziniert mich zunehmend das Problem einer vernünftigen Begründung der menschlichen Existenz und des »Heils der Ungläubigen«. »De salute infidelium« heißt ein Seminar, das mir viel Material aus der christlichen Tradition bietet. Doch lässt es mich letztlich unbefriedigt; es zeigt bezüglich des Heils der Nichtchristen und ihrer Standpunktgewinnung keine überzeugende Lösung auf. Dabei gibt es ja auch heute noch Christen, die – als Mahnung zur Verantwortung – nach einer Hölle rufen. Eine Hölle natürlich ausschließlich für die Anderen, die »draußen«, »extra ecclesiam«, sind, die Andersgläubigen oder Ungläubigen.
Die Weltreligionen waren für mich nur der eine Aspekt des Problems der »Ungläubigen«. Ich reise schon 1955 zum ersten Mal ins muslimisch geprägte Nordafrika und wenige Jahre später zum ersten Mal rund um die Welt. Ich treffe ungezählte Menschen verschiedenster Hautfarbe, Kultur und Religion. Alle vom Heil ausgeschlossen, gar für die Hölle bestimmt? Es heißt doch: »Gott will, dass alle Menschen gerettet werden« (1 Tim 2,4). Der andere Aspekt des Problems der »Ungläubigen« ist für mich aber die wachsende Zahl von Nichtchristen mitten in Europa, auch in meiner nächsten Umgebung, an der Universität. Es erscheint mir inakzeptabel, dass die Angehörigen anderer Religionen, und erst recht Atheisten und Agnostiker gar keinen festen Standpunkt in ihrem Leben, kein Lebensvertrauen zu erreichen vermöchten. Dass der Glaube an den christlichen Gott also Voraussetzung wäre für jegliches Ja zur Wirklichkeit und für jegliches Ethos.
Von Atheismus und Agnostizismus hören wir in den römischen Vorlesungen viel, doch in reichlich abstrakter Form. Auch von den modernen Philosophen spricht man weithin losgelöst von deren bewegenden Lebensschicksalen. Als ob da ein geistiges System ein anderes und dieses wiederum ein drittes gezeugt habe! Standen denn hinter den Denkfragen der Vordenker der »säkularen Moderne« nicht Lebensfragen, ja Lebensschicksale?
Noch immer aber ist für mich die Frage nach einer bewussten vernünftigen Begründung der menschlichen Existenz ungelöst. Zu einem Schlüsselerlebnis – wiederum ein negatives freilich – wird für mich ein langes Gespräch 1953, in meinem zweiten und letzten Heimaturlaub während meiner sieben römischen Jahre. Ich absolviere damals ein mehrwöchiges pastorales Praktikum in Berlin-Moabit, in der Gemeinde St. Laurentius, und diskutiere dort unter anderem mit einem jungen Künstler, der ungefähr dieselben Schwierigkeiten mit dem Sinn des Lebens hat wie ich. Aber mit all meiner philosophischen und inzwischen auch schon zweijährigen theologischen Bildung erweise ich mich trotzdem als unfähig, meinem Gesprächspartner eine überzeugende Antwort zu geben. Auch Ausflüge in die Ästhetik nützen da wenig. Erneut die Frage: wie einen Stand gewinnen? Mein Entschluss steht am Ende fest, der Frage nicht länger auszuweichen oder sie zu verdrängen, sondern sie offensiv anzugehen.
Eine spirituelle Erfahrung
Nun gab es im Collegium Germanicum einen zu strenger Vertraulichkeit verpflichteten »geistlichen Meister«: den »Spiritual«. Ich hatte das Glück, hier auf einen außergewöhnlichen Mann zu treffen: Wilhelm Klein, einen lebenserfahrenen und weit gereisten Jesuiten mit gründlicher philosophisch-theologischer Vorbildung, ganz von Hegel geprägt; erst 1998 ist er im Alter von 106 Jahren gestorben! Die Gregoriana-Thesen über Vernunft und Offenbarung seien »so klar wie Wasser«, seien aber auch »nur Wasser«, war eines seiner typischen Bonmots. Diesen Homo spiritualis suche ich nach meiner Rückkehr aus dem Norden auf.
Natürlich erhalte ich wieder die Antwort, auf die ich gefasst bin, gegen die ich schon längst allergisch bin und die mit Argumenten zu attackieren ich mir fest vorgenommen hatte, um endlich eine Lösung des Konflikts zu erzwingen: Man müsse glauben! Glauben? Glauben?? Das ist doch keine Antwort! Ich möchte wissen!
Doch plötzlich – mitten in diesem Gespräch – durchzuckt mich eine Erkenntnis. Ich spreche ungern von einer »Erleuchtung«, wohl aber von einer spirituellen Erfahrung; jedenfalls kommt diese intuitive Erkenntnis nicht einfach von meinem Gegenüber und auch nicht durch mein eigenes begriffliches Bemühen. Vielleicht von außen, von oben?
»Glauben«? Offensichtlich geht es bei dieser Grundfrage nicht um einen Glauben im traditionell-katholischen Sinn des intellektuellen Annehmens übernatürlicher Glaubenswahrheiten, meist in Form von Dogmen. Allerdings auch nicht um einen Glauben im evangelischen Sinn des rechtfertigenden Annehmens von Gottes Gnade in Christo. Damit hatte meine persönliche Einsicht vielleicht zu tun, doch ist sie einfacher, elementarer, grundlegender. Bei der bewussten, vernünftigen Begründung der menschlichen Existenz geht es um die Frage, die sich für Christen wie Nichtchristen schon »vor« aller Lektüre der Bibel stellt: Wie kann ich einen festen Standpunkt gewinnen? Wie mein eigenes Selbst mit all seinen Schattenseiten annehmen? Wie meine eigene auch für das Böse offene Freiheit akzeptieren? Wie bei allem Unsinn einen Sinn in meinem Leben bejahen? Wie Ja sagen zur Wirklichkeit von Welt und Mensch, so wie sie nun einmal ist in ihrer Rätselhaftigkeit und Widersprüchlichkeit?
Was ging mir da plötzlich auf? Dass mir in dieser Lebensfrage ein elementares Wagnis zugemutet wird, ein Wagnis des Vertrauens! Welche Herausforderung: Wage ein Ja! Statt eines abgründigen Misstrauens im Gewand von Nihilismus oder Zynismus riskiere ein grundlegendes Vertrauen zu diesem Leben, zu dieser Wirklichkeit! Statt eines Lebensmisstrauens wage ein Lebensvertrauen: ein grundsätzliches Vertrauen zu dir selbst, zu den anderen Menschen, zur Welt, zur fraglichen Wirklichkeit überhaupt.
Bei Dag Hammarskjöld, dem damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, fand ich viele Jahre später diesen Gedanken so ausgedrückt (mit Datum Pfingsten 1961, vier Monate vor seinem Tod auf Friedensmission an der Grenze des Kongo): »Ich weiß nicht, wer oder was die Frage stellte. Ich weiß nicht, wann sie gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob ich antwortete. Aber einmal antwortete ich Ja zu jemandem – oder zu etwas. Von dieser Stunde her rührt die Gewissheit, dass das Dasein sinnvoll ist und dass darum mein Leben, in Unterwerfung, ein Ziel hat. Seit dieser Stunde habe ich gewusst, was das heißt, ›nicht hinter sich zu schauen‹, ›nicht für den anderen Tag zu sorgen‹« (»Zeichen am Weg«, 1965, S. 170).
Keine Angst vor tiefen Wassern
Diese seltsame Erfahrung erfüllte mich mit unbändiger Freude. In der Tat Ja sagen, Grundvertrauen wagen, Lebensvertrauen riskieren: So und nur so kann ich mich auf meinen weiteren Lebensweg machen, so eine bestimmte positive Grundeinstellung einnehmen, so kann ich weitermachen und den aufrechten Gang bewahren.
Das heißt: Jenes Grundvertrauen, das ich als Kind mitbekommen hatte, das ich in Pubertät und Adoleszenz durchgehalten und als Student nie aufgegeben hatte, machte ich mir nun bewusst zu eigen. Und die unbändige Freude, die ich erfuhr, war ähnlich der, die ich als Kind beim Schwimmen erlebte, als ich erstmals die Erfahrung machte, dass das Wasser meinen Körper, auch den meinen, wirklich trägt, dass ich mich auf das Wasser verlassen, dass ich mich ganz allein – ohne Beistand und Hilfsmittel – dem Wasser anvertrauen kann. Keine Theorie, kein Beobachten vom Ufer aus, kein Trockenschwimmkurs haben mir dies vermittelt. Ich musste es selber wagen, und ich habe es gewagt: ein jetzt wohlüberlegtes Lebensvertrauen eines erwachsenen, gereiften Menschen.
Dabei geht es freilich um ein durchaus kritisches Lebensvertrauen! Mir war schon damals klar: Mit Vertrauensseligkeit oder billigem Optimismus hat dieses Lebensvertrauen nicht das Geringste zu tun. Die oft so traurige Wirklichkeit der Welt und meiner selbst hatte sich ja nicht verändert. Verändert hat sich nur meine Grundeinstellung zu ihr. Sie war keineswegs zur »heilen« Welt geworden, sondern blieb nach wie vor von Widersprüchlichkeit geprägt und von Chaos und Absurdität bedroht. Und auch mein Ich hatte seine Schattenseiten keineswegs verloren. Es blieb undurchschaubar, fehlbar, schuldbedroht, sterblich. Meine Freiheit war nach wie vor zu allem fähig, und die der Mitmenschen auch.
Doch ich kann verstehen, dass viele Menschen, selbst wenn sie schwimmen können, eine fast unüberwindbare Angst vor tiefen Wassern haben: sie könnten vielleicht doch untergehen. Eltern, die ein- bis vierjährigen Kindern Schwimmunterricht geben, werden von Experten vor Sorglosigkeit gewarnt, da Kleinkinder Gefahren noch nicht einzuschätzen wissen. Ich muss gestehen, dass auch ich in jungen Jahren ein leichtes Unbehagen empfand, wenn ich, gar noch bei verhangenem Himmel, mutterseelenallein weit draußen in meinem heimischen See schwamm und mir bewusst wurde, dass dieser fast 90 Meter tief ist und mir hier niemand zu Hilfe kommen könnte. Will man beim Schwimmen in der freien Natur nicht untergehen, darf man nicht anhalten wollen, sondern muss sich bewegen, unaufhörlich, unermüdlich, um wieder ein Ufer zu erreichen. Und wenn man einmal in Nebel gerät, schauen, dass man möglichst bald wieder die Bäume des Ufers als Wegweiser erblickt.
Das Leben in der Welt ist kein wohlbehütetes Schwimmbecken, wo man jederzeit wieder Grund unter den Füßen spüren und ausruhen kann. Das Leben hat seine Abgründe und gleicht gerade in Politik und Wirtschaft oft eher einem Haifischbecken. Und wer ein stets gut abgeschirmtes und allseitig versichertes Leben anstrebt, wird früher oder später mit der Erfahrung konfrontiert, dass auch sein Leben immer ungesichert bleibt, stets Höhen und Tiefen, Chancen und Gefährdungen hat. Es gilt, auf den Höhen nicht übermütig und in den Tiefen nicht mutlos zu werden. Der Mensch tut gut daran, sich ein realistisches Bild von sich selbst zu machen und auf idealisierende und überfordernde Selbstbilder zu verzichten.
Ist es aber nicht unvernünftig, wenn ich mich ohne Beweise, wenngleich gestützt auf viele Vorbilder, auf das Wasser einlasse? Nein, ich erfahre ja die Vernünftigkeit – beim Schwimmen selbst! Auch mein Lebensvertrauen ist keineswegs irrational, keineswegs unüberprüfbar. Zwar lässt sich mein grundsätzlich positiver Standpunkt, meine im Prinzip antinihilistische, konstruktive Einstellung zum Leben und zur Wirklichkeit überhaupt nicht gleichsam von außen, »objektiv«, aufweisen. Es lässt sich nichts zunächst als evident oder vernünftig aufweisen, was dann mein Grundvertrauen begründen könnte. Einen solchen vorausgesetzten »archimedischen Punkt« des Denkens gibt es nicht. Und selbst ein so kritischer Denker wie der österreichisch-britische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper kommt nicht darum herum, an der Basis seines »kritischen Rationalismus« zumindest die Vernünftigkeit der Vernunft vorauszusetzen, wie er ausdrücklich sagt: einen »Glauben an die Vernunft« (»Revolution oder Reform?«, 1971).
Rationalistische Philosophen mögen ein solches Vertrauen in die Vernunft für irrational halten; Popper selbst spricht von einem »irrationalen Entschluss«. Doch machen sie damit die irrationale Basis ihres Rationalismus offenkundig. Ich selber würde dieses Sich-Verlassen, dieses grundlegende Vertrauen auf die Vernunft, keinesfalls als irrational bezeichnen. Denn das Vertrauen in die Vernunft lässt sich zwar nicht von vornherein beweisen, aber sehr wohl im Vollzug erfahren: im Gebrauch der Vernunft, im Sich-Öffnen gegenüber der Wirklichkeit, im Ja-Sagen. Das Grundvertrauen in die Wirklichkeit lässt sich, wie andere Grunderfahrungen etwa der Liebe oder der Hoffnung auch, gerade nicht durch eine Argumentation vorher beweisen, doch auch nicht erst im Nachhinein. Es ist weder Prämisse meiner Entscheidung noch deren Konsequenz. Vielmehr lässt sich dieses Grundvertrauen im Lebensvollzug meiner Entscheidung erfahren, ja im Akt des Vertrauens selbst als durchaus sinnvoll, als vernünftig erfahren.
Ein nihilistisches Nein aber, ein zynisches Urmisstrauen, lässt sich zwar durch keine noch so rationalen Argumente erschüttern. Doch verwickelt es sich in immer größere Widersprüche; Friedrich Nietzsches Werk, Leben und geistiges Erlöschen haben das auf bewegende Weise gezeigt. Ein grundsätzliches Ja dagegen lässt sich in der Praxis des Lebens trotz aller Schwierigkeiten und Hemmnisse konsequent durchhalten. Ich habe es erfahren: Es lässt sich trotz aller Anfechtungen und Enttäuschungen leben und durch ein ständig neues Standfassen und neues Ausschreiten bewähren. Ein Urvertrauen, das gegen alle immer wieder drohenden Anflüge von Frustration und Verzweiflung doch zur durchhaltenden Hoffnung wird. So kann man die Tugend der Perseverantia üben, des Durchhaltens, der Beharrlichkeit, der Ausdauer.
Lebensvertrauen und religiöser Glaube
Kann man das Grundvertrauen vielleicht auch schon »Glauben« nennen? Meine Antwort: Man kann, aber man sollte nicht. Philosophen wie den hochverdienten Karl Jaspers hat es gegeben, die von einem »philosophischen Glauben« sprachen, ohne aber klar zwischen Glauben und Grundvertrauen zu unterscheiden. Andere haben umgekehrt allzu rasch das Grundvertrauen als »Urvertrauen« theologisch-mystisch (so der Basler Psychiater Balthasar Staehlin), doch manchmal auch polemisch-antiaufklärerisch aufgeladen.
Um der Klarheit willen schien es mir seit meinen Studienjahren wichtig, Grundvertrauen und Glauben im Sinne eines religiösen Glaubens oder eines Gottesglaubens zu unterscheiden. Keinesfalls wollte ich Menschen theologisch anders interpretieren, als sie sich selbst verstehen, wollte nicht, wie andere Theologen, aus Nietzsche einen Gottgläubigen machen und aus Atheisten oder Agnostikern gar verborgene, »implizite« oder, wie der Theologe Karl Rahner seinerzeit sagte, »anonyme« Christen. Dass besonders Juden und Muslime diese Art theologischer »Anonymisierung« als Versuch christlicher Vereinnahmung nicht schätzen würden, war mir schon früh klar.
Dabei kann die Beziehung zwischen Grundvertrauen und Gottesglauben durchaus komplex sein. Nach meinen Erfahrungen, von Erik Erikson bestätigt, kann man drei Gruppen von Menschen unterscheiden:
Es gibt Menschen, die beziehen ihr Lebensvertrauen aus einem religiösen Glauben. Religiös motiviert, sind sie in ihrem Leben zu außerordentlichem Einsatz, aber auch zum Erdulden von Rückschlägen und zum Durchhalten in Krisen fähig: überzeugte und überzeugende Gläubige.
Es gibt aber auch Menschen, die sich als gläubig bezeichnen, jedoch kein Vertrauen zum Leben, zu den Menschen, zu sich selbst haben. Sie befinden sich in einer prekären Lage. Mit den Händen greifen sie sozusagen in die Wolken des Himmels, auf dieser Erde aber finden sie keinen richtigen Grund. Weltfremde sind sie, religiöse Schwärmer und Enthusiasten, denen die Bodenhaftung fehlt.
Es gibt schließlich Menschen, die haben ein Lebensvertrauen, ohne gleichzeitig einen religiösen Glauben zu besitzen. Lässt sich doch nicht bestreiten, dass sie, der Erde verbunden, unter Umständen das Leben genauso gut oder manchmal sogar besser als bestimmte Gläubige bestehen können. Sie schöpfen ihr Grundvertrauen aus menschlichen Beziehungen, aus produktiver Arbeit, aus wissenschaftlicher oder politischer Tätigkeit, aus einem humanen Ethos.
Daraus folgere ich: Aus ihrem Grundvertrauen heraus können auch Atheisten oder Agnostiker ein echt menschliches, also humanes und in diesem Sinn moralisches Leben führen. Mit anderen Worten: Aus Atheismus folgt nicht notwendig ein Nihilismus. An diesem Punkt muss ich Dostojewski widersprechen: Auch wenn Gott nicht existierte, ist keineswegs alles erlaubt!
Vertrauen als Basis auch von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
Mir selber wuchs die Erkenntnis zu: Das Grundvertrauen bestimmt nicht nur die erste Entwicklungsphase des Menschen, sondern bleibt ein Leben lang der Eckstein der psychisch gesunden Persönlichkeit, zu dem das Grundmisstrauen freilich den lebenslangen Kontrapunkt bildet. Denn es geht überall – um die Stichworte des Psychoanalytikers und Psychotherapeuten Horst Eberhard Richter aufzunehmen – statt um »Flüchten« und Ausweichen um »Standhalten« und Widerstehen, und dies gerade in einer hochkomplexen Gesellschaft wie der unsrigen. Das Grundvertrauen ist somit die Grundlage des Identitätsgefühls, das jedoch in stets neuer Weise durch alle sozial-psychologischen Konflikte durchgehalten werden muss. Grundvertrauen bleibt so eine lebenslange Aufgabe, muss einem immer wieder geschenkt sein.
Das Grundvertrauen ist indessen nicht nur für das individuelle, sondern auch für das kollektive Leben von Bedeutung. Vor dreißig Jahren schrieb ich in »Existiert Gott?« ein langes Kapitel über das »Grundvertrauen«, ohne bei der Zunft der Theologen und Philosophen viel Interesse zu finden: schon damals auch über Grundvertrauen als Basis der Ethik und der Wissenschaft. Später wurde mir immer deutlicher, wie Vertrauen eine unabsehbare Bedeutung hat für das ganze Leben der Gesellschaft, sogar für Weltpolitik und Weltwirtschaft.
Es brauchte aber die Weltwirtschaftskrise des Jahres 2008/09, damit die Menschen hautnah spürten, was ein Mangel an Vertrauen bedeuten kann. So können sie das Grundvertrauen jetzt auch in seiner gesellschaftlichen Dimension ermessen. Kern der Krise ist das selbstverschuldete Misstrauen zwischen den Großbanken mit all den fatalen Auswirkungen für Unternehmen überall auf der Welt, für Hauseigentümer und zahllose Privatkunden. Mehr denn je erkennt man die fundamentale Bedeutung des Vertrauens gerade auch für wirtschaftliches Handeln weltweit, ja, infolge der Wirtschaftskrise redet man plötzlich sogar von Vertrauen als der wichtigsten Währung funktionstüchtiger Finanzmärkte, vom enttäuschten und doch so nötigen »System-Vertrauen«.
Ich übertreibe deshalb in keiner Weise, wenn ich Vertrauen als Basis menschlichen Zusammenlebens bezeichne. In Unternehmen wird heute mehr Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, zwischen Kollegen und Partnern angemahnt. Kontrolle kann eben keineswegs Vertrauen ersetzen, und fachliche Kompetenz nicht charakterliche Stärken, Effizienz nicht den Charakter. Gefragt sind Führungskräfte, die Vertrauen schaffen; nur sie können in schweren Zeiten Leistungsträger binden und motivieren, das Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen stärken und Orientierung für Gegenwart und Zukunft vermitteln. Angesichts eines sich vergrößernden Vertrauensdefizits müssen nicht zuletzt im Finanzbereich auch Berater, Vertreter, Verkäufer, Analysten sich um verloren gegangenes Vertrauen neu bemühen und dabei wieder neu Wahrhaftigkeit, Mut und Mäßigung pflegen. Dabei schließt ein vernünftiges Vertrauen gerade im Finanzwesen eine gewisse Skepsis ein und verlangt eine rationale Risikoeinschätzung. Vertrauen ersetzt also nie die eigene Urteilskraft und kann auch nicht die staatliche wie überstaatliche Regulierung der Finanzmärkte überflüssig machen.
Bei alldem ist es ungeheuer wichtig, sich immer bewusst zu bleiben: Weder eine staatliche noch eine kirchliche Instanz, weder ein Staatsmann noch ein Papst besitzen ein Recht auf unbedingtes und folglich unkritisches Vertrauen. Ich kann dies zum Ende illustrieren mit einer kleinen Geschichte: »Sie müssen Vertrauen zu mir haben«, sagte mir jungem Konzilstheologen am 2. Dezember 1965, am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, in einer Privataudienz Papst Paul VI. »Deve avere fiducia in me«. Kann man da Nein sagen? Ich antwortete: »Ich habe Vertrauen zu Ihnen, Santità, ma non in tutti quelli che sono intorno a Lei – aber nicht zu allen, die um Sie herum sind.« Eine im kurialen Milieu unübliche Direktheit, die den Papst leicht zusammenzucken ließ. Hätte er im Geist des Konzils um meinen Dienst für eine ernsthafte Kurienreform gebeten, hätte ich ihm bestimmt das Vertrauen nicht verweigert. Aber das aus dem Mittelalter stammende absolutistische römische System, das er in Übereinstimmung mit dem harten Kern der Kurie offensichtlich nicht aufgeben wollte, verdiente und verdient solches Vertrauen nicht.
Und jetzt, fast fünf Jahrzehnte später, kann ich im Rückblick erkennen, was für jede Spiritualität heute von Bedeutung ist: Bei allem Lebensvertrauen ist auch Lebensklugheit, eine der vier Kardinaltugenden, erfordert: angewandte Urteilskraft, eine Balance zwischen Vertrauen und berechtigten Vorbehalten, im Einzelfall auch durchaus Skepsis und Misstrauen. In einer bestimmten Situation das Vertrauen verweigern, kann für einen Lebensweg entscheidend sein. Andererseits soll ich doch immer wieder im Vertrauen den Menschen, den Dingen eine Chance geben, in der Hoffnung, dass mir die Kraft gegeben wird, Rückschläge zu ertragen und den Kopf hochzuhalten. Es wird sich lohnen, über Lebensweg, Lebenssinn und Lebensmodell noch weiter nachzudenken. Doch zunächst soll von der Lebensfreude die Rede sein.
2. Lebensfreude
»… – ich lege mich nie zu Bette ohne zu bedenken, daß ich vielleicht, so jung als ich bin, den andern Tag nicht mehr sein werde – und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen.«
WOLFGANG AMADEUS MOZART am 4. April 1787 (vier Jahre vor seinem Tod) an seinen Vater.
Lebensvertrauen ist gut, Lebensfreude ist besser. So könnte man sagen, wenn man an wahre Freude denkt und nicht an »Schadenfreude«, die nach dem Sprichwort angeblich die schönste Freude sei. »Schadenfreude« ist als Lehnwort sogar ins Englische eingegangen, weil der Ausdruck »malicious pleasure« nicht notwendig Schaden einschließt.
Nun hat sich im Jahr 2009 manch einer gefragt, was in die nüchternen Londoner gefahren ist: Über 800 Autobusse propagieren mit einer Aufschrift: »There’s probably no God – Es gibt wahrscheinlich keinen Gott.« Man versteht indes die Aktion sofort, wenn man weiß: Es handelt sich hier um eine Reaktion auf die vorher auf denselben Bussen verbreitete Warnung von fundamentalistischen Gläubigen, die allen Nichtglaubenden ewige Verdammnis im Höllenfeuer androhte. Auf diese Weise sollte Nichtglaubenden – wohl nicht ohne Schadenfreude – mit der Androhung eines unerfreulichen Endes die Lebensfreude gründlich verdorben werden. Deshalb haben die bekennenden Atheisten ihrer Gottesleugnung den lebensfrohen Satz hinzugefügt: »Now stop worrying and enjoy your life – Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und genießen Sie Ihr Leben.«
Die atheistische Aktion, auch auf andere Länder ausgeweitet, wird finanziell unterstützt vom Protagonisten eines »neuen Atheismus«, dem britischen Neurophysiologen Richard Dawkins. Dieser hat nach ernsthaften Arbeiten auf seinem Fachgebiet ein Buch unter dem Titel »Der Gotteswahn« (»The God Delusion«, 2006) veröffentlicht. Mit dieser leichtfertig-einseitigen, süffisant unaufgeklärten Religionskritik wäre er sicher unter das Verdikt jenes Philosophen gefallen, der als Erster am Ende des 19. Jahrhunderts den »Tod Gottes« feierlich verkündigt hat, Friedrich Nietzsches. Dieser hat gespottet über »unsere Herren Naturforscher und Physiologen«, denen »die Leidenschaft in diesen Dingen fehlt, das Leiden an ihnen« (»Der Antichrist«, Nr. 8). Sie könnten nicht ermessen, was es bedeutet, Gott verloren zu haben. Sie stimmen beim Ruf des »tollen Menschen ›Ich suche Gott! Ich suche Gott!‹ ein großes Gelächter an«.
»Fröhliche Wissenschaft«
Nietzsches Parabel vom »tollen Menschen« findet sich in seinem Buch »Die Fröhliche Wissenschaft« (III, Nr. 125). »Fröhliche Wissenschaft« meint jene provenzalische »gaya scienza« des Sängers, Ritters, Freigeistes, mit der über die Moral hinweggetanzt wird (mit »Liedern des Prinzen Vogelfrei«). Für Nietzsche der entscheidende Schritt zu einer inneren und äußeren »Genesung«, zu neuer Lebensfreude, Lebensfreude ohne Gott!
Ende der Leseprobe