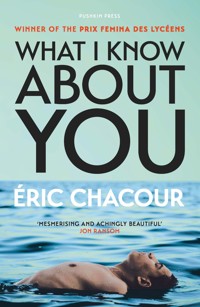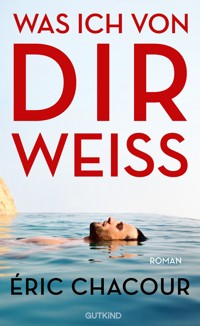
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gutkind Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Call me by your name« meets »Der Alchemist« Im flirrenden Kairo der 1980er-Jahre scheint der Weg eines jungen Arztes vorgezeichnet. Unter den strengen Blicken der Familie führt Tarek die prestigeträchtige Praxis seines verstorbenen Vaters weiter. Als er eine Ambulanz in einem Armenviertel eröffnet, fühlt es sich wie ein Befreiungsschlag an. Dort begegnet er Ali, einem jungen Mann aus dem Quartier. Ihre Freundschaft ist so überraschend wie kompromisslos. Wie kann jemand, der so wenig besitzt, ihm, der alles zu haben scheint, so viel geben? Ein Wind der Freiheit wird Tareks Gewissheiten aufwühlen und sein Leben umwerfen. In seinem vielfach ausgezeichneten Roman erzählt Éric Chacour berührend und tiefgründig von einer zerrissenen Gesellschaft, den Geheimnissen einer Familie und einem Mann auf der Suche nach seiner Wahrheit. Schon jetzt ein moderner Klassiker. »Ein aufregendes, meisterhaftes Debüt.« L'Express »Umwerfend und tiefgründig - eine Geschichte voller Anmut und durchdrungen von Licht.« France Info »Dieser umwerfende Roman begeistert Buchhändler wie Schüler gleichermaßen.« V 5 Monde »Ein Roman über Liebe und Verlust, der dich verschlingt und beeindruckt.« Daily Mail »Eine herausragende Entdeckung, meisterhaft erzählt, jetzt schon ein moderner Klassiker.« Le Figrao
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»Eine herausragende Entdeckung, meisterhaft erzählt, schon jetzt ein moderner Klassiker..«
LE FIGARO
»Eine Ode an die Macht der Liebe.«
CBC
»Ein aufregendes,meisterhaftes Debüt.«
L‘EXPRESS
»Umwerfend und tiefgründig – eine Geschichte voller Anmut und durchdrungen von Licht.«
FRANCE INFO
»Dieser umwerfende Roman begeistert Buchhändler wie Schüler gleichermaßen.«
TV 5 MONDE
»Ein Roman über Liebe und Verlust, der dich verschlingt und beeindruckt.«
DAILY MAIL
Buch
Im flirrenden Kairo der 1980er-Jahre scheint der Weg eines jungen Arztes vorgezeichnet. Unter den strengen Blicken der Familie führt Tarek die prestigeträchtige Praxis seines verstorbenen Vaters weiter. Als er eine Ambulanz in einem Armenviertel eröffnet, begegnet er Ali, einem jungen Mann aus dem Quartier. Ihre Freundschaft ist so überraschend wie kompromisslos. Wie kann jemand, der so wenig besitzt, ihm, der alles zu haben scheint, so viel geben? Ein Wind der Freiheit wird Tareks Gewissheiten aufwühlen und sein Leben für immer verändern.
In seinem vielfach ausgezeichneten Roman erzählt Éric Chacour berührend und tiefgründig von einer zerrissenen Gesellschaft, den Geheimnissen einer Familie und einem Mann auf der Suche nach seiner Wahrheit.
Autor
Éric Chacour, geboren in Montréal in Kanada als Sohn ägyptischer Einwanderer, studierte Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen. Er arbeitet im Finanzwesen. Zehn Jahre schrieb Chacour an seinem Debüt, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde.
Die Originalausgabe ist erstmals 2023 unter dem Titel Ce que je sais de toi bei Alto, Montreal erschienen.
The translation of this work was made possible thanks to the financial support of the Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC). Diese Übersetzung wurde durch die finanzielle Unterstützung der Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) ermöglicht.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung dieser Arbeit.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
www.gutkind-verlag.de
ISBN 978-3-98941-011-4
Copyright der deutschen Erstausgabe: © 2025 Gutkind Verlag GmbH, Berlin
Copyright der Originalausgabe: © 2023 Éric Chacour and Éditions Alto, 2023
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlag: Lübbecke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Masterfile / Masterfile, Man Floating in Infinity Pool
Autorenfoto: © Justine Latour
E-Book: Sandra Hacke, Dachau
Bei Fragen und Anmerkungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch / Über den Autor
Impressum
Titel
Widmung
Du
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ich
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Wir
48
49
50
Dank
Navigationspunkte
Cover
Inhalt
Textbeginn
Éric Chacour
Was ich von dir weiss
Roman
Aus dem Französischen (Quebec) von Sina de Malafosse
Den Menschen, die meine Liebe zu Ägypten geweckt haben.
Den Frauen.
Du
1
Kairo, 1961
»Welches Auto willst du mal fahren?«
Er hatte eine einfache Frage gestellt, aber du wusstest noch nicht, dass man sich vor einfachen Fragen in Acht nehmen muss. Du warst zwölf, deine Schwester zehn Jahre alt. Ihr gingt mit eurem Vater am Ufer des Nils spazieren, im Wohnviertel von Zamalek. Getragen vom Lärm der chaotischen Verkehrsströme, blieb dein Blick an dem Turm in Form einer Lotosblume hängen, der kurz zuvor aus der Erde geschossen war. Der höchste Afrikas, sagten sie stolz. Und von einem Melkiten erbaut!
Deine Schwester Nesrine wartete deine Antwort nicht ab und rief:
»Das da, Baba! Das große rote dort!«
»Und du, Tarek?«
Darüber hattest du noch nie nachgedacht.
»Vielleicht … ein Esel?«
Du hieltest eine Begründung für angebracht: Das sei leiser.
Dein Vater zwang sich zu einem Lächeln, das nahelegte, dass deine Antwort nicht akzeptabel war. Wenn es ihm nicht dazu diente, sich einzureden, dass du einen Scherz gemacht hattest. Nesrine löste eine Strähne aus ihren schwarzen Haaren und wickelte sie sich um den Zeigefinger; wickeln – was sie immer tat, wenn sie etwas sagen wollte. Offenbar überzeugt, dass der Nachmittag mit ein wenig Nachdruck für sie am Steuer eines Cabrios enden würde, setzte sie mit unverhohlener Begeisterung nach:
»Ich will das rote, Baba! Mit dem Dach, das aufgeht!«
Der Blick deines Vaters gab dir zu verstehen, dass er immer noch auf deine Antwort wartete. Ihm zuliebe wähltest du willkürlich eins aus:
»Ich hätte gern das schwarze Auto dort hinten. Das an der Ecke steht.«
Dein Vater räusperte sich, er konnte mit seiner Argumentation fortfahren:
»Du hast recht, das ist ein schöner amerikanischer Wagen. Ein Cadillac. Weißt du, dass er sehr teuer ist? Du brauchst eine gute Arbeit, um ihn dir leisten zu können. Ingenieur oder Arzt. Welcher Beruf ist dir lieber?«
Er sprach mit dir, ohne dich anzusehen, seine Aufmerksamkeit auf die noch leere Pfeife gerichtet, die er sich gerade zwischen die Lippen geklemmt hatte. Indem er mit einem leisen Zischen an ihr zog, begann er sein geheimnisvolles und gewohntes Ritual. Mit der Luftzirkulation zufrieden, nahm er einen Beutel Tabak aus der Tasche, wobei du nicht hättest sagen können, ob der allzu vertraute Geruch dir gefiel oder nicht. Er stopfte den Pfeifenkopf, klopfte mit seinem rechten Mittelfinger auf die getrockneten Blätter, damit sie ihren Platz fanden, und drückte dann alles sorgfältig hinein. Jeder Schritt dieses akribischen Vorgangs schien dazu da, dir einen angemessenen Aufschub zum Nachdenken zu verschaffen. Als er die Pfeife wieder in den Mund nahm, um den Zug zu prüfen, verstandest du, dass dir für deine Antwort nur noch wenig Zeit blieb. Das Klicken des Feuerzeugs klang wie eine Zeitschaltuhr kurz vor dem Alarm. Im Rauch der ersten Züge wagtest du zaghaft:
»Eher Arzt …«
Er blieb kurz stehen, als wolle er ein Angebot überdenken, das du ihm unterbreitet hattest, und sagte dann ernst:
»In Ordnung, mein Sohn, das ist eine gute Wahl.«
Eine Wahl, die keine war: Du wusstest nicht, was ein Ingenieur tut. Doch für deinen Vater war das unwichtig, sein Sohn würde Arzt werden wie er selbst. Er musste keine weiteren Argumente äußern. Die Finger, die dir eines Tages deinen zukünftigen Beruf beibringen würden, drückten mit einem Pfeifenklopfer die erste Asche eurer Unterhaltung nieder. Während dein Vater mit der Feuerzeugflamme seine Pfeife neu entzündete, stelltest du dir dich in seinem weißen Kittel vor, den er im Erdgeschoss eurer Villa in Dokki trug, wo er seine Praxis eingerichtet hatte. Du warst in einem Alter, in dem deine Pläne für dich geschmiedet wurden – aber war das wirklich eine Frage des Alters?
Schweigend setztet ihr euren Spaziergang fort. Jeder schien in seinen Gedanken versunken. Als der Tabak geraucht war, schaute dein Vater auf seine Taschenuhr, deren Rückseite seine Initialen trug. Und nebenbei auch deine. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Sie zeigte diese Zeit systematisch an, sobald nichts mehr zu rauchen übrig war. Pfeife und Taschenuhr waren unfehlbar synchron.
Am Abend verkündetest du deiner Mutter, dass du einmal Arzt sein würdest. Ohne Regung, wie man eine belanglose Information mitteilt. Sie empfing die Neuigkeit mit einer solchen Begeisterung, als hättest du ihr eben dein Staatsdiplom mit Auszeichnung präsentiert. Nasser baute das Land zum größten der Erde auf, und deine Mutter hatte entschieden, dass du in diesem der renommierteste Arzt sein würdest. Kurz zuvor hatte Nesrine dir das Versprechen abgenommen, ihr ein rotes Cabrio zu kaufen.
Du warst zwölf Jahre alt. Von nun an solltest du dich vor einfachen Fragen in Acht nehmen.
2
Du wusstest nicht, wann das Leben beginnen würde. Als Kind warst du ein glänzender Schüler. Du brachtest gute Noten mit nach Hause, und es hieß, dass dies nützlich sei für später. Das Leben würde also später beginnen. Zu dieser Zeit reihten sich nur Augenblicke aneinander, von denen du praktisch nichts in Erinnerung behalten hast. Man merkt sich die Namen derjenigen, die einen mühsam auf ihren Schultern getragen haben, genauso wenig, wie man die Stunden zählt, die von anderen auf die Zubereitung der Lieblingsspeise verwendet wurden. Unbedeutendes jedoch bewahrt man sich: Du hast mit Nesrine darüber gelacht, dass es ihr nicht gelang, »Pyramide« auf Arabisch richtig auszusprechen, ihr habt frescas am Strand gegessen und die Melasse hat Flecken auf eurer Badebekleidung hinterlassen, du hast mit dem Finger auf beschlagene Fensterscheiben gemalt, wenn Fatheya, eure Haushälterin, kochte …
Du beobachtetest die Erwachsenen, ihre Gestik, ihre Sprechweise, ihr Erscheinungsbild. Es kam vor, dass einer von ihnen, wie von einer natürlichen Autorität dazu bestimmt, das Wort ergriff, um einen Witz zu erzählen, den er zuletzt gehört hatte. Alle Augen richteten sich auf ihn, und die plötzliche Aufmerksamkeit verwandelte ihn. Seine Stimme veränderte sich, seine Bewegungen passten sich seiner Erzählung an, und du spürtest die Spannung, die im Raum entstand. Du stauntest über die Wirkung auf die Zuhörer, eine Gruppe, die auf einmal im gleichen Rhythmus atmete, der Betonung des Sprechers folgend. Dieser konnte nun die Frequenz seiner Worte erhöhen und die Pointe verraten, auf die alle warteten. Sie empfingen sie mit einem lauten, befreienden Lachen, ein nicht abgesprochenes und doch vollkommen einstimmiges Lachen.
Die Männer waren es, die lachten. Warum lachten sie? Du hattest keine Ahnung. Die unverständlichen Anspielungen, die offensichtlichen Übertreibungen, Worte, die du noch nicht kanntest, verschwörerische Blicke, die missbilligenden Mienen der Mütter, die an die Anwesenheit der Kinder erinnerten, die ungenierten Gesten der Männer, die ihnen zu antworten schienen, dass diese ohnehin nicht alt genug seien, um zu verstehen. Ohnehin warst du nicht alt genug, um zu verstehen. Diese Sprache schien in die Welt der Erwachsenen zu gehören, ein ferner Kontinent, den du noch zu entdecken hattest. Du wusstest nicht, ob man dort eines Tages unbemerkt strandet, weil man die Kindheit zu weit hat abtreiben lassen, oder ob es sich um Gebiete handelt, die leidvoll erobert werden. War es möglich, dass sie dir für immer fremd bleiben würden? Würdest du eines Tages lachen wie sie?
Ihre Gegenwart wirkte auf Nesrine elektrisierend. Sie unterbrach ihre Diskussionen, um sich nach der Bedeutung eines Wortes zu erkundigen oder auf eine ihrer rhetorischen Fragen zu antworten. Sie erfasste den Sinn ihrer Witze nicht mehr als du, aber stimmte mit ihrem Kinderlachen in die Runde ein. Allein wegen der Vorstellung, mit den anderen zu lachen. Das genügte ihr. War sie nicht entzückend?
Das Leben würde später beginnen. Was bislang geschah, war nicht das Leben. Das war Warten, vielleicht ein Aufschub, die Kindheit, eine lange Vorbereitungszeit. Worauf bereitetest du dich vor? Oder genauer, worauf bereitete man dich vor? Du zogst die Gesellschaft der Erwachsenen der von Gleichaltrigen vor. Du warst fasziniert von denen, die nie zauderten. Die mit derselben Unverfrorenheit einen Präsidenten, ein Gesetz oder eine Fußballmannschaft kritisieren konnten. Diejenigen, bei denen jede Geste zu sagen schien, dass sie die ganze und absolute Wahrheit kennen. Die mit einem Fingerschnippen alle Probleme um Palästina, die Muslimbrüder, den Assuanstaudamm oder die Verstaatlichungen regeln würden. Du glaubtest schließlich, Erwachsensein bedeute, dass jeder Zweifel von einem abfällt.
Irgendwann sollte dir jedoch aufgehen, dass es offensichtlich sehr wenige echte Erwachsene gibt. Dass niemand seine Urängste vollständig abschüttelt, seine jugendlichen Komplexe, das ungestillte Bedürfnis, die ersten Demütigungen zu rächen. Man mag sich immer noch über eine kindische Reaktion bei einem Mitmenschen wundern, aber da liegt ein großer Irrtum vor: Es gibt keine Erwachsenen, die sich kindisch verhalten, es gibt nur Kinder, die ein Alter erreicht haben, in dem Zweifel Grund sind, sich zu schämen. Kinder, die sich am Ende an die Erwartungen anpassen, die an sie gestellt werden. Die aufgeben, zu hinterfragen. Die Behauptungen aufstellen, ohne zu zittern. Die Andersartigkeit verachten. Kinder mit tiefen Stimmen, weißen Haaren und Hang zu Alkohol. Erst viele Jahre später solltest du begreifen, dass man vor ihnen fliehen muss, um jeden Preis. Aber damals schautest du ihnen gebannt zu.
3
Kairo, 1974
Väter sind zum Verschwinden gemacht. Deiner starb nachts. In seinem Bett, wie Nasser, als jeder sich an den Gedanken gewöhnt hatte, dass er unsterblich war. Deine Mutter bemerkte es am Morgen nicht. Es war ungewöhnlich, dass sie vor ihm wach wurde. Sie glaubte, dass er neben ihr schlief, und wagte nicht, ihn zu stören. Er bot dem Tod die gleiche rigoros ausdruckslose Miene, mit der er sich dem Leben gestellt hatte, und nichts wies darauf hin, dass er letzteres für ersteren verlassen hatte. Sie schaute reflexartig auf ihre Uhr. Es war nach sechs. Sie wunderte sich, dass er nicht wie gewohnt um 5.20 Uhr aufgestanden war. Zuerst fürchtete sie, dass er ihr vorwerfen würde, ihn aufgeweckt zu haben. Vielleicht benötigte er einfach ein bisschen mehr Schlaf. Wer war sie schon, zu glauben, besser als ein Arzt zu wissen, was gut für ihn war? Sie wartete eine Weile. Als er immer noch nicht aufstand, sorgte sie sich, dass er sie im Gegenteil anklagen würde, ihn zu lange schlafen gelassen zu haben. Sie machte sich leise bemerkbar, was keinerlei Wirkung zeigte. Nunmehr sicher, dass er ihr etwas vorwerfen würde, was auch immer sie täte, beschloss sie, ihn wachzurütteln. Entgegen aller Erwartung blieben die Vorwürfe aus.
Du erfuhrst nicht sofort davon. Du hattest dich auf den Weg nach Mokattam gemacht. Auf deine Initiative hin wurde auf diesem Hügel am östlichen Rand von Kairo ein Gesundheitszentrum gebaut, und du hattest dir freigenommen, um den Fortschritt der Bauarbeiten zu überwachen. Kaum warst du aus deinem Auto gestiegen, als ein Junge auf dich zustürzte.
»Doktor Tarek! Doktor Tarek! Ihr Vater, Doktor Thomas, ist gestorben. Sie müssen sofort nach Hause!«
Du hättest an einen schlechten Scherz geglaubt, wenn er nicht deinen Namen und den deines Vaters genannt hätte. Du versuchtest, ihn auszufragen, aber er gab dir mit einem Schulterzucken zu verstehen, dass er nicht mehr wisse als das, was man ihn hatte übermitteln lassen. Bevor du dich auf den Weg machtest, gabst du ihm zum Dank ein paar Piaster. Beim Anblick der Münzen siegte ein breites Lächeln über die Ernsthaftigkeit, die er sich beim Überbringen der Nachricht auferlegt hatte. Du fuhrst zurück, eher schockiert als traurig, ohne das, was dir eben verkündet worden war, ganz zu begreifen. Du hattest es eilig, zu den Deinen zu kommen.
Du gingst durch die Praxis, in der dein Vater nicht mehr tätig sein würde, ins Haus, versuchtest nicht zu verstehen, was diese neue Realität mit sich brachte, und eiltest mehrere Stufen überspringend die Treppe zu deiner Mutter hinauf. Du fandest sie ihm Wohnzimmer, wo sie neben deiner Tante Lola saß. Die eine schien ihre neue Rolle als Witwe vor der anderen zu üben, die sichtlich aufgeregt war bei dem Gedanken, in vorderster Reihe an dieser Thronbesteigung teilzuhaben, sie versäumte es nicht, ihre Dankbarkeit durch ein paar demonstrative Schluchzer kundzutun. Du hattest beinahe das Gefühl, sie zu stören. Als deine Mutter dein Zögern auf der Schwelle bemerkte, winkte sie dich herein. Ihre Armreifen schlugen mit einem ungeduldigen Klirren aneinander. Als du vor ihr standst, erhob sie sich, nahm dich in die Arme und antwortete mit einem floskelhaften »Er hat nicht gelitten« auf die Frage, die du nicht gestellt hattest. Ihre Gesichtszüge und Haare waren auf respektable Weise gestrafft. Da sie einen guten Kopf kleiner war als du, krümmtest du dich, um sie in einer für dich unbequemen Haltung zu umarmen. Du verharrtest einen Augenblick lang in dieser Position, ohne recht zu wissen, wer von euch wen tröstete, dann löste sie sich und gebot dir, zu deiner Schwester zu gehen.
Als Nesrine dich in die Küche kommen sah, begann sie hemmungslos zu weinen, zum größten Leidwesen der Haushälterin. Fatheya versuchte seit Stunden, sie mit warmen Getränken, kräftigem Tätscheln und Bitten um göttlichen Beistand vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Dein Erscheinen kam einem Windstoß gleich, der auf ein mühevoll errichtetes Kartenhaus traf. Sie warf dir einen bösen Blick zu, der aber sogleich sanfter wurde, als hätte sie einen Moment gebraucht, um zu begreifen, dass die Trauer auch deine war. Sie kam zu dir, sah dich an und sagte »Mein Schatz«. Sie, die dich auf tausend verschiedene Arten »Mein Schatz« zu nennen pflegte, hatte die gewählt, die auch »Sei stark« bedeutet. Sie gab dir mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass sie viel zu tun habe, und ließ euch allein.
Mit ihrem von der Trauer gezeichneten Gesicht erschien dir deine Schwester jünger als ihre dreiundzwanzig Jahre. Sie erinnerte dich an die Jugendliche, die du nach Zamalek mitnahmst, um gesüßten Fetir zu essen und dir ihre Probleme anzuhören. Darunter war keines, das sich nicht in Honig auflösen ließe. Vielleicht würde genau das ihr in diesem Augenblick am meisten Trost spenden. Du würdest ihr nicht sagen, wo du mit ihr hinfährst, sie würde auch nicht versuchen, es zu erraten, da es vor allem darum ginge, diesem Haus mit seinen kummergetränkten Wänden zu entkommen. Sie würde lächeln, sobald sie das Café wiedererkennen würde, und eure Gedanken wären im Einklang. Es würde keiner Worte bedürfen, sie würde nur zusehen, wie der Bäcker mit wirbelnden Händen über dem Marmortresen seinen Teig lang zöge, wobei seine fachkundigen Gesten von den Spiegeln hinter ihm vervielfacht würden. Es wäre nur eine kurze Eskapade inmitten eurer Trauer.
Du schlugst dir die Idee rasch aus dem Kopf. Du konntest dir nicht vorstellen, deiner Mutter zu verkünden, dass ihr unter den gegebenen Umständen einen Ausflug in die Stadt machen würdet. Man ist immer nur das, was die Gesellschaft von einem erwartet, und in genau diesem Augenblick erwartete die Gesellschaft von euch Gesichter, die Respekt und Mitgefühl hervorriefen. Sicher nicht Gebäckkrümel, die man sich wie ein gieriges Kind geschwind aus den Mundwinkeln leckt.
Mit der ganzen Last deiner fünfundzwanzig Jahre ließest du dich auf den Stuhl neben deine Schwester fallen. Er strahlte noch Fatheyas Wärme aus.
»Geht es dir gut?«
Als Antwort zeigte sie dir die Kajalspuren auf ihren Wangen. Wie konnte es ihr gut gehen? Sie lächelte. Das war alles, was zählte.
Du würdest die Stille vor dem angekündigten Sturm genießen. Es sollte nicht lange dauern, bis die Nachricht über den Todesfall scharenweise Menschen herbeiwehen würde wie der Chamsin den Wüstensand. Du hattest die levantinische Gemeinschaft von Kairo nicht in ihrer Blütezeit erlebt, aber sie blieb eine Stadt in der Stadt. Da du wusstest, dass sie in freudigen wie tragischen Momenten zusammenhielt, nahmst du an, dass der Tod eines ihrer verehrten Ärzte gewisse Emotionen hervorrufen würde. Diese levantinischen Ägypter, die Shawams, stellten tatsächlich den wesentlichen Teil der Klientel deines Vaters und eures sozialen Umfelds dar. Sie waren Christen verschiedener östlicher Traditionen und stammten aus dem Libanon, Syrien, Jordanien oder Palästina. Auch wenn sie schon seit Generationen am Ufer des Nils lebten, sprachen manche von ihnen besser Französisch als Arabisch, letzteres nur, wenn es notwendig war. Sie wurden im Übrigen als Fremde betrachtet, im besten Fall als »Ägyptisierte«, wogegen sie sich nicht wirklich zu verteidigen suchten.
Du wuchst in dieser bürgerlichen und verwestlichten Welt auf, einer Art Blase, die immer stärker aus der Zeit fiel. Sie war das Erbe eines kosmopolitischen Ägyptens, das einer Zukunft entgegensah, in der verschiedene Bevölkerungsgruppen ferner Abstammung zusammenlebten. Die Levantiner erkannten sich in der europäischen Bildung der Griechen, Italiener oder Franzosen wieder. Wie den Armeniern war ihnen der Eisengeschmack des Blutes, das dem Exil vorausgeht, vertraut. Diese Dinge bringen einander näher.
Die Familie deines Vaters gehörte zu denen, die 1860 vor den Massakern aus Damaskus geflohen waren. Daran erinnerten nur sein Vorname, eine Hommage an das christliche Viertel am Thomastor, in dem seine Vorfahren gelebt hatten, und ein paar Schmuckstücke, gerettet aus dem Geschäft, das sie dort geführt hatten, darunter die Taschenuhr, die er immer bei sich trug. Sicher in der Hoffnung, dass ihr sie eines Tages an eure Kinder weitertragen würdet, erzählte er deiner Schwester und dir Geschichten aus einer anderen Zeit. Sie berichteten von denen, die vor euch gelebt hatten, in mehreren Wellen gekommen waren und beigetragen hatten zur intellektuellen Wiedergeburt des Landes, das sie aufnahm, aber auch von der britischen Herrschaft, mit der sie sich gut arrangierten, und den prestigeträchtigen Posten, die sie in der Verwaltung, im Handel, in der Industrie und Kultur besetzten. Aus seinen Worten war Stolz herauszuhören, gemischt mit Dankbarkeit gegenüber diesem Volk, das sie mit offenen Armen empfangen hatte.
Es fiel ihm jedoch immer schwerer, die melancholischen Zwischentöne zu unterdrücken. Er wusste genau, dass seitdem viel Wasser den Nil heruntergeflossen und ein anderes Ägypten erwacht war. Ein Ägypten, das die Rückeroberung seiner arabischen und muslimischen Identität anstrebte, angeheizt durch Nassers Patriotismus und seine Träume von wiedergefundener Größe. Ein Ägypten, das entschlossen war, sich seine Elite nicht nehmen zu lassen. Suez, die Verstaatlichungen, die Beschlagnahmungen und der Weggang vieler hatten die Shawams, die sich als Bindeglied zwischen Orient und Okzident sahen, heftig aufgerüttelt.
Du konntest dich an die Zeit erinnern, als nicht ein Tag verging, ohne dass ein Freund euch seinen Weggang nach Frankreich, in den Libanon, in die Vereinigten Staaten, nach Australien oder Kanada verkündete. Ohne weitere Gewalterfahrung – abgesehen von der inneren Zerrissenheit – beugten sie sich und verließen das Land, das sie innig geliebt und in dem sie sich eines Tages hatten bestattet lassen wollen. Ihr gehörtet zu den paar Tausenden, die geblieben waren, es ablehnten, ein Land zu verlassen, das sich von ihnen abwandte. Zu denen, die versuchten, die Illusion eines angenehmen Lebens im familiären Umfeld ihrer Häuser zu erhalten, ihrer Kirchen, der französischen Schulen, auf die sie ihre Kinder schickten, und des griechisch-katholischen Friedhofs von Alt-Kairo, auf dem auch dein Vater bald ruhen würde.
Man trat sich am nächsten Tag in eurem Haus in Dokki auf die Füße. Eine Cousine von Fatheya war gekommen, um bei der Organisation dieses langen Kondolenzzuges auszuhelfen, dessen Beileidsbekundungen deine Mutter mit würdevoller Strenge entgegennahm. Im Minutentakt empfing sie diejenigen, die eine ungleiche Allianz von Anstandsregeln und einem voyeuristischen Instinkt an eure Tür führte. Sie kamen mit ihren üblichen Floskeln und ein paar Erinnerungen an deinen Vater, die zu dem Anlass sorgfältig entstaubt worden waren, und bewerteten insgeheim den Grad eurer Niedergeschlagenheit. Sie betrachteten die dunklen Ringe unter euren müden Augen, das Zittern, das euch durchlief, sobald sie den Namen des Verstorbenen nannten, und gingen dann mit dem Geschmack von Pistaziengebäck und Pflichterfüllung im Mund wieder davon. Für manche ist der Tod eindeutig das Unterhaltsamste, was das Leben zu bieten hat.
Es war die erste Trauer, der du so unmittelbar ausgesetzt warst. Du lerntest das Gefühl kennen, außerhalb deiner selbst zu stehen, fast abgelöst von deiner fleischlichen Hülle, als ob der Geist sich weigerte, dem Körper einen Schmerz zuzufügen, den er nicht ertragen könnte. Du sahst zu, wie du vom Tod deines Vaters erfuhrst, die Gäste empfingst, versuchtest, deine Mutter zu entlasten. Du hörtest jedes Wort, das du sagtest, als hätte es jemand anderes ausgesprochen. Du beobachtetest dich in der Gegenwart Nesrines, deren Augen so feucht waren wie deine trocken.