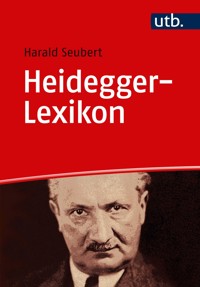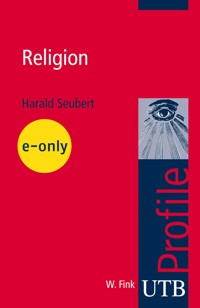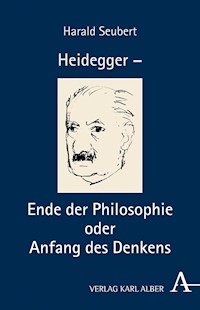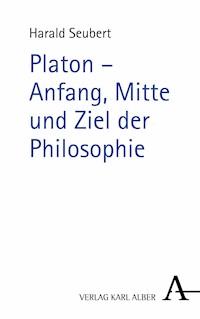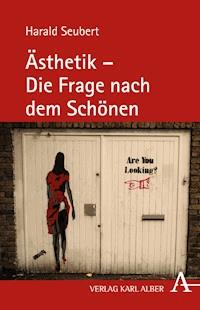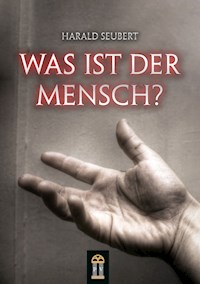
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patrimonium
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wir Menschen haben uns schon immer gefragt, woher wir kommen und wohin wir gehen, wir wollen nicht wahrhaben, dass wir nur das Produkt einer Kette von Zufällen sind. Die Grundfragen der Conditio humana sind diejenigen nach dem menschlichen Selbst- und Weltverstehen. Sie behandeln die Würde des Menschen, seine Freiheit, aber auch seine Endlichkeit und Sterblichkeit. Diese Gabe der Selbstreflexion macht uns zu etwas Besonderem und unterscheidet uns von den Tieren. Ausprägungen des modernen Zeitgeistes – etwa die Gendertheorie, welche die unhintergehbare Doppelnatur des Männlichen und Weiblichen verkennt – betrachten den Menschen lediglich als ein auf sich selbst bezogenes Wesen. Dabei ist es wahr, dass der Zugang zur Welt und zum Sein stets vom Menschen abhängt. Dieser aber hat sein Sein nicht aus sich, sondern von seinem göttlichen Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Copyright © 2015
Patrimonium-Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Erschienen in der Edition »Patrimonium Philosophicum« –
Rubrik »Philosophie für jedermann«
Patrimonium-Verlagsbüro Abtei Mariawald
52396 Heimbach/Eifel
www.patrimonium-verlag.de
Gestaltung, Druck und Herstellung:
Druck & Verlagshaus Mainz GmbH
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
Abbildungsnachweis
Umschlag: by »nickanizer« via stock.xchng,
www.freeimages.com/index.phtml
ISBN: 978-3-86417-068-3
Heinrich Beck, dem Philosophen der Dialogik und Ontodynamik, in tiefer Verbundenheit gewidmet.
Einleitung
Die Frage: »Was ist der Mensch?« scheint auf den ersten Blick einfach, selbstverständlich, fast trivial. Tiefer gefragt verbirgt sich darin ein Geheimnis. Denn obwohl jeder, der so fragt, Mensch ist, ist er nie damit am Ende, sein eigenes Menschsein und das Menschsein seiner Mitmenschen zu begreifen. Die Wissenschaft, die sich dieser Frage annimmt, die Anthropologie, ist von verschiedenen disziplinären Ausformungen geprägt. Sie kann medizinisch, biologisch, neurologisch, ethnographisch angelegt sein. Gelegentlich wird auch im vorliegenden Buch auf solche Disziplinen Bezug genommen. Doch das Eine und Ganze des menschlichen Wesens bedenken nur zwei eng zusammengehörende Disziplinen: nämlich Philosophie und Theologie. Gerade die Schnittstelle zwischen beiden, wo die endliche Conditio humana auf ihren ewigen Grund transparent wird, verspricht Aufschluss über das, was der Mensch in Wahrheit und Wirklichkeit ist und sein kann. Deshalb soll in diesem Buch, obwohl es in erster Linie philosophisch fragt, dieser Übergang von besonderer Bedeutung sein.
Dabei wird im Folgenden nicht eine abstrakte Idealisierung des Menschen angestrebt. Leitend soll vielmehr ein Realismus sein, der dessen leib-seelische Totalität zu skizzieren versucht – und dies vor dem Hintergrund eines Begriffs von Erfahrung, der gleichermaßen die metaphysische Innerlichkeit und eben nicht nur das raum-zeitlich Gegebene meint.
Die Frage nach dem Menschen versteht sich keineswegs von selbst. Darauf hat bereits die antike Philosophie eindrücklich hingewiesen. Bemerkenswert ist das Schweigen der Platonischen Dialoge, wenn es um die Bestimmung des Menschen geht. Platon gibt keine Definition des Menschen, so wie sie später von Aristoteles als ›Zoon logon echon‹ und ›Zoon politikon‹ formuliert wird. Er weiß, dass der Mensch sich selbst und seinesgleichen ein Rätsel ist. Es ist bekanntlich das Rätsel der Sphinx, das Ödipus erriet. Doch derselbe Ödipus war der Rätselhaftigkeit seiner eigenen Existenz nicht gewachsen. Er hatte wohl an etwas gerührt, das man besser im Verborgenen lässt, er hatte einen Schleier gehoben, der besser zugezogen bleibt. Indes ist Platons ganze Philosophie, im Netz ihrer Dialoge, eine einzige Frage nach dem Menschsein und nach dem, was ihm seinen letzten Horizont gibt. Ähnlich hat dies Jahrhunderte später Immanuel Kant gesehen, wenn er auf die drei architektonischen Fragen der Philosophie: »Was können wir wissen?« – »Was sollen wir tun?« – »Was dürfen wir hoffen?« – die vierte und abschließende nach der Bestimmung des Menschen folgen lässt.1 Bei Kant kommt entschieden ins Spiel, dass der Mensch sich gegeben und zugleich aufgegeben ist. Er ist physisch ›homo phainomenon‹ in Raum und Zeit. Doch als intelligibles Wesen ist er zugleich dazu bestimmt, ›sittliches Wesen‹ – ›homo noumenon‹ zu werden. Mit der Zweiheit verbindet sich auch eine Reflexivität, die immer wieder als Mangel wahrgenommen wird. Rilke hat, vor allem in seinen ›Duineser Elegien‹, in tiefer Weise evoziert, dass das Tier in einer Weise bei sich ist und in sich bleibt, die der Mensch verloren hat. Er lebt in Abstand, Reflexion und Wort. Nur die Kinder und die Liebenden, Erlösungsgestalten des Menschseins, kommen jener tierhaften Stimmigkeit nahe.2
Im Schöpfungsbericht der Bibel wird der Mensch als Ebenbild Gottes benannt. Dies ist für die Deutung des Menschseins in Judentum und Christentum bestimmend. Ebenbild ist noch mehr als ein Abbild. Es ist die – in die Endlichkeit versetzte – Gott gleichgestaltete göttliche Natur. Der Schöpfer (elohim) erkennt sich selbst als Bild und Gleichnis im Menschen. Deshalb kann und soll sich der Mensch – jeder Mensch – als Ebenbild Gottes verstehen.
Indem er sich im Sündenfall von Gott trennt, verfehlt der Mensch diese Gottebenbildlichkeit. Sie wird aber keineswegs ganz zerstört. Sie bleibt als Anlage vielmehr erhalten, bei aller Tendenz (propensio, nisus) zur Sünde. So wie schon Platon von einer inneren Sehnsucht des Menschen zur Rückkehr in seine himmlische Urheimat sprach und im ›Phaidon‹ die gefiederte Seele evozierte,3 ist dieser unverletzliche ›Character indelebilis‹ auch im christlichen Verständnis Anzeichen einer metaphysischen Unruhe, die den Menschen niemals loslässt. Sie zeigt sich in großen christlichen Zeugnissen: in Paulus‘ Sehnsucht nach dem Heil und Leben in Christus, in Augustinus‘ bewegenden ›Confessiones‹ mit der Kernaussage, dass das eigene Herz unruhig sei, bis es in Gott zur Ruhe komme, sowie bei großen christlichen Denkern von Blaise Pascal bis Romano Guardini. Auch die Erlösungs- und Transzendenzsehnsucht anderer Weltreligionen kennt ein solches Heilsverlangen. Nicht zuletzt schreibt sie sich in die Aufschrift auf alten Schweizer Häusern ein: »Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Mich wundert, dass ich fröhlich bin«. Karl Jaspers sah darin eine »Chiffer der Transzendenz«.4 Romano Guardini sah die »Schwermut« als eine Gravitation des Menschen auf den göttlichen Grund.5 Sein Ort ist nach christlicher Offenbarung und Lehre die Menschwerdung Gottes im wahren Gott und wahren Menschen Jesus Christus selbst. In ihr und nur in ihr ist das ursprüngliche Antlitz des Menschen in seiner Würde wiederhergestellt. Damit gibt christlicher Glaube eine dezidiert menschliche und zugleich göttliche Antwort auf Fragen, die sonst im Zustand der Unruhe und des Ungenügens bleiben müssten. Die Gottebenbildlichkeit gewinnt, wie vor allem das Johannesevangelium zeigt, nun eine vertiefte, soteriologische Bedeutung: Die wahre Gotteskindschaft ist jedem Menschen eröffnet. Jesus Christus zieht, im Sinne des Hohen Priesterlichen Gebetes (Joh 17, 1-8)6, »sie alle« zu sich (Joh 8, 28). Er nimmt die Seinen in sein ursprüngliches Verhältnis zum Vater hinein. Dies setzt voraus, dass »niemand zum Vater kommt« denn durch ihn (Joh 14, 6). Die Heilsgeschichte macht deutlich, dass dies durch den wirklichen Tod des Menschensohnes geschehen muss. Damit nimmt er dem Tod die Macht und durchbricht den Stachel des Todes und den Sieg der Hölle (1 Kor 15, 55). Dies ist die befreiend erlösende Botschaft des Ostermorgens von der wahrhaften Auferstehung. An der Überwindung des Todes kann jeder Mensch teilhaben, der Jesus Christus und seiner Kirche folgt. Im Lauf der Philosophiegeschichte ist diese Überwindung zumeist nur der Seele oder dem Geist des Menschen vorbehalten gewesen. Die Botschaft von der leiblichen Auferstehung des Menschen nach dem Tode, seiner Umkleidung mit einem neuen Leib, zeigt freilich, dass ein Dualismus von Leib und Geist nicht das letzte Wort haben kann.7 Auf seine Weise hat dies schon Aristoteles in seiner Seelenschrift gewusst. Die Seele versteht er als die Form des Leibes.8 Beide sind also voneinander untrennbar. In gewisser Weise ist also auch die menschliche Leiblichkeit in die Ewigkeit Christi aufgenommen.
Das Buch wird in seinem Ersten Teil die wesentlichen Bestimmungen der Conditio humana freilegen. Im Zweiten Teil wird es auf Tendenzen aufmerksam machen, die das genuin Menschliche bedrohen und in Frage stellen. Mit einem Plädoyer für die transzendente, zugleich aber endliche Menschlichkeit wird es schließen.
1 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Akademieausgabe Band III (Berlin 1900) 522–530.
2 Dazu Romano Guardini: Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins (Paderborn 1996) 120 –200.
3 Platon: Phaidon 76 b 3–80 a.
4 Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie (München 1971) 26–32; 50–58.
5 Romano Guardini: Vom Sinn der Schwermut (Zürich 1949).
6 Ich führe Schriftstellen in der nach der Lutherbibel, revidierter Text 1984, an.
7 Joseph Ratzinger (Benedikt XVI): Jesus von Nazareth Band II. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung (Freiburg/Br. München 2011).
8 Aristoteles: Über die Seele, Buch II. Cp 1, zweisprachig mit Kommentar herausgegeben von H. Seidel (Hamburg 1995) 59–63.
Erster Teil: Was die Conditio Humana ausmacht
1. Grundstrukturen der Conditio humana
1.1. Die menschliche Doppeldeutigkeit und die Paradoxie immanenter Anthropologien
Der Philosoph G. W. F. Hegel wusste, dass erst von dem Heilsereignis her die königliche Würde des Menschen auf Dauer gestellt werden kann.9 Wenn man dies mit den Erwartungen an ein Endziel des Menschlichen in anderen Weltreligionen vergleicht, wird sogleich die ganze Differenz deutlich. Im Islam wird der Mensch als Gebilde und Werk Allahs bezeichnet, das dessen Willen erfüllen kann. Wenn er daran versagt, so ermäßigt Gott seine Anforderungen. Einen Begriff der Sünde aber, in der sich der Mensch grundsätzlich von Gott abgekoppelt und den Aufstand gegen ihn versucht hätte, kennt der Islam nicht. Dies bedeutet auch, dass seien Freiheit deutlich eingeschränkt ist. Gott ist der Urheber von allem, was ist. Eine andere Ursache, außer Gott als Prima causa, gibt es nicht. Demgegenüber suchen die fernöstlichen Religionen die Auflösung in das Eine des Geistes (Brahma) oder des Nichts (Nirvana). Seine Zielbestimmung findet das menschliche Individuum darin, dass es sich auflöst.
Eine ganze Tradition christlichen Denkens weiß von hier her, dass der Mensch auf das Wesen Gottes verweist. Er ist deshalb ›vestigium trinitatis‹. Die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Geist findet sich in ihm wieder. Aurelius Augustinus hat jene Spuren zu lesen unternommen, und unter anderem auf Denken, Wollen, Fühlen verwiesen. Auch die Liebesfähigkeit des Menschen verdankt sich dem Umstand, dass er selbst von Gott geliebt ist.
Die Erbschaft der menschlichen Gottebenbildlichkeit blieb leitend bis zum Kantischen Grundsatz der absoluten und daher unveräußerlichen menschlichen Würde. Damit liegt der Zweck des Menschen in ihm selbst. Würde, so sagte es Kant, kann niemals gegen Werte verrechnet werden. Denn die Werte sind relativ und gegeneinander zu taxieren, die Würde aber ist absolut. Die großen Traditionen des christlichen Denkens hielten deshalb fest, dass der Mensch noch über den Engeln stehe. Doch die Erfahrung lehrte auch, dass er, wenn er sein Menschsein preisgebe, unter jedes Tier fallen kann.
Versucht man eine ›Idee des Menschen‹ zu bestimmen, so stößt man auf eine grundsätzliche Schwierigkeit. Sie dürfte eine Rolle bei Platons Zurückhaltung gespielt haben, ihn definitorisch zu bestimmen. Ideen sind auf Einheit gerichtet. Dem Menschen ist aber, in jedem Fall, eine Doppelnatur eigen. Er ist ein ewiger intelligibler Geist in der individuellen Gestalt eines sterblichen Leibes. Diese Verbindung macht sein Personsein aus. Der Unterschied zwischen ›Etwas‹ und ›Jemandem‹ bezeichnet daher die ›anthropologische Differenz‹. Damit ist der Mensch immer gleichermaßen Bedürfnis- und Triebwesen und Geist. Die eine und die andere Seite wird man im Sinn des Personbegriffs nicht klinisch voneinander trennen können.10 Sie durchdringen einander vielmehr. Der Mensch ist ein Zwischenwesen: eben, wie Kant sagte, ›Homo noumenon‹ und ›homo phainomenon‹. Im Sinne der christlichen Heilsgeschichte ist er gefallener Mensch und bleibt doch, zumindest in seiner Grundanlage, Gottes Schöpfung und Manifestation. Der Mensch aber ist deshalb ein ›experimentum medietatis‹: ein Wesen, das nach seiner Mitte fragt, artikuliert oder unartikuliert, und das auf seinen transzendenten Grund zurückbezogen ist.
Hinzukommt, dass der Mensch trivialerweise niemals in einer abstrakten Einheit, als ›Mensch an sich‹ vorkommt, sondern immer in der geschlechtlichen Differenz von Mann und Frau. Mythen wie der Platonische vom ursprünglichen Kugelmenschen, der dann wegen seiner Hybris von den Göttern getrennt und in die gegenwärtige Gestalt gefügt worden sei, deuten an, dass darin ein Mangel liegt.11 Der biblische Schöpfungsbericht sieht das anders. Gott selbst habe den Menschen als ›Mann und Frau‹ geschaffen.
Noch eine weitere Unschärfe verbindet sich mit der anthropologischen Frage. Der Mensch kann und darf nach antikem Verständnis eigentlich nicht den Menschen bestimmen, womit einerseits die Herrschaft von Menschen über Seinesgleichen gemeint ist: Sowohl Platon als auch Kant, die zwei vielleicht bedeutendsten politischen Denker des Abendlandes, haben darin eine Aporie gesehen. Doch auch schon die erkennende Bestimmung des Menschen durch seinesgleichen ist eben deshalb problematisch. Kein Mensch vermag über den Menschen und sein Wesen von einem neutralen Standort aus zu sprechen. Er muss dabei stets zugleich nach sich selbst fragen. Er ist also gleichsam die »Black box« seiner eigenen Frage nach dem Menschsein. Deshalb ist die vermeintlich unschuldige Frage: »Was ist der Mensch?« eben keineswegs harmlos.12 Sie bedeutet eine Grenzüberschreitung. Daraus ergeben sich verwirrende Konstellationen. Hans Blumenberg hat sie einmal in eine fingierten Gespräch zwischen dem ›Tiefsinnigen Frager‹ (T) und dem Leichtfertigen Antworter (L) pointiert dargestellt: »T: Was ist der Mensch? L: Da geht doch einer. T: Ob das auch einer ist wie ich? L: Alle sind so wie du. T: Vielleicht ist jeder ein anderer. L: Alle sind anders. T: Woher will man wissen, was alle sind?«.13
Der Gedanke, man könne die großen Fragen der Philosophie auf Anthropologie zurückführen, Anthropologie sei dann gleichsam die erste Wissenschaft,14 ist deshalb eine Täuschung. Anthropologie als das vermeintlich Nächstliegende ist zugleich das Fernste. Dieser Charakter der anthropologischen Frage mag der Grund dafür sein, dass das Menschsein oftmals nicht ertragen wird und Fluchten gesucht werden. Zwei Tendenzen, die für die Gegenwart charakteristisch sind, sind schon hier zu benennen: Man reduziert den Menschen auf seine biologischen und physiologischen Bedingungen. Diese lassen sich in jeweiligen Leitwissenschaften evolutionstheoretisch, genetisch und neurologisch ermitteln Der Mensch soll »nichts als« seine biologisch zu vermessende Natur sein. Die andere Tendenzen: Man versucht, über den Menschen hinauszukommen. Der Transhumanismus ist eine Chiffre, in der sich Nietzsche Übermensch-Gedanke mit neuen technologischen Vorstellungen von Cyborgs, von Kreuzungen zwischen Mensch und Maschine verbindet. Die Seele soll nach außen in Computernetzwerke verlegt werden; unter die Haut verpflanzte Chips sollen das Sensorium und die organische Natur des Menschen erweitern. Wenn man die Computerrevolutionen der letzten drei Jahrzehnte miterlebt hat, wird man diese Entwicklungen kaum überzeugend verharmlosen können. Sie sind längst im Gange. Das ›Eritis sicut Deus‹ ist diesen Ansätzen eingeschrieben. Sie machen sich zur Schöpferinstanz. Dass dem maschinell aufgerüsteten Menschen Allwissenheit und Unsterblichkeit versprochen wird, liegt in der finalen Logik der laufenden Experimente.
Die beiden Tendenzen scheinen einander gegenläufig zu sein. Tatsächlich berühren sie sich aber in ihrer Grundabsicht. Hier wie dort wird das Menschsein in seinem ›Zwischen‹ nicht ertragen. Einmal flüchtet man sich in die Regression, einmal in eine haltlose Zukunft. Doch menschliche Besonnenheit, menschliches Maß und menschliches Bewusstsein haften eben an der Bedingtheit des Menschseins, der Conditio humana, die man auf beiden Wegen überwinden will.
Aus dem Zwischenzustand haben eher säkular und wenig spekulativ argumentierende Anthropogen wie Helmuth Plessner, dessen Ansatz besonders wirkmächtig wurde, eine paradoxale Struktur des Menschseins gefolgert. Für Plessner ist der Begriff der Grenze deshalb entscheidend, weil der Mensch Grenzen überschreitet. Von hier her kommt Plessner auf die grundlegende Bestimmung des Menschen als ›exzentrisch‹. Während er das Tier als »auf es selber rückbezügliches System«15 begreift, als zentrisches Sich, »ist das Leben des Menschen ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich aus ihr heraus. Diese Exzentrizität ist die für den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit gegen das Umfeld«.16 Ähnlich hat Hans Blumenberg die elementarste auszeichnende Formel des Menschseins in der Sichtbarkeit gesehen, die sich wie von selbst aus dem aufrechten Gang ergibt. Dies zeichnet ihn vor allen Tieren, auch den Primaten aus. Nach verschiedenen Richtungen sehen zu können bedeutet jedoch auch, in schutzloser Weise gesehen zu werden –, und in der Tat ist dieses Moment der Sichtbarkeit immer wieder benannt, teilweise auch beklagt worden, wenn es um die Bestimmung der Conditio humana ging.
Plessner seinerseits leitet daraus drei ›anthropologische Gesetze‹ ab: Das »Gesetz der natürlichen Künstlichkeit«:17 Es bedeutet, dass der Mensch per se und aufgrund seiner Natur zu einem Kulturwesen werden muss. Deshalb ist seine Existenz geschichtlich. Sie bleibt nicht in der Festlegung von Gattung und Art gefangen, sondern sie wandelt sich nach Situationen und Ereignissen. Daher erbaut der Mensch sich in der Welt, die er vorfindet, eine eigene zweite Welt: die Kultur, in der er heimisch werden kann. Freilich kann er auch von ihr in stärkerem Maß abhängig werden als von der Ersten Natur.
Plessner zweites Gesetz ist das »der vermittelten Unmittelbarkeit«.18 Nur über sein Bewusstsein, über Sprache und Symbole bezieht sich der Mensch auf die Welt. Zwischen der Welt und ihm eröffnet sich deshalb ein Spielraum von Freiheit, während Tieren ihre Welt linear gegeben ist.
Zum dritten wird das »Gesetz des utopischen Standorts« genannt:19 Weder zeitlich noch räumlich ist der Mensch, dieses »festgestellte Tier« (Nietzsche), fixierbar. Er überschreitet immer wieder die Orte und Räume, die er besetzt.
Dies ist zutreffend. Und treffend ist auch, dass Plessner die verschiedenen Paradoxien auf die eine zutreibt, wonach der Mensch, dieses schlechthin sichtbare Wesen, letztlich ein »homo absconditus« bleibe, abwesend-anwesend, ortlos-verortet, aber aufgrund seiner Paradoxalität nicht haftbar zu machen. Die Explikationskraft von Plessners Ansatz endet aber an der Sphäre des Absoluten und der Religion. Nur in Such- und unendlichen Annäherungsbewegungen kann sich der Mensch nach Plessner zum Absoluten überhaupt verhalten. Religion ist für ihn eine absolute Wesenskorrelation, die die Fragilität des Menschseins stillstellt und den Homo absconditus, der auf Phantasie, Imagination und Spiel bezogen ist, deshalb verfehlt. Eine innere Unstimmigkeit liegt indessen darin, dass Plessner darauf verweist, der Mensch müsse sich zu dem, was er schon ist, erst machen.20 Damit nimmt er zwar zu Recht auf die Nietzschesche Grundformel der Anthropologie: ›Werde der du bist‹ Bezug – und ebenso richtig verweist er auf die Gestaltungsnotwendigkeit dieser Herkunft, nicht zuletzt im politischen Raum. Doch er übersieht, dass das Schon-sein in einer tieferen Dimension bereits verankert sein muss. Nur auf diese Weise kann es auch werden.
1.2. Durchlässig auf den eigenen Weltgrund: Die Metaphysik des Menschen
Max Schelers, des Anthropologen und Denkers des Absoluten, metaphysischer Ansatzpunkt führt ungleich tiefer. Dies zeigt sich bereits in Schelers Definitionsversuchen.21 Sie bleiben nicht in dualen Gegensatzverhältnissen haften, sondern explizieren die Grundspannung des Endlichen und Absoluten im Menschen. So versteht er ihn als »theomorphen Einfall Gottes«, als inneren Umschwung von Geist in Materie, der ebendeshalb »Kosmozentriker« ist. Darin greift der Mensch aber über die nur natürlichen Welt- und Lebenszusammenhänge hinaus. Weiter umschreibt Scheler den Menschen treffend als »symphonisches Kunstwerk« und als mikrokosmischen Repräsentanten des Ganzen –, damit aber auch als das sterbliche Gedächtnis des All. Dies sind durchaus Wesensbegriffe, die aber keineswegs die menschliche Natur fixieren, sondern ihr sehr wohl Dynamik und Werden zubilligen.22 Es kommt hinzu, dass der Mensch, wie Scheler pointiert formuliert, »der sorgenvolle Protestant des Lebens« ist.23
Seine Möglichkeit, auf sein Wesen und seine Natur nochmals reflexiv Bezug nehmen zu können, ist auch eine Möglichkeit des Menschen, Widerspruch und Protest gegen das Gegebene einzulegen. Dies ist eine Variante seiner Freiheit. Jene metaphysische Dimension kann man nun weiter differenzieren. An ihr wird ontologisch deutlich, dass der Mensch eine unverletzbare, bleibende Würde hat, die überhaupt erst Garant für einzelne Menschenrechte sein kann. An ihr zeigt sich, wenn man Menschheit in der eigenen und jeder anderen Person erfährt, eine Naturanlage, die nicht nur, wie Kant es sah, unwiderruflich zu metaphysischen Fragen tendiert, auch wenn sie diese nicht lösen oder beantworten kann. Die Naturanlage des Menschen ist vielmehr selbst von Grund auf meta-physisch. Die Weltoffenheit des Menschen bedeutet, wie Wolfhart Pannenberg treffend sagt, dass er »über alles, was er als seine Welt vorfindet, hinausfragen muss«.24 Damit aber ist seine Weltoffenheit dezidiert transzendierend. Mit ihr ist eine Offenheit auf die letzten Fragen und damit auf den göttlichen Grund vorgegeben. Dies bedeutet auch, dass alle wesentlichen Handlungen des Menschen nicht nur auf Zeit, sondern auf Ewigkeit gestellt sind. Er ahnt seine Herkunft aus der Ewigkeit und er artikuliert seine Hoffnung über Tod und Zeitlichkeit hinaus. Die Differenz zwischen Leib und Seele erweist sich gerade darin nur als vorläufig. In Welt- und Transzendenzbezug ist sie deshalb je schon überwunden.
1.3. Ich und Personsein
Kern jener Metaphysik des Menschen ist ein Zusammenhang, der hier nur skizziert werden kann: Menschsein artikuliert sich unhintergehbar im Ichbewusstsein und –sagen.25 Deshalb wird die Ich-Perspektive auch keineswegs erst als Sonderfall aus der 3. Person-Perspektive gewonnen. Das Ich konstituiert sich auch keineswegs erst dadurch, dass es ›seine Lebensgeschichte‹ erzählen kann. Diese ist in aller Pluralität vielmehr erst darum die ›seine‹, weil, wie Kant sagt, »Das: Ich denke alle meine Vorstellungen muss begleiten können«.26 Schließlich erwacht das Ichsagen auch nicht zuerst an einem Du, das es anspricht, so bedeutend die Dialogsituation für das Ich auch ist. Das Ichbewusstsein ist, wie Dieter Henrich im Anschluss an den deutschen Idealismus gezeigt hat, der Selbstausdruck des Menschseins. Insofern ist das Wissen, dass Ich ich bin, unfehlbar. Selbst wenn mein bewusstes Leben sonst getrübt sein mag: im Fieber, in der Ohnmacht, in einer Verwechslung mit einem Doppelgänger. Das Moment des Ichsagens selbst bleibt unfehlbar. Henrich spricht deshalb prägnant vom »unmittelbaren Vertrautsein mit mir«, das jäh und plötzlich eintrete.27 Jenes Ich ist allerdings phänomenologisch nicht auf einen rein intelligiblen Vorgang zu beziehen, der der Materie, den Eigenleib eingeschlossen, fremd und disparat gegenüberstehen würde. Descartes hat es so gesehen – und die Transzendentalphilosophie ist ihm darin weitgehend gefolgt. Husserl hat es in Korrektur zu dieser Konzeption als Strom gefasst, der in Kontinuität in die Vergangenheit zurück- und in Künftiges vorausgreift. Das Ich umfasst auch die leiblichen Lebensvollzüge.28 Es ist damit Ausdruck der Person als der Ausprägung jenes leiblichen und seelischen Zusammenhangs. Das Ich ist nicht ein statisches Eines. Auch Brüche, Vergessen, Schmerz und Passivität gehen in es ein. Ichbezogenheit und Selbsterhaltung einerseits, Weltoffenheit andrerseits stehen dabei in einem Spannungsverhältnis. Jenes Ich ist dabei nicht nur in einem allgemeinen Sinn Person, es ist unhintergehbar ›Individuum‹: unteilbares und unvertretbares Eines, als solches – und eben nicht als Gattungssubjekt und auch nicht aufgrund sozialer Rollen oder Traditionen, in denen es steht – Träger seiner unverlierbaren Würde.
Der Dimension der Menschenwürde ist deshalb im Weiteren nachzugehen
2. Menschenwürde: Universalität, Möglichkeiten, Grenzen und Aporien ihrer Begründung
2.1. Ideengeschichte und Strukturen
Wenn man fragt, was Universalität der Menschenwürde bedeutet und wie sie allenfalls zu begründen ist, so führt die Sachfrage zugleich auf eine Methodenfrage, mit der Grundsätzliches der (Praktischen) Philosophie mit in Rede steht. – Seit jeher ist es ein Spezifikum philosophischen Gründegebens, dass Meinungen, auch solche, die zumeist unbefragt feststehen, eben in Zweifel gezogen werden. Nur in dieser Doppelbewegung, nicht durch demonstrativischen Aufweis in der Art der Euklidischen Geometrie, kommt die Philosophie auf ihren Anfang. Nicht durch eine God’s eye view gewinnt sie diese Perspektive, sondern indem der Denkende seiner selbst ansichtig wird. Apaideusia (Unerzogenheit) sei es, so hat Platon in diesem Sinn in seinem VII. Brief bemerkt, nicht unterscheiden zu können, worüber man Beweise verlangen könne und worüber nicht. Da diese Fragebewegung im Horizont einer Selbst-Erfragung, des ›Gnothi seauton‹, bleibt, ist das Problem der Menschenwürde ein besonders ausgezeichnetes Paradigma dieser Fragebewegung.
Die Begründung wird, auch dort, wo sie auf die Universalität der Menschenwürde gerichtet ist, nicht primär nach deren Voraussetzungslosigkeit suchen, sondern vielmehr danach, Voraussetzungen einzuholen, miteinander ins Gespräch zu bringen und sie – vor allem – zu verstehen. Sie wird dabei auch auf Grenzen der Begründung stoßen, die sich unter verschiedenen Voraussetzungen unterschiedlich ausnehmen. An Grenzen und Widersprüchen artikuliert und differenziert sich ein philosophisches Denken, das Hegels methodischer Vorzeichnung folgt, wonach die Furcht vor dem Widerspruch schon der Widerspruch selbst sei. Und schließlich umgeht dieses Denken die Aporie nicht: Es kennt den scharfen Grenzbereich des Nicht-aus-noch-ein-Wissens, der neben dem Staunen eine Grundbedingung Platonischer philosophischer Erkenntnis ist.
Wenn von der Universalität der Menschenwürde gehandelt wird, so verweist dies darauf, dass sie ausnahmslos und ohne Ansehen der Person, aber auch alle Kulturdifferenzen übergreifend siutationsinvariant in Geltung ist. In diesem Sinn ist Menschenwürde die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen Rechte haben.29 Sie ist selbst nicht ein Recht neben anderen Rechten. Und aufgrund solcher Universalität kann es keinen Richter oder Schiedsrichter geben, der autorisiert wäre, Menschenwürde zuzusprechen oder abzusprechen. Dies wäre ein großer Anspruch. Lässt er sich einlösen?
Nähern wir uns diesem Problem indirekt, indem wir aus der Verwobenheit einzelner Momente der Begriffsgeschichte eine Grundstruktur von Menschenwürde zu gewinnen suchen. Wesentlich ist zunächst dies: Nach einem universalen Begriff von Menschenwürde wird man in der griechischen Antike vergebens fahnden. Der Mensch gilt in der ›Antigone‹ des Sophokles als das Schrecklichste (deinotaton). Kann er doch sogar mit den Göttern in einen Konflikt geraten, gefährdet von der eigenen Hybris. Diese Form von Würde ist also zugleich ein Abgrund. Denn die Tragödie spielt immer wieder durch, dass der Mensch den Göttern überlegen ist; auch wenn er physisch scheitert. Insofern er sein Leiden erträgt, Selbsteinsicht über sich gewinnt, bildet er eine Selbstkenntnis aus, die ihnen überlegen ist. Liest man Platonische Dialoge auf die explizite Frage nach dem Menschen hin, so fällt eine bemerkenswerte Scheu auf, überhaupt von ihm zu sprechen. Und man greift wohl nicht zu weit, wenn man annimmt, dass sich hier noch einmal das ›Rätsel der Sphinx‹ spiegelt, an das gerührt zu haben, die große Hybris von Ödipus gewesen ist: das Rätsel, wer denn der Mensch sei, geraten zu haben.
Bei Cicero finden sich dann bekanntlich zwei Verwendungsweisen von menschlicher Würde, anschließend an die Stoa. Einerseits ist Würde die Dignitas, die dem herausragenden großen Menschen zukommt und die sich im Umgang mit ihm auch öffentlich mitteilt.30 Wenn Aristoteles Megalopsychia, die Groß- und Hochherzigkeit, kennzeichnet als Ruhe, Gelassenheit, als Wesenszug eines Menschen, der nur die großen Ziele verfolgt, der langsam und gesetzt geht und dessen Rede überlegt ist,31 so sind diese auszeichnenden Züge besonders hervorgehoben. Würde kommt in diesem Sinn einzelnen Menschen in besonderem Maße zu. Und dafür bewundern wir sie zu Recht.
Doch daneben kennt Cicero eine zweite Begriffsverwendung, in der die Würde als ein der Natur und dem Wesen des Menschen als Menschen Anhängendes begriffen wird. Es enthält auch die römisch-katholische Liturgie Gebetssequenzen, die auf die universale menschliche Würde verweisen. »Gott, der du die menschliche Natur wunderbar gegründet und noch wunderbarer erneuert hast«.Cicero selbst spricht eher negativ von bestimmten Lebensformen, die nicht der menschlichen Würde gemäß seien. In der Menschenwürde liegt also eine Verpflichtung. Der eigenen Lust ohne Form und Grenze nachzugeben, wäre ihr zuwider. Der Mensch wird sich selbst ein Maß setzen, weil er seine Würde zu verlieren hat. Menschenwürde gewinnt damit eine umfassend ethische, Menschsein normativ qualifizierende Bedeutung. Menschenwürde ist nach Cicero deshalb eine Gemeinsamkeit aller menschlichen Wesen durch die Vernunft (ratio). Die Würde und Vortrefflichkeit in der menschlichen Natur (De off. 1, 105 f.) realisiert sich in der Pflicht (gr.: ›kathekon‹, lat.: ›officium‹) als höchstem Begriff der Ethik. Dem ist eine spezifische Wissensform eingestiftet, die syneidesis (Gewissen), ein Wissen und Mitwissen eben des Menschen um sein eigenes Tun, das ihn zum ›honestum‹ (dem höchsten Ankerpunkt der Ehre) qualifiziert.
Vor dieser hier nur anzuzeigenden Ciceronischen Begriffsarchitektur her ist die Menschenwürde Teil der Annahme einer Lex aeterna, eines ewigen Gesetzes.
Diese Linie setzt sich auch im christlichen Denken des Hochmittelalters fort, etwa bei Thomas von Aquin. Der Personbegriff steht dabei in engstem Zusammenhang mit der Menschenwürde. »Da es von großer Würde ist, in einer vernünftigen Natur (Wesen) zu substistieren, wird jedes Individuum (einzelne Erscheinungsform) einer vernünftigen Natur Person genannt«.32 Darin ist (was Kant dann weiterführen wird) offengelegt, dass die Verantwortung für das eigene Handeln mit der Würde mitgesetzt ist. Menschenwürde verweist auf die Sittlichkeit. Andernfalls fällt der Mensch hinter die Natur alles anderen Seins zurück. Dies ist eine Begründung, die dem Menschen ipso facto zukommt und deren Grund eben in seinem Sein zu finden ist: Man muss deshalb darauf hinweisen, dass die Warnung vor dem ›naturalistischen Fehlschluss‹ hier in keiner Weise Geltung beanspruchen kann. Dass die Würde zur Substanz des Menschen gehört, ist an den bisher erörterten Knotenpunkten unserer Reflexion auf naturrechtlichem Weg festgeschrieben. Auch dies würde in neuzeitlichen Denkformen nicht ohne weiteres als Begründung gelten, schon gar nicht für die Universalität der Menschenwürde; hat doch das Naturrecht durch die Entteleologisierung des Naturbegriffs seine Bedeutung als Polarstern abendländischer Ethik weitgehend eingebüßt.
Und erst recht bedeutet John Lockes Problematisierung einen Einschnitt. Lockes empiristische Überprüfung der Berechtigung, von Menschenwürde überhaupt zu sprechen, setzt am Substanzbegriff ein.33 Die Rede von einer Substanz ist für ihn eine Setzung, um die Einheit der Erfahrung zu gewährleisten: Nicht mehr und nicht weniger. David Hume wird in der Folge den Menschen als »only a bundle of imaginerys« beschreiben. Wie sie zusammenhängen, ist keineswegs durch die Setzung selbstexplikativ.34Demzufolge ließe sich Würde dann nur konkreten Akten des Bewusstseins zuschreiben, und ihnen wäre das Sich-selbst-gleich-bleiben eines vernünftigen Wesens fallweise positiv abzulesen oder an ihnen zu falsifizieren, wobei die Selbstidentität nicht nur ein moralisches Problem, sondern auch ein Problem menschlichen Selbstverständnisses ist. Die Würde aber hängt damit (und dies ist in Texten aus der empiristischen Tradition bis heute das zentrale Problem, das sie daran hindert, eine Universalität von Menschenwürde anzunehmen) von Akten der Reflexion, Identifizierung usw. ab oder zumindest von der Disposition zu diesen Akten. Denn diese Akte geben kriteriologische Maßstäbe dafür ab, Personsein zu- oder abzusprechen. Und nur von aktualem oder zumindest latentem Personsein hängt Menschenwürde ab. Ihr universale Geltung zuzusprechen, würde sich dann gerade verbieten.
Dies ist eine Entmythologisierung durch Klärung des Sprachgebrauchs, die tief in die angelsächsische Philosophie hineinführt.
Hier kommt ein weiteres wichtiges Problem ins Spiel: Locke versteht nämlich die Sorge des Menschen, sich selbst erhalten zu können, als Dreh- und Angelpunkt des Personseins. Ist dies aber der letzte Ankerpunkt? Man kann den bekannten Puzzling Case anführen, ob ein von einer Sonde ernährtes, in seiner Selbsterhaltung gesichertes, durch Infiltrationen in Glücksbildern schwelgendes Vegetieren irgend ein wünschenswerter Zustand des Menschseins wäre. Ist nicht die Aristotelische Bestimmung der ›Eudaimonia‹ als vernunftgemäßes Handeln tatsächlich unhintergehbar und damit auch ein Indiz von irreduktiblen Erfordernissen an Würde. Dann wäre es zumindest fraglich, die Selbsterhaltung derart ins Zentrum zu rücken und sie als letzten Zweck mit einer allenfalls okkasionellen, reduktiven Würdedeutung zu verbinden. Darauf, dass es eine andere Perspektive zu bedenken gebe als die der Selbsterhaltung hat Parfit hingewiesen, wenn er bemerkte: die Identitätssorge sei notwendigerweise in die Überlebenssorge mit eingeschlossen. Sie umfasst aber eine Klärung nicht nur, dass sondern wie und als wer ich überleben möchte.35
In diesem Sinn gewinnt der Personbegriff auch in der gegenwärtigen angelsächsischen Philosophie weiter an Prägnanz; insoweit sie die Unreduzierbarkeit von mentalen Erlebnissen auf materialistische Ereignisse und Zustände reflektiert und damit von Locke und Hume Abstand gewinnt. Handlungen, Gedanken, Intentionen sind nicht auf ihre physikalistischen Repräsentationen zurückzuführen, auch wenn sie in ihnen mit repräsentiert werden. ›De se‹-Prädikationen, auch das hat jüngere begriffssemantische Forschung sehr differenziert zeigen können,36 sind nicht auf Zugänge aus der 3. Person singular zurückzuführen. Wenn wir aber Menschenwürde nicht aus aktualen Akten, die sich von Dritten her zuerkennen oder aberkennen lassen, erklären wollen, sondern als Vorwegnahme des Eigenseins, so wird die empiristische Plausibilität erheblich eingeschränkt werden müssen. Die Denkbarkeit einer universalen und apriorischen Menschenwürde wird zumindest wieder ermöglicht.
Damit wird ein anderer Horizont berührt. Christlicher Glaube macht aufgrund zentraler Kerygmata und Dogmata Menschenwürde zu einer unverzichtbaren Folgerung dadurch, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist und dass soteriologisch diese Gottebenbildlichkeit wieder hergestellt wird, indem Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch wird. Für eine pluralistische und säkulare Welt legt sich selbstredend der Einwand nahe, dies bedeute den Rückgriff auf eine partielle Quelle, die keineswegs rechtens universalisierbar ist. Jene Überlegung bleibt zu prüfen. Dabei ist zu bedenken, dass sich die gläubige Voraussetzung als vernünftig erweisen kann, wenn sie denn einen Begriff von der Würde als einer in der Unhintergehbarkeit des leib-geistigen, individuierten, um sich wissenden Menschen liegenden Grunddisposition vertritt. Man mag sich an die scholastische Grundlehre erinnern, wonach die Offenbarung der reinrationalen Philosophie des ›lumen naturale‹ nicht widerspricht, sie aber ergänzen kann. Kant setzt einerseits das christliche Menschenwürdekonzept voraus, andererseits eröffnet seine Interpretation die Möglichkeit, es im Sinn des Vernunft- und Sittengesetzes zu deuten.
Dass eine Elementarform von Würde aufgrund ihrer Gottebenbildlichkeit allen Menschen zukomme, ist erstmals auch in der spanischen Spätscholastik gesehen und mit der Konzeption der einen Menschenfamilie verbunden worden. Anlass gab das Völkerrechtsproblem in der Conquista und klassischer, heute wieder viel zitierter Text ist die ›Brevissima Relacion‹ von Las Casas (1542). Sie formuliert freilich den Menschenwürde-Grundsatz eher negativ. Die Indios sind nicht barbarischer als die Europäer. Das Völkerrecht ist eine Art Band (vinculum) zwischen den Menschen. Las Casas fügt hinzu:: »alle freuen sich über das Gute alle verabscheuen und verwerfen das Böse [...] So gibt es denn ein einziges Menschengeschlecht, und alle Menschen sind, was ihre Schöpfung und die natürlichen Bedingungen betrifft, einander ähnlich.«37 Dies ist eines der ersten großen Zeugnisse, in dem das innere Wissen die Menschenwürde auch exoterisch sichtbar wird.
Gottebenbildlichkeit zu denken,