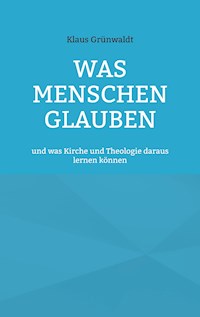
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was glauben Menschen wirklich? Wozu brauchen Menschen die Kirche? Und was wünschen und erwarten sie von ihr? Das Buch untersucht Texte, in denen Menschen ihren Glauben unverfälscht aussprechen. Es fragt, was die Lieblingssprüche zur Taufe, Konfirmation und Trauung oder die kürzlich gewählten Lieblingslieder über den Glauben heute aussagen. Dabei kommt etwas Erstaunliches heraus: Der aktuelle Volksglaube ähnelt in vielem der Religion, wie sie sich in den biblischen Psalmen ausspricht. Der Autor meint, dass die Kirchen und die Theologie auf diesen Glauben eingehen sollten. Eine Kirche, die nahe bei den Menschen sein und für die Menschen da sein will, darf nicht nur ihre Strukturen reformieren, sondern sie muss sich auch für den Glauben ihrer Menschen interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
0. Hinführung
I. Was Menschen glauben – Konturen eines Gemeindeglaubens bzw. einer Volksfrömmigkeit
I.1. Das Bonner Credo-Projekt
I.2. Glaubenssplitter
I.3. Neu anfangen
I.4. Tauf-, Konfirmations- und Trausprüche
I.5. Bestattung
I.6. Schick mir dein Lied
I.7. Was glauben Sie denn?
I.8. Hartmut Rosa, Resonanz
II. Warum wir den Gemeindeglauben bzw. die Volksfrömmigkeit ernstnehmen sollten
III Zionstheologie und Psalmen-Theologie – Paradigma menschlicher Frömmigkeit
III.1. Gottheiten im vordavidischen Jerusalem
III.1.1. Frieden
III.1.2 Gerechtigkeit
III.1.3. Sonnengott
III.2. Tempeltheologie
III.3 Zion und Hoffnung
IV Folgerungen für die kirchliche Praxis
IV.1. Grundsätzliche Überlegungen
IV.2. Konkretionen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Seit mindestens 30 Jahren bemühen sich kompetente und engagierte Menschen darum, das Leben in den Kirchengemeinden attraktiver und lebendiger zu gestalten. Sie werden dabei unterstützt von den Landeskirchen, den missionarischen Diensten oder – wenn es sich um katholische Gemeinden handelt – den zuständigen Arbeitsstellen für Pastoral in den Bistümern. Begleitend gibt es eine Fülle von Angeboten, einzelne Arbeitsfelder des „Bauchladens“ Gemeinde zu stärken, wie z. B. die Gemeindeberatung oder Fachstellen für Ehrenamtliche – und viele mehr.
Allen diesen Bemühungen ist eines gemeinsam: Sie zielen ganz überwiegend auf Strukturen oder Formen. Auch die jüngsten Initiativen zur Belebung des Gemeindelebens in den evangelischen Landeskirchen, die sich größtenteils an den „Erprobungsräumen“ der Mitteldeutschen Kirche orientieren, zielen auf organisatorische Innovation. Die ist zweifellos wichtig, schon weil die Zahl der hauptamtlich Mitarbeitenden prozentual noch stärker zurückgeht als die Zahl der Mitglieder. Aber Innovation darf nicht beim Organisatorischen stehenbleiben.
Was mir bei den Debatten um die zukünftige Gestalt der Kirche immer zu kurz gekommen ist, sind die Inhalte, die die Kirche vermittelt. Es ist Aufgabe der Kirche, die Frohe Botschaft weiterzusagen. Aber sind wir uns darüber einig, was genau der Inhalt dieser Botschaft ist? Wie lautet genau das Evangelium, das wir weiterzusagen haben?
Hinzu kommt ein weiteres – und das ist vielleicht das Entscheidende. Die Reformation Martin Luthers war deswegen so erfolgreich, weil sie auf die brennendsten Fragen der Menschen seiner Zeit bezogen war: die Angst vor der ewigen Verdammnis. Luther hatte den Menschen zugehört, er wusste, wohin ihre Gedanken, ihre Ängste und Sehnsüchte gingen. Diese Haltung des Zuhörens wieder einzunehmen steht der Kirche gut an. Sonst geht es uns wie einem ehemaligen Kollegen: Der lehrte engagiert im Konfirmandenunterricht, bis auf einmal ein Konfirmand fragte: „Wo ist der Bus?“ „Welcher Bus?“, fragt der Kollege zurück. „Na, der Bus mit den Leuten, die sich dafür interessieren, was Sie hier reden.“
Der römisch-katholische Bischof Klaus Hemmerle hat die Haltung, die uns nottut, in einem wunderbaren Wort zusammengefasst:
„Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe.“
Damit wir nicht Antworten auf Fragen geben, die niemand mehr stellt.
Darum fragt dieses kleine Büchlein nach dem, was Menschen glauben, was sie sich von der Kirche wünschen, wo ihre religiösen Sehnsüchte sind. Und sie fragt danach, was die Kirche tun könnte, um stärker an der Religion ihrer Mitglieder und Nicht-Mitglieder orientiert ihren Dienst zu tun.
Vielleicht gibt es ja einen Bus mit Menschen, die das interessiert.
Ich widme dieses Buch der Ev.-luth. Inselkirchengemeinde Juist. Die vielen Male, die ich dort als Urlauberpastor mit den beiden Insel-Pastorinnen, dem Kirchenmusiker, dem Team der Kirchengemeinde - vor allem aber den Urlauberinnen und Urlaubern zusammenarbeiten durfte, haben mein theologisches Denken nachhaltig geprägt.
Pfingsten 2022
Klaus Grünwaldt
0. Hinführung
Im Jahr 1978 veröffentlichte der Alttestamentler Rainer Albertz seine Habilitationsschrift „Persönliche Frömmigkeit und offizielle Religion“, in der er den „Religionsinterne[n] Pluralismus in Israel und Babylonien“ untersucht hat.1 In dieser Studie vergleicht er die institutionalisierte, von König und Priesterschaft protegierte Religion mit der privatfamiliären Religionsausübung. Es überrascht nicht, dass er große Unterschiede zwischen beiden feststellt; immerhin weist er auch auf eine Reihe von Interdependenzen der beiden Formen hin: bis dahin, dass in manchen Zeiten – insbesondere in der Krisenzeit des Exils – die persönliche Frömmigkeit tragende Säule der Religionsausübung insgesamt gewesen ist.2 Als Quellen für die persönliche Frömmigkeit wählt Albertz die Psalmen der Einzelnen, die theophoren3 Personennamen und die Väter-Religion.4 Spannend ist, dass das Buch im letzten Kapitel auch das (damals) gegenwärtige Spannungsfeld anhand der Kasualpraxis in den Blick nimmt. Damit zeigt der Theologe, dass er die Brisanz des Themas für das Verständnis gegenwärtiger Religiosität deutlich erkannt hat und dass er seine biblisch-theologische Studie als Beitrag für ein praktisch-theologisches Religionsverständnis versteht.
Wie steht es heute um das Verhältnis von persönlicher Frömmigkeit und offizieller kirchlicher Religion in Deutschland? Ist die kirchliche Theologie, die aus den kirchlichen Schreibstuben und einer Vielzahl an Ausschüssen kommt, die in den Kirchen von den Kanzeln verkündigt oder in kirchlichen Zeitschriften publiziert wird, tatsächlich „der Glaube der Menschen“5 in den (und außerhalb der) Gemeinden? Oder glauben die etwas ganz anderes? Welche Gottesbilder haben die Menschen? Wofür brauchen sie Religion? Wie „nutzen“ sie Religion? Welche Erfahrungen machen sie mit Religion? Sind die Formate der Religionsausübung, die von den Kirchen angeboten werden, und die Gestaltungsformen der Gemeinden für die Menschen hinreichend attraktiv - oder suchen sie vielleicht etwas ganz anderes?
Dass es erkennbare Unterschiede zwischen den religiösen Vorstellungen der Menschen und der kirchlichen Theologie gibt, ist evident. Das gilt auch dann, wenn man auf die Pluralität religiöser Vorstellungen hier und da hinweist: Weder die verbreiteten vielfältigen Glaubens-Vorstellungen der Menschen noch die kirchliche Theologie sind einheitliche Größen. Wenn man sie dennoch miteinander vergleichen oder aufeinander beziehen will, kommt es vor allem darauf an zu erheben, was Menschen heute glauben. Dies ist vor allem deswegen schwer zu ermitteln, weil sich persönliche Frömmigkeit bzw. persönlicher oder privater Glaube letztlich kaum methodisch überprüfbar rekonstruieren lässt. Auf mehr als Ausschnitte kann man sich in der Regel nicht beziehen. Dennoch will diese kleine Studie in einem ersten Schritt (I.) anhand von ausgewählten – teils zufällig gefundenen – Quellen eine Skizze gegenwärtiger persönlicher Frömmigkeit nachzeichnen:
Im Jahr 2000 hat in Bonn das „Credo-Projekt“ stattgefunden: Menschen im Umfeld der Bonner Schlosskirchen- (also Universitäts-)Gemeinde haben aufgeschrieben, was sie glauben. Die Glaubensbekenntnisse sind zusammen mit einer Analyse und weiteren Dokumenten veröffentlicht worden.
6
Im Rahmen des Kurses „Neu anfangen“ wurden in den Gemeinden, die den Kurs durchgeführt haben, Hefte zusammengestellt, in denen Menschen sich zu ihren Glaubensvorstellungen geäußert haben – also eine Art Testimonials.
7
2015-2017 haben in einer ländlichen Region im Umland von Hannover 118 Gemeindeglieder „Glaubenssplitter“ formuliert.
8
Auf der Internetseite der EKD finden sich die „Top Ten“ oder sogar die „Top Twelve“ der Bibelsprüche für Taufe, Konfirmation und Trauung – auch dies sind gute Hinweise darauf, was Menschen glauben.
9
Aus anderen Quellen werden vergleichbare Äußerungen anlässlich von Beerdigungen ermittelt hinzugezogen.
Im Frühjahr und Sommer 2021 hat die EKD im Rahmen der Arbeit am neuen Gesangbuch nach den Lieblingsliedern gefragt. Was sind das für Lieder und was besagt das Ergebnis dieser Umfrage über den Glauben der Teilnehmenden?
Zu Weihnachten 2021 haben in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung verschiedene Menschen von ihrem Glauben erzählt – zufällig, aber durchaus eindrücklich.
10
Eine letzte Quelle – ob sie den Namen Quelle verdient, sei dahingestellt – ist das Kapitel über die Religion als Resonanzquelle in Hartmut Rosas entsprechender Studie. Insofern, als der Soziologe Rosa herausarbeitet, inwiefern gelebte und erfahrene Religion für alle Menschen eine Resonanzquelle sein kann, erlaube ich mir, die Ausführungen unterstützend zur Rekonstruktion persönlicher Frömmigkeit heranzuziehen.
11
Möglicherweise vermissen kundige Leser:innen die Mitgliedschaftsbefragungen der Kirchenglieder durch die EKD oder andere Umfragen zum Glauben der Menschen durch Forschungsinstitute. Das hat damit zu tun, dass hier Antworten oft vorgegeben waren (z. B. der Glaube an einen persönlichen Gott oder das Leben nach dem Tod). Das aber ist dann m. E. weniger authentisch, als wenn selbst formuliert oder ausgewählt wird.
Anschließend (II.) ist darüber zu reden, welches Image solche persönliche Frömmigkeit (Volksfrömmigkeit12, populäre Religiosität bzw. Leutetheologie13) hat. Zu wohl allen Zeiten hatte sie in Kreisen von Theolog:innen und Kirchenvertreter:innen Kritiker und Gegner. Wenn aus kirchlichen Stellen die Forderung kommt, dass Menschen „im Glauben sprachfähig“14 werden müssten, setzt voraus, dass dort die Auffassung herrscht, die Menschen seien dies nicht. Die Vorstellung, die unausgesprochen hinter solchen Aussagen steht, lautet dann: Die
Menschen haben theologische und sprachliche Defizite, die kirchlicherseits behoben werden müssen. Aber ist das wirklich so?
Ins Theologische gewendet, ist hier von der theologischen Religionskritik zu handeln, namentlich vom scharfen Diktum Karl Barths „Religion ist Unglaube; Religion ist eine Angelegenheit, man muss geradezu sagen: die Angelegenheit des gottlosen Menschen.“15 Diese Religionskritik wird aktuell etwa von Ulrich Körtner reformuliert.16 Insbesondere Spiritualität wird aus der Perspektive einer protestantischen Theologie des Wortes Gottes kritisch hinterfragt.17
M. E. ist bei aller Berechtigung des Drängens auf die Sache des Glaubens der Bogen insofern überspannt, als übersehen wird, dass der Glaube, der sich in gegenwärtigen Glaubensäußerungen von Nicht-Theolog:innen ausspricht, zutiefst biblisch verankert ist: Es ist ein Glaube, der unverkennbar in der biblischen Psalmen-Theologie Parallelen hat. Dies zu zeigen ist Aufgabe des dritten Teils (III.) dieser Studie.
Es folgen abschließend (IV.) Überlegungen, was dies für die praktische Arbeit der Kirchen bedeuten könnte.
1 Rainer Albertz, Frömmigkeit.
2 Vgl. zur Religionsausübung im Exil auch Klaus Grünwaldt, Exil.
3 D. h., einen Gottesnamen enthaltenden.
4 Ob das methodisch einwandfrei ist, sei dahingestellt; immerhin ist erkennbar, dass sowohl der Psalter als auch die Genesis-Erzählungen Überarbeitungen aus Kreisen der „offiziellen Religion“ erfahren haben.
5 Mir ist natürlich bewusst, dass es den Glauben der Menschen nicht gibt. Aus heuristischen Gründen sei der Singular hier aber gestattet.
6 Gotthard Fermor / Reinhard Schmidt-Rost (Hg.), Glaube gefragt. Im Anschluss ist ein weiteres Projekt unter der Überschrift „Mein Paradies“ durchgeführt worden: Gotthard Fermor / Reinhard Schmidt-Rost (Hg.), Mein Paradies.
7 Herrlich bunt, Bad Gandersheim 2002; Wir sind`s, Bad Vilbel 2000; Augenblicke, Oberes Nagoldtal 2001.
8 Evangelische Kirchengemeinden Benthe und Lenthe mit Northen und Everloh, Glaubenssplitter.
9https://www.evangelisch.de/galerien/132113/15-06-2017/taufspruch-die-zehn-beliebtesten-bibelverse;https://www.evangelisch.de/galerien/133496/20-03-2018/kon-fispruch-die-12-beliebtesten-bibelverse-von-konfispruchde;https://www.evangelisch.de/galerien/141672/23-01-2017/trauspruch-12-beliebte-bibelverse-fuer-die-kirchliche-trauung.
10 Simon Benne, Was glauben Sie denn?
11 Hartmut Rosa, Resonanz, 435-453: Die Verheißung der Religion.
12 Vgl. zum Begriff und dessen Problematik Kristian Fechtner, Art. Volksfrömmigkeit.
13 Dieser Begriff scheint in der römisch-katholischen Theologie verwendet zu werden, vgl. Monika Kling-Witzenhausen, Was bewegt Suchende? Allerdings bietet der Band keine systematische Rekonstruktion solcher Theologien, auf die man sich in unserer Fragestellung beziehen könnte. Es werden in der Studie die qualitativen Interviews mit vier Personen ausgewertet. In der Auswertung spielt insbesondere das Suchen, Glauben und Zweifeln eine Rolle, dazu auch das Verhältnis zur Institution Kirche, weniger dagegen die Glaubensvorstellungen. Immerhin sagen drei von vier Personen, sie finden „Kraft bzw. Ruhe in der Natur“, wichtig sei aber auch Gemeinschaft. (ebd. 140)
14 Vgl. das Aktenstück 31 E der 23. Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und der Sache nach das 7. Leuchtfeuer von „Kirche der Freiheit“ – dem Impulspapier der EKD.
15 Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik I/2, 327. Vgl. zu Barths Religionskritik zuletzt Raphaela J. Meyer zu Hörste-Bührer, Religion.
16 Ulrich H. J. Körtner, Gottesglaube, hier insbes. 65-94.
17 Vgl. Ulrich Körtner, Gottesglaube: „… das drängende Problem der Kirchen ist nicht der Mangel an irgendwelcher Spiritualität, sondern die Sprachnot des Glaubens“. (90f)
I. Was Menschen glauben – Konturen eines Gemeindeglaubens bzw. einer Volksfrömmigkeit
„Gott trägt mich, wenn ich krank bin“, schreibt Friederike aus Blankenburg am Harz. Das Bild habe ich in der Ev. Kirche St. Bartholomäus im März 2022 gefunden.
Friederikes Aussage trifft das, was Menschen glauben, ziemlich genau. Gott ist einer, der trägt, beschützt, behütet und begleitet. Darum geht es im ersten Kapitel dieses Buches.
Was glauben die Menschen? Diese Frage ist natürlich in ihrer Allgemeinheit und ihrer umfassenden Weite nicht zu beantworten. Glaube ist ebenso vielfältig wie Menschen vielfältig sind. Trotzdem gibt es Quellen, aus denen man Rückschlüsse auf Glaubensvorstellungen von Menschen ziehen kann.
I.1. Das Bonner Credo-Projekt
So haben sich der Kirchenkreis Bonn und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn in Person ihres Universitätspredigers und Professors für Praktische Theologie Reinhard Schmidt-Rost aufgemacht und „die Bonner“ gefragt, was sie glauben.18 Etwa ein Drittel der insgesamt 114 eingesandten Glaubensbekenntnisse ist veröffentlicht worden19, andere Credos waren im Netz nachzulesen. Reinhard Schmidt-Rost hat die Glaubensbekenntnisse theologisch analysiert.20 Dabei hat er explizit auf die Spannung zwischen persönlicher Überzeugung und gemeinschaftsstiftender Verbindlichkeit, die mit dem Begriff „Glaubensbekenntnis“ angestimmt ist, hingewiesen. Drüber hinaus unterscheidet er zwischen Vertrauen als solchem und Glaubensinhalten.21
Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählt zunächst, dass die Personen, die sich beteiligt haben, die Kompetenz nachgewiesen haben, ein eigenes Credo zu formulieren. Bzw. anders gesagt: Die Auswertenden haben die Zeugnisse, die ihnen übergeben wurden, als kompetente Bekenntnis-Formulierungen wahr- und ernstgenommen.
Als Grundsatz stellt Schmidt-Rost fest: „Als typische inhaltliche Grundmuster lassen sich die direkte Hinwendung und Auseinandersetzung mit Gott und die Suche nach einem Grund des Lebens überhaupt bis hin zur strikten Ablehnung jeder Art von Gottesvorstellung herausarbeiten.“22 Dieser Satz macht zum einen deutlich, dass der Glaube dialogisch ausgerichtet ist, dass er im Gespräch geübt wird und dass er eine Suchbewegung ist. Zum anderen hat der Glaube mit Lebensrelevanz zu tun. Der Glaube soll mir einen festen Boden unter den Füßen vermitteln und in meinem Leben Bedeutung gewinnen. Und schließlich steht die Frage des Gottesbildes überhaupt auf dem Prüfstand: Ist es persönlich oder unpersönlich? Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht?
Dass es (einen) Gott gibt und dass er eine persönliche Größe ist, meinen die meisten derer, die sich beteiligt haben. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung zu ihm/ihr aufgebaut werden kann. Und diese Beziehung drückt sich aus in Dank, Klage und Zweifel. Nicht ganz selten sind hingegen auch unpersönliche Vorstellungen von Gott als Kraft, Energie oder auch Liebe.
Aus naturwissenschaftlicher Perspektive werden Fragen der Möglichkeit einer Gotteserkenntnis formuliert, allerdings auch eine Art „Gottesbeweis“ gewagt.
Reinhard Schmidt-Rost benennt dann noch einmal die Lebensrelevanz des Glaubens als eigenes Thema. Glaube ist immer – zumal als Bekenntnis – persönlich verantworteter Glaube. Der Glaube wird unter Verweis auf die eigene Biografie, und das heißt: in Bezug auf die eigene Glaubenserfahrung, im Kontext des je eigenen Lebens formuliert. „Ich glaube, dass Gott an mir und in mir alles so gestaltet hat, dass ich es sinnvoll, nutzbringend und freudebringend anwenden kann.“23
In Bezug auf die Person Jesus Christus spricht Reinhard Schmidt-Rost von einem „quantitativ eher geringen Befund“24. Inhaltlich gilt: „Die Vorstellungen von Christus schildern ihn häufig als Lehrer der Tugend und des rechten Lebens. … Der Gedanke der Erlösung kommt seltener vor“.25 Das heißt, ein Ergebnis des Credo-Projektes ist die Erkenntnis, dass die explizite, traditionelle und auch kirchlich gepredigte Christologie es im Glauben der Menschen heute schwer hat. Es ist Gott, der mir und meinem Leben einen guten Grund gibt. Aber es ist nicht direkt und konkret Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, an dem das Herz der Teilnehmer:innen des Projektes hängt.
I.2. Glaubenssplitter
Diese Tendenz, die vor knapp 20 Jahren vielleicht noch überraschend gewesen sein mag, setzt sich im jüngeren Projekt der „Glaubenssplitter“ fort.
Es kann hier leider keine wissenschaftliche Auswertung der Texte vorgenommen werden – eine solche wäre eine eigene Publikation wert. Immerhin sollen dennoch die Früchte einer gründlicheren Lektüre vorgestellt werden.
Der am häufigsten genannte Ertrag des Glaubens ist nach den Voten aus den Glaubenssplittern die Erfahrung, von Gott behütet und beschützt zu sein bzw. das Gefühl, dass Gott mich (behütend und bewahrend) durch das Leben begleitet. Dieses Gefühl wird sowohl von älteren Menschen beschrieben, die manchmal in längeren Geschichten Ereignisse aus ihrem Leben erzählen, in denen die Erfahrung gemacht wurde, wie Gott ihnen geholfen hat. Genauso ist dies aber auch bei vielen Jugendlichen ein Thema, wenn sie berichten, wo sie selbst, aber auch Freund:innen oder Familienmitglieder Bewahrung erfahren haben. Hin und wieder fällt der Begriff des Schutzengels.
Etwa die Hälfte der Glaubenssplitter thematisiert diese enge Verbindung von Gott und Schutz.
Damit korrespondiert zum einen, dass von vielen Menschen, die sich an dem Projekt beteiligt haben, der erste Artikel des Glaubensbekenntnisses herausgehoben wird. Gott ist Schöpfer, er hat die Welt gemacht, Leben geschenkt und hält die Welt in Ordnung. Dieser Aspekt wird auch von einigen Voten unterstützt, die das Thema Glaube und Naturwissenschaft verhandeln. Dabei kommt ein Aspekt hinzu: Durch Gottes Schöpfersein erfährt die Welt und das Leben in ihr Sinn.
Mit dem Thema Schutz und Behütung korrespondiert dann auch das Thema Dankbarkeit. Menschen erfahren sich als von Gott, vom Leben, von der Natur beschenkt und bereichert und sagen Dank – in eigenen oder aus der Tradition (Bibel, Gesangbuch, neuere Lieder) entliehenen Worten.
Gott und der Glaube an ihn sind auch wichtige Kraftquellen. Manchmal korrespondiert die Erfahrung, von Gott Kraft zur Bewältigung des Lebens bzw. der schweren Zeiten des Lebens geschenkt bekommen zu haben, mit der Wahrnehmung Gottes nicht als Person, sondern als Kraft selbst. Allerdings ist die Zahl der Voten, die Gott nicht-personal fassen, eher klein.
Dem Gott, der mich behütet und mir Kraft gibt, kann ich vertrauen. Dieses Vertrauen tut gut, es entlastet. Und: Gott ist Quelle der Hoffnung – wobei diese Hoffnung eher unkonkret ist: Es ist nicht eine explizite Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Einige Beiträge sprechen davon, dass die Schreiber:innen sich von Gott geliebt fühlen. Angesichts der Bedeutung, die dieses Thema in Theologie und kirchlicher Predigt hat, ist dieses relativ geringe Vorkommen der Vorstellung allerdings sehr erstaunlich.





























