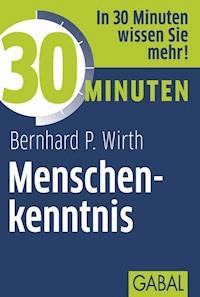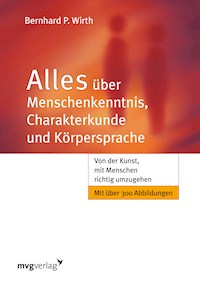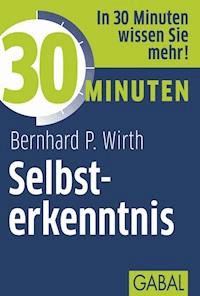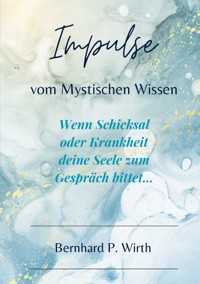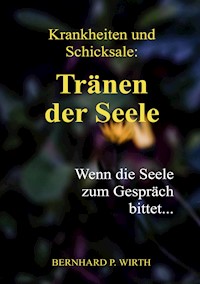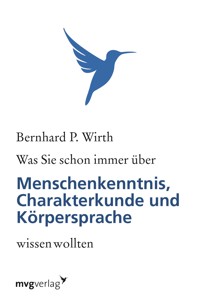
Was Sie schon immer über Menschenkenntnis, Körpersprache und Charakterkunde wissen wollten E-Book
Bernhard P. Wirth
18,99 €
Mehr erfahren.
Die ersten Sekunden sind entscheidend, wenn es darum geht, sich ein erstes Bild von seinem Gegenüber zu machen und selbst einen grundlegenden Eindruck zu hinterlassen. Wer sich und andere besser verstehen und einschätzen will, wird mit diesem Buch in die Tiefen der Menschenkenntnis vordringen. Mithilfe von zahlreichen Zeichnungen und Illustrationen wird hier erklärt, wie man das Erscheinungbild des anderen richtig liest und so ein Gegenüber - und nicht zletzt auch sich selbst - besser einschätzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bernhard P. Wirth
Was Sie schon immer überMenschenkenntnis, Körperspracheund Charakterkundewissen wollten
Dieses Buch ist meinen beiden Kindern Stephanieund Björn gewidmet, von denen ich viel Natürlicheswieder erlernen durfte, das mir als Erwachsenerschon verloren gegangen schien.
Bernhard P. Wirth
Was Sie schon immerüber Menschenkenntnis,Körpersprache undCharakterkundewissen wollten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Nachdruck 2013
1. Auflage 2003 erschienen unter ISBN 3-478-08376-1
Bei diesem Buch handelt es sich um eine gekürzte Ausgabe des Werks Alles über Menschenkenntnis, Körpersprache und Charakterkunde, das ebenfalls im mvgVerlag erschienen ist. Copyright © 2003 Redline GmbH, Frankfurt/M. Ein Unternehmen der Süddeutscher Verlag Hüthig Fachinformationen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: mi, Echter J.
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-86882-418-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-032-6ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-625-0
Weitere Infos zum Thema:
www.mvg-verlag.de
Gerne übersenden wir Ihnen unser aktuelles Verlagsprogramm.
eBook by ePubMATIC.com
Inhaltsverzeichnis
Danke
EinleitungKörpersprache und Charakterkunde oder warum Sie dieses Buch lesen und durcharbeiten sollten
Kapitel 1Menschen sehen und verstehen
Die Körpertypologie
Die drei Körpertypologien
Die vier Temperamente
Menschenkenntnis von Kopf bis Fuß
Die wichtigsten Kopfformen
Unser Gesicht als Visitenkarte
TUN und Wesen, an der Stirne ist’s zu lesen
Was uns die Falten der Stirn mitteilen wollen
Stellungen und Ausdruck der Augen
Die Farbe unserer Augen
Unsere Augenfalten deuten
Was die Ohrenformen verraten
„Man sieht’s ihm an der Nase an.“
Der Mund sagt mehr, als man denkt
Lippen sind nicht nur zum Küssen da
Was das Kinn offenbart
Auf den Hals achten
Unsere Haare als Antennen zur Außenwelt
Die Augenbrauen und ihr bewegtes Dasein
Nicht nur eine Modefrage – der Bart
Wenn Hände sprechen
Die Finger – Symbolik der Lebenseinstellung
Der Mensch im Spiegel seiner Fingernägel
Füße können mehr als laufen
Unsere Stimme, unsere Handschrift und vieles mehr
Unsere Stimme verrät unsere Ängste
Unsere Sprache erzählt über unseren Charakter
Der Mensch und seine Handschrift
Die Astrologie und unsere Tierkreiszeichen
Blutgruppe und Eigenschaften
Unsere Zähne – Rückschlüsse auf unsere Organe
Der Biorhythmus – die Rhythmen des Lebens
Der Mensch und die Farben
Charakterkunde im Alltag
Unser „Revierverhalten“
Was uns Raucher verraten
Autofahren und Lebenseinstellungen
Wie steigen Sie aus Ihrem Auto ein und aus?
Der Mensch, der Stuhl und das Sitzen
Der Händedruck als Schlüssel zum Charakter
Welche Schlafstellung bevorzugen Sie?
Ihre Aktivitäten – TUN
Kapitel 2Körpersprache ist analog
Die ganzheitliche Körpersprache
Körpersprachliche Signale und ihre analoge Deutung
Die Kopfhaltungen und -bewegungen deuten
Die Falten der Stirn – Furchen der Seele
Die Augen – Spiegel der Befindlichkeit
Wenn Blicke „töten“ könnten
Die Nase sagt’s ...
... der Mund verschweigt’s
Was uns das Lachen mitteilen kann
Bitte lächeln!
Ihr Gehen verrät alles
Mit beiden Beinen im Leben stehen
Was die Sitzmanieren mitteilen wollen
Stellungen und Bewegungen der Arme
Was unsere Hände sichtbar machen
Der Händedruck – Ausdruck der Persönlichkeit
Der Finger-Zeig
Über die Schultern geschaut
Der Oberkörper – Ausdruck des Dabeiseins
Eine haarige Angelegenheit
Ihre Aktivitäten – TUN
Kapitel 3Zur Symbolik des Körpers und seiner Organe
Der gesamte Organismus
Von Kopf bis Fuß
Das Abwehrsystem
Das Herz
Blut und Blutkreislauf
Atemwege
Verdauungsorgane
Innere Organe
Drüsen
Geschlechtsorgane
Haut
Muskel-, Binde- und Fettgewebe
Wirbelsäule, Gelenke und Knochen
Das Gehirn
Das Nervensystem
Literaturverzeichnis
Danke
Mein besonderer Dank gilt den Menschen, die sich den Themen Menschenkenntnis und Charakterkunde geöffnet haben und dazu beitragen, dass sich die Flamme um dieses uralte Wissen immer weiter ausdehnt. Danke an Birgit Henkel, Patricia Baier, Annette Scheidacker, Regina Becker, Ramona U. Gerber, Alexander S. Kaufmann und Dietmar Hofmeister, dass ich die Inhalte dieses Buches im täglichen TUN leben und erleben darf.
EinleitungKörpersprache und Charakterkunde oder warum Sie dieses Buch lesen und durcharbeiten sollten
„Man kann einem Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“
(Galileo Galilei)
Diese Grunderfahrung hat wohl jeder von uns irgendwann in seinem bisherigen Leben gemacht: Es verläuft vielerorts anders, als der Einzelne es erwartet hat, sei es in der Partnerschaft, im Berufsalltag oder im persönlichen Bereich. Und das sowohl im positiven, erfreulichen als auch im negativen, schmerzlichen Sinne. Unser Leben kann sich urplötzlich problemlos gestalten, obwohl wir eigentlich mit Konflikten fest gerechnet haben. Unerwartete Schwierigkeiten zeigen sich genau da, wo wir sie am wenigsten vermutet hätten. Hoffnungen zerschlagen sich, für unwahrscheinlich gehaltene Wendungen zum Guten in einer schier ausweglosen Situation treten auf einmal ein. Jeder hat das schon erlebt und auf den ersten Blick scheint es, als wäre das ganz normal, und man braucht sich bei diesen Feststellungen nicht lange aufzuhalten: Unser Leben ist eben so!
Das sieht dann schon etwas anders aus, wenn wir uns fragen, woran es denn liegt, dass „unser Leben eben so ist“, dass sich Erfolg und Misserfolg die Hand reichen, dass auf erfüllte Erwartungen Enttäuschungen folgen, dass womöglich nach Jahren einer glücklichen Partnerschaft der eine wortlos geht? Anders gesagt: In unserem Leben gibt es Momente, in denen wir spüren, wie plötzlich alles, was uns sicher erschien, zu wanken und zu schwanken beginnt und Lebenssituationen, die wir fest im Griff hatten, zerbröckeln.
Hier angekommen, neigen wir schnell dazu, die äußeren Umstände, unsere Mitmenschen oder ein unbegreifliches Schicksal für das Auf und Ab in unserem Leben verantwortlich zu machen. Es gibt Situationen, in denen wir manchmal sogar unfähig sind, unser Glück zu begreifen und es lediglich als Geschenk betrachten.
Bestimmt erinnern Sie sich: Auf seiner einsamen Insel bekam Robinson Crusoe von dem Zeitpunkt an, als Freitag auftauchte, eigentlich erst seine wirklichen Probleme. Sicher wissen Sie auch noch, dass Robinson mit Schuldzuweisungen rasch bei der Hand war und die Schwierigkeiten im Zusammenleben mit Freitag ausschließlich bei diesem suchte! Damit tat unser Schiffbrüchiger nichts anderes als wir oft heute: An vielen Orten unseres Lebens betrachten wir uns nicht als „Spieler“, sondern als „Spielball“ in einem „Spiel“, das hauptsächlich durch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt wird. In der geschilderten Situation können wir jede Verantwortung für die Gestaltung dieser Beziehungen von uns weisen oder uns zumindest bei der Überlegung beruhigen, dass es ja schließlich immer die anderen sind, die ...
Wirklich???
Sind es immer die anderen, denen ich Erfolg oder Misserfolg anlasten kann? Sind es tatsächlich nur die anderen, die für eigene Enttäuschungen in die Pflicht zu nehmen sind? Lag es wirklich nur am anderen, dass Gefühle verstummen?
Wir alle kennen die Situation, in der wir uns darüber beschweren, dass andere nicht hinhören, wenn wir etwas sagen. Vielleicht haben Sie es auch schon einmal im Berufsalltag erlebt, dass Sie der Meinung waren, mit diesem Kollegen einfach „nicht zu können“, weil Sie beim besten Willen „den Draht“ zu ihm nicht finden konnten. Jedenfalls war das Ihre Meinung. Und so oder so hat vielleicht der eine oder andere die folgende Geschichte schon selber erlebt: Die bisherigen Nachbarn sind plötzlich ausgezogen. Sie haben sich gut mit ihnen verstanden. Waren sie im Urlaub, gossen Sie ihre Blumen, waren Sie für längere Zeit abwesend, haben sie Ihre Katze gefüttert.
In der leer stehenden Wohnung gegenüber tat sich zunächst nichts, bis plötzlich ein neues Namensschild an der Tür hing. Hier musste also jemand in aller Stille eingezogen sein, jedenfalls hatten Sie nichts bemerkt und begannen, neugierig zu werden. Endlich begegnen Sie einem jungen Mann und irgendwie wirkt er auf Sie verschlossen und wenig mitteilsam. Ihre Gespräche beschränken sich aufs Wetter oder den Austausch unverbindlicher Höflichkeiten. Mit der Zeit gibt Ihnen das Rätsel auf und Sie beginnen ihm womöglich Unnahbarkeit, ein ungeselliges Wesen oder Kontaktschwierigkeiten zu unterstellen. Es wird nicht mehr lange dauern und Sie kommen zu der Überzeugung:
„D e r“
ist aber komisch. Damit haben Sie eigentlich alles getan, um den Aufbau einer vernünftigen zwischenmenschlichen Beziehungen von vornherein abzublocken. Von nun an werden Sie mit Ihrem Nachbarn nicht so umgehen, wie er wirklich ist, sondern schieben zwischen sich und ihn immer das Bild, das Sie sich von ihm im Laufe der Zeit gemacht haben.
Bislang freuten Sie sich auf morgendliche Begegnungen und tolerierten es, wenn die Hausordnung erst drei Tage später gemacht wurde. Man sprach über das Tagesgeschehen, die Wichtigtuerei des Hausmeisters und lachte ihn gemeinsam heimlich aus. Sie fühlten sich wohl in Ihrem Haus. Und jetzt: Sie lauschen auf jedes Geräusch aus der Wohnung gegenüber, lassen Ihre Schuhe nicht mehr wie gewohnt vor der Wohnungstür stehen und haben angesichts Ihres bevorstehenden Urlaubs ein Problem mit der Katze. Sie hören sich oft selber sagen, dass früher alles anders war, fühlen sich aber keinesfalls „schuldig“ und suchen die Ursachen für Ihr Unwohlsein beim Nachbarn. Sie glauben, ihn beurteilen zu können, schließlich haben Sie ja Menschenkenntnis.
Mit dieser Behauptung stehen Sie nicht allein. Menschenkenntnis – wer behauptet wohl nicht, sie zu haben. Schließlich ist das eine einfache Kunst, das haben Sie vielleicht schon mal bei dem berühmten Philosophen und Mathematiker Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) gelesen und der musste es wissen. Man sagt ihm nach, mit beiden Beinen im Leben gestanden zu haben.
Nun kann es sein, dass Sie dabei einen kleinen Nebensatz überlesen haben. Lichtenberg sagt sinngemäß nämlich auch, dass Selbsterkenntnis die Voraussetzung von Menschenkenntnis sei. Für den berühmten Zeitgenossen und Berufskollegen Lichtenbergs, Immanuel Kant (1724–1804), ist wahre Philosophie übrigens nichts anderes als praktische Menschenkenntnis.
Die Frage nach dem eigenen Ich ist eine der ältesten Fragen der Menschheit und sie wurde in den unterschiedlichsten Versionen gestellt. Heute lautet sie: „Wer bin ich wirklich?“ Sie ist die vielleicht zentralste aller Fragen. Von ihrer Beantwortung hängt es für mich ab, ob ich mich im Spannungsfeld der zwischenmenschlichen Beziehungen als „Spieler“ oder „Ball“ bewege.
Wenn Sie sich bemühen, den manchmal verborgenen Sinn und Nutzen Ihres eigenen Verhaltens, die Symbolik Ihres Körpers, die Mimik und Gestik Ihrer Bewegungen, Ihre Sprache und Ihre seelische Befindlichkeit zu verstehen, wenn Sie erkannt haben, wer Sie selber sind und das für sich anerkennen, werden Sie dieses Verständnis auch zum Maßstab im Umgang mit Ihren Mitmenschen machen und sie akzeptieren. Wenn Sie wissen, wie andere ihre Welt erleben, wie sie von dieser Welt wahrgenommen werden und sich in ihr einrichten, werden Sie andere besser verstehen und mit ihnen umgehen können. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie mit sich selbst besser auskommen.
Dahinter verbirgt sich wieder die Frage: „Wer bin ich wirklich?“ Niemand kann diese Frage für Sie beantworten, das müssen Sie selber TUN! Kein Arzt der Welt wird es schaffen, Ihnen von heute auf morgen z. B. das Rauchen abzugewöhnen. Den notwendigen Willen hierfür müssen Sie selber aufbringen, ein Mediziner oder Therapeut kann Ihnen dabei nur hilfreich zur Seite stehen. So versteht sich auch das vorliegende Buch, das Sie gerade in Händen halten und zu lesen begonnen haben:
S i e
sind sein eigentliches Thema und es will Ihr lebenslanger Begleiter immer dann sein, wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen. Wenn Sie an sich erkannt haben, dass Sie rasch für neue Herausforderungen zu begeistern sind, weil Sie ein sanguinischer Typ sind und sich bislang über einen Mitmenschen wunderten, der diese Begeisterung mit Ihnen nicht teilen konnte und Problemen mit Grübeleien und Pessimismus begegnete, werden Sie das in Zukunft vielleicht anders sehen. Ihrer Verwunderung oder gar Ablehnung steht nun die Einsicht gegenüber, dass die Welt nicht nur aus Sanguinikern, sondern auch aus Melancholikern besteht.
Diese Einteilung – sie kennt neben diesen zwei Typen noch den Choleriker und Phlegmatiker – stellt keine willkürliche Erfindung dar. Sie ist über 2400 Jahre alt und geht auf den griechischen Arzt Hippokrates (um 460-um 377 v. Chr.) zurück. Seine Lehre von den vier Temperamenten stellt den vier Grundelementen Luft, Wasser, Feuer und Erde vier menschliche Temperamente gegenüber, die in Folge unterschiedlicher Mischung verschiedener Körpersäfte zustande kommen sollen.
Aristoteles (384–322 v. Chr.) übernahm diese Auffassung, meinte aber, dass der Beschaffenheit des Blutes eine besondere Bedeutung bei der Ausbildung des menschlichen Charakters zukommt. So beschrieb er dann den Sanguiniker als Leichtblütigen, den Choleriker als Heißblütigen, den Phlegmatiker als Kaltblütigen und den Melancholiker als Schwerblütigen. In der Antike wird später diese Lehre nochmals bei Galen (129–199 n. Chr.) eine Rolle spielen.
Sicherlich wird heute die Behauptung des kausalen Zusammenhangs zwischen bestimmten „Körpersäften“ und jeweiligen menschlichen Charakteren niemand mehr teilen wollen. Geblieben ist aber die dieser Auffassung zu Grunde liegende Idee, wonach das Temperament, der Charakter eines Menschen und seine Körperlichkeit in einem Zusammenhang stehen.
Die Lehre von den Körpersäften der Griechen unterliegt eine Analogie, eine Entsprechung. Blut z.B. stand als Symbol des Lebens und der Lebenskraft. Sanguinisch bedeutet „aus Blut bestehend, lebensvoll“. Diese Lebensfülle beinhaltet Heiterkeit, Optimismus, ein gesundes Selbstwertgefühl sowie eine unkomplizierte Lebensphilosophie. Was steht dem entgegen, auch heute noch Menschen, an denen man vorwiegend diese Eigenschaften bemerkt und deren Auswirkungen auf ihr Denken und Handeln erfahren kann, als Sanguiniker zu bezeichnen?
Wichtige Anregungen verdanke ich der Typenlehre des Tübinger Psychiaters Ernst Kretschmer (1888–1964). Ich teile seine Grundauffassung, dass das äußere Erscheinungsbild eines Menschen mit seinen individuellen Eigenschaften zusammenhängt bzw. dass sich der Charakter eines Menschen durchaus auch in seinem äußeren Erscheinungsbild widerspiegelt. Ich habe immer versucht, diese Erkenntnis in meinem Verständnis von Menschenkenntnis anzuwenden.
Ich will zwar nicht behaupten, dass z.B. die „Stupsnase“ zwangsläufig einen gesunden Menschenverstand nach sich ziehen muss. Vielmehr machte ich in meinem bisherigen Leben und hier insbesondere über meine Tätigkeit als Trainer die Erfahrung, dass ich für Menschen mit einer Vielzahl gemeinsamer Eigenschaften auch grundlegende gemeinsame Merkmale an ihrem äußeren Erscheinungsbild konstatieren konnte. Von hier aus unternahm ich dann den Schritt, vom Erscheinungsbild auf den Charakter zu schließen, um dann feststellen zu können, dass in der Tat Charakterzüge dem äußeren Bild eines Menschen entsprechen. Diese Beobachtung machte ich an Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen: neben Variationen in ihrem charakterlichen Verhalten konnte ich immer eine Reihe wiederkehrender, beständiger oder überwiegender Eigenschaften feststellen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf den Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung (1875–1961) aufmerksam machen. Die im heutigen Sprachgebrauch und auch in meinem Buch häufig anzutreffenden Formulierungen vom Introvertierten und Extrovertierten gehen auf seine Forschungen zurück, in deren Ergebnis er diese beiden gegensätzlichen Menschentypen herausstellte. Nun war Jung weit davon entfernt zu behaupten, dass Menschen entweder ausschließlich extrovertiert oder introvertiert seien. Jeder Mensch hat Elemente von beiden im sich. Erst das Überwiegen des einen „Mechanismus“ über den anderen macht den jeweiligen Typ aus.
Diesem Gedanken unterliegt die Anerkennung des Gesetzes der Polarität, welches in meinem Buch mehrfach herausgestellt und angewandt wird. Aus diesem Blickwinkel heraus gilt für mich hinsichtlich der Feststellung einer menschlichen Charaktereigenschaft immer das gleichzeitige Mitdenken ihres Gegenteils. Angesichts unterschiedlicher Lebenssituationen kann ich für einen Menschen nicht behaupten, dass er ausschließlich ehrlich und offen ist. Auch der vermeintlich offenherzigste Charakter kann einmal verschlossen sein. Das will ich nie aus den Augen verlieren, wenn ich von jemandem behaupte, er habe einen aufrichtigen Charakter. Auch hier überwiegt eine Eigenschaft eine andere und bedingt so einen Grundcharakter.
Die Anregungen, Hinweise und Mitteilungen zum Thema Menschenkenntnis, die ich bisher erfahren und annehmen konnte, sind so vielfältig, dass ich sie hier im Einzelnen nicht nennen kann. Im Zusammenhang mit meinen Ausführungen zur Graphologie will ich jedoch darauf verweisen, dass deren Feststellungen nicht von ungefähr kommen. Graphologie ist eine Methode der angewandten Psychologie und als solche habe ich sie in meinem Buch unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen zum Tragen kommen lassen. Hierbei galt für mich immer bindend, was bereits vor über 200 Jahren sinngemäß Johann Kaspar Lavater (1741–1801) meinte, als er schrieb, dass sich nicht der ganze Charakter und nicht alle Charaktere, aber von manchen Charakteren viel und von einigen wenig aus der bloßen Handschrift erkennen lässt.
Das Thema Körpersprache hat heute einen großen Stellenwert und verfügt dem gemäß über eine Vielzahl von Literatur, die zum Teil im Quellenverzeichnis zu diesem Buch wiederzufinden ist. Dass ich das gesamte Instrumentarium der Möglichkeiten körpersprachlicher Äußerungen nicht erfassen konnte, versteht sich von selbst. Vielmehr war ich bemüht, Ihnen Grundarten menschlicher Gestik und Mimik vorzustellen, deren analoge Deutung ich zum großen Teil einer Vielzahl von Begegnungen mit anderen Menschen verdanke. Dabei war es für mich wichtig, Körpersprache nicht nur als Ausdruck momentaner Situationsbewältigung darzustellen, sondern nonverbale Signale auch als Widerspiegelung grundlegender menschlicher Eigenschaften zu verstehen.
Kapitel 1
Menschen sehen und verstehen
„Der Körper, der Übersetzer der Seele ins Sichtbare ...“
(Christian Morgenstern)
Die Körpertypologie
Unter dem Titel „Körperbau und Charakter“ stellte 1921 zum ersten Mal der Tübinger Psychiater Ernst Kretschmer (1888–1964) seine bis dahin gemachten Beobachtungen zum Zusammenhang von Körperbau und seelischer Struktur eines Menschen der Öffentlichkeit in Buchform vor. Seine Lehre von den „Konstitutionstypen“ (lat. constitutio: Beschaffenheit) war das Ergebnis jahrelanger klinischer Beobachtungen. Eine seiner wohl wichtigsten Schlussfolgerungen ist, dass das äußere Erscheinungsbild meiner Mitmenschen wie auch mein eigenes Aussehen in einem Zusammenhang mit unseren individuellen Eigenschaften stehen und nicht zufällig sind. Kretschmer macht für diese Tatsache die Vererbung von Veranlagungen verantwortlich.
Eine weitere Betrachtungsweise ist die so genannte Lehre von den Temperamenten, die auf den griechischen Arzt Hippokrates (um 460 – um 377 v. Chr.) zurückgeht. Die Idee dieser Lehre besteht darin, dass das Temperament eines Menschen körperlich bedingt ist. Aristoteles (384–322 v. Chr.), auch Grieche und Philosoph, hat sie übernommen und ergänzt. Für ihn kommt der Beschaffenheit des Blutes eine besondere Bedeutung bei der Bildung des Charakters zu. Er unterschied den Sanguiniker (den Leichtblütigen), den Choleriker (den Heißblütigen), den Phlegmatiker (den Kaltblütigen) und den Melancholiker (den Schwerblütigen). Wenngleich die diesen Ideen zu Grunde liegende Lehre von den „Körpersäften“ heute keine Rolle mehr spielt, hat die Einteilung in die genannten vier Typen noch Geltung.
Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung (1875–1961) fand bei seinen umfangreichen Forschungen zwei äußerst gegensätzliche Menschentypen: den Extrovertierten (der nach außen gewendete Mensch) und den Introvertierten (der nach innen gewendete Mensch) und bemerkte hierzu sinngemäß, dass jeder Mensch beide Mechanismen besitzt, sowohl das der Extroversion als das der Introversion und nur das relative Überwiegen des einen oder des anderen den Typus ausmacht. Der extrovertierte Mensch zeichnet sich u.a. durch erfolgsorientiertes Denken und Handeln, Zielstrebigkeit und Kontaktfreudigkeit aus. Der Introvertierte hingegen bevorzugt die Einsamkeit, die Stille, mag keine größeren Veränderungen in seinem Leben und gestaltet es sehr selbstbezogen.
Neben dieser Zweiteilung stammt von Jung noch die Einteilung nach so genannten Funktionstypen. Hier kennt Jung den Gefühlstyp (sein Denken und Handeln nimmt seinen Anfang ausschließlich beim Gefühl), den intuitiven Typ (sein Handeln ist nicht das Ergebnis eines vorangegangenen systematischen Denkens, sondern vollzieht sich aus einem situationsgebundenen Erfassen der Wirklichkeit heraus), den Denkertyp (sein Handlungsmuster wird von sachlichem und logischem Denken beherrscht) und den Empfindungstyp (er lehnt die verstandesmäßige Durchdringung der Welt für sich ab und baut auf seine Sinnlichkeit). Im Einzelnen soll auf diese unterschiedlichen Typenlehren – von denen es noch mehr gibt – hier nicht eingegangen werden. Wir beschränken uns auf die Lehre von den Körpertypologien und die der Temperamente, aus denen wir viele wichtige Einsichten darüber gewinnen können, wie wir am besten mit uns selbst und anderen umgehen.
Die drei Körpertypologien
oder „... von der Art, das Innere des Menschen am Äußeren zu erkennen.“
(Immanuel Kant)
Der schlankwüchsige oder leptosome Körperbautyp
Schlankwüchsige Menschen bewegen sich in der Regel in einem Gefühlsmuster, das zwischen den Polen Überempfindlichkeit und emotionaler Kühle festgemacht werden kann. Wir sollten uns daher nicht wundern, wenn diese Menschen auf eine Reihe von Ereignissen in ihrem Leben äußerst sensibel reagieren, während sie andererseits Problemen ihrer Mitmenschen manchmal fassungslos gegenüberstehen.