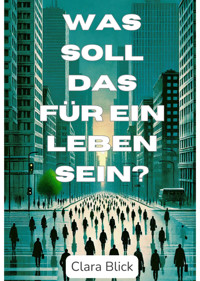
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: selfpublished
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gefangen im Hamsterrad – warum eigentlich? Wir hetzen durchs Leben, gefangen in Routinen und scheinbar endlosen Verpflichtungen, im ständigen Streben nach „mehr“. Doch was bringt uns das wirklich? Dieses Buch lädt dich ein, genau hinzusehen. Ist unser Alltag wirklich das, was wir unter einem erfüllten Leben verstehen? Oder betäuben wir uns mit Konsum und Komfort, während unsere Freiheit und Echtheit auf der Strecke bleiben? Mit einem schonungslosen Blick auf die Illusionen der modernen Welt, die versprochene Sicherheit und das „gute Leben“, das uns verkauft wird, stellt dieses Buch alles in Frage, was uns als selbstverständlich erscheint. Es geht um uns – unsere Entscheidungen, unsere Verantwortung und die Welt, die wir hinterlassen. Bist du bereit, die Komfortzone zu verlassen? Bereit, die eigenen Werte neu zu überdenken und einen klaren Blick auf das Wesentliche zu wagen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
IMPRESSUMWas soll das denn für ein Leben sein?
Texte und Umschlaggestaltung (Bild von KI):
Clara Blick, Wohnort Berlin Vertrieb: Selbstveröffentlichung
Creative Commons Lizenz:Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz (CC BY-NC 4.0). Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Nutzungshinweise:Sie dürfen dieses Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen sowie Abwandlungen oder Bearbeitungen des Werkes vornehmen, solange Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers nennen und das Werk oder dessen Abwandlungen nicht kommerziell nutzen.
KI-Unterstützung:Dieses Werk wurde unter Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz erstellt. Der Autor hat die Inhalte bereitgestellt, während die KI bei der Strukturierung und Formulierung unterstützt hat.
Haftungsausschluss:Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert und überprüft. Trotz der Nutzung von KI-Technologie und menschlicher Überprüfung können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Inhalte.
Berlin, 3.11.2024
Einleitung
Was soll das für ein Leben sein? Diese Frage stellt sich immer drängender. Wir leben in einer Welt des Überflusses, in der Konsum als Königsweg zum Glück gilt und die Jagd nach dem Neuesten, dem Schnellsten, dem Besten den Takt unseres Alltags bestimmt. Aber fühlen wir uns wirklich erfüllt, wenn wir all dem hinterherjagen? Finden wir das, wonach wir suchen, oder entfernen wir uns nicht viel mehr von uns selbst und voneinander?
Wir sind gefangen in einem Kreislauf, der uns vorgaukelt, dass mehr Besitz auch mehr Wert verleiht. Doch während unsere Schränke, Speicher und Köpfe immer voller werden, bleibt der wahre innere Wert auf der Strecke – und mit ihm das Gefühl von Erfüllung. Die Eintönigkeit des modernen Lebens, geprägt von Routinen und ständiger Beschleunigung, lässt uns oft vergessen, dass wir die Freiheit haben, anders zu leben. Schlimmer noch: Wir werden gleichgültig, verlieren die Fähigkeit, uns für die Dinge zu begeistern, die uns wirklich berühren, verlieren die Fähigkeit zu hinterfragen und verschließen uns vor unserer eigenen Authentizität.
Es wird immer klarer, dass unsere Lebensweise an einem kritischen Punkt angekommen ist. Wir können so weitermachen wie bisher und riskieren damit, dass unsere Erde und die Gesellschaften, die wir aufgebaut haben, weiter Schaden nehmen.
Oder wir denken um.
Dieser Umbruch beginnt nicht irgendwo weit entfernt in Politik oder Wirtschaft – er beginnt bei uns, im Kleinen, in unserem alltäglichen Handeln. Es geht um unsere Leidenschaft und unsere Authentizität. Die Frage ist: Sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen und mit kleinen, aber bedeutsamen Schritten in eine nachhaltigere Zukunft zu gehen? Sind wir bereit, uns neu auszurichten und eine andere Richtung einzuschlagen?
Dies ist kein Plädoyer gegen den Fortschritt, sondern für ein neues Bewusstsein im Umgang mit dem, was wir haben und was wir wirklich brauchen. Ein Aufruf, unsere Freiheit zu nutzen, um uns selbst und unsere Welt zu gestalten – mit Bedacht, mit Herz und mit Verstand.
Gesellschaftliche Monotonie
Ich verabscheue Menschen, die sich mit allem zufrieden geben. Die sagen: „Du wirst dich schon daran gewöhnen.“
Eine Resignation.
Dieses „Gewöhnen“ ist der Tod des Geistes, der Anfang einer endlosen Spirale der Eintönigkeit, die uns in ein Leben ohne echte Höhepunkte und Tiefen zwingt. Ein Leben, in dem wir uns in Routinen und Gewohnheiten verlieren, statt zu erleben, wie das Leben sein kann, in seiner ganzen Spontaneität, Fülle und Lebendigkeit, die uns fordert und inspiriert.
Vielleicht ist es nur meine subjektive Wahrnehmung, eine Entwicklung, die mit dem Älterwerden einhergeht. Doch ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sich eine gesunde Gesellschaft so anfühlen sollte. Es scheint vielmehr, als wäre etwas Grundlegendes ins Wanken geraten – als ob die ständige Anpassung an Routinen und Erwartungen nicht nur das Individuum, sondern die ganze Gesellschaft in eine Trägheit gestürzt hat. Die Lebendigkeit, die wir als Menschen spüren sollten, scheint immer mehr einem blassen Funktionieren zu weichen.
Dieser Rhythmus, dieses ständige Wiederholen der gleichen Abläufe, wird für viele zur Norm. Die Tage verschwimmen ineinander, die Wochen vergehen, und oft merken wir kaum, wie die Zeit an uns vorbeizieht. Wir sind so sehr mit dem Überleben im Alltag beschäftigt, dass wir selten innehalten, um zu fragen, ob wir uns in dieser Routine wirklich wohlfühlen. Es ist, als wären wir auf Autopilot gestellt, funktionieren einfach, ohne viel nachzudenken.
Gerade in Bürojobs habe ich oft das Gefühl, dass jeder Tag sich endlos wiederholt, als würde er identisch zum vorherigen verlaufen. Dieselben Kollegen, die immer wieder dieselben belanglosen Themen aufgreifen. Dieselben Systemfehler, um die man herumarbeitet, weil der Vorgesetzte entweder wegschaut oder die Verantwortung abschiebt. Das tägliche Mittagessen, bei dem die Gespräche kaum über das Oberflächliche hinausgehen oder in tratschenden Monologen enden. Und dann diese absurden Begriffe wie #Bergfest am Mittwoch und der lächerliche 'kleine Freitag' am Donnerstag. Als ob solche Floskeln irgendetwas ändern würden! Für mich ist das die offensichtliche Kapitulation vor der Monotonie, ein verzweifelter Versuch, dem eintönigen Alltag ein Quäntchen Freude abzuringen. Ein groteskes Zelebrieren der eigenen Ohnmacht, das uns nur daran erinnert, wie die Woche uns gefangen hält.
Jeden Morgen beginnt der Tag auf dieselbe Weise: Der Wecker klingelt, oft noch in der Dunkelheit, und reißt uns aus dem Schlaf. Halb wach stolpern wir ins Badezimmer, duschen schnell, machen uns fertig. Das Frühstück – falls es überhaupt dazu kommt – oft eine hastige Angelegenheit. Vielleicht ein Kaffee im Stehen, ein Stück Brot auf die Hand, weil die Zeit schon wieder knapp ist. Dann ab zur Arbeit, ins Büro, in die Werkstatt oder in den Laden. Stundenlang sitzen, stehen, schuften wir, bis der Feierabend naht. Doch auch dieser bietet kaum Zeit zum Durchatmen: Einkaufen, Essen machen, vielleicht noch ein wenig fernsehen oder durch die sozialen Medien scrollen. Für Familien mit Kindern sieht es noch anders aus: Die Verpflichtungen hören nicht mit dem Feierabend auf – Hausaufgaben, Abendessen, Familienorganisation. Oft bleibt kaum Raum für Erholung, bevor man müde ins Bett fällt, nur um am nächsten Tag alles von vorne zu beginnen.
Auch das Wochenende ist oft völlig durchgeplant: Einkaufen, Haushalt, Hobby und für die, die noch Energie haben, vielleicht abendsnoch ausgehen oder feiern. Oft wird dieses Feiern von Alkohol oder Drogen begleitet – ein verzweifelter Versuch, den Druck der Woche loszuwerden.
Am Sonntag danndas „Faulsein“, endlich mal nichts tun! Das Ziel der Woche ist erreicht! Doch der kurze Moment der Ruhe währt nicht lange. Schon am frühen Abend schleicht sich dieses bekannte Ziehen im Bauch ein, weil man genau weiß, dass am nächsten Morgen der Wecker wieder erbarmungslos klingelt.
Viele passen sich an, weil es einfach ist, weil es erwartet wird, und weil wir glauben, dass wir so durch den Tag kommen. Dabei stumpfen wir ab. Unsere Kreativität, unsere Freude und unsere Neugier auf das Leben werden nach und nach gedämpft. Je länger man sich dieser Routine hingibt, desto mehr Energie kostet es, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass alles in Ordnung sei.
Im ständigen Bemühen, alles zu bewältigen und den Erwartungen gerecht zu werden, verlieren wir oft den Blick für das, was wichtig ist. Es ist einfacher, wegzuschauen und zu sagen: ‚Das geht mich nichts an.‘ Wir ziehen uns zurück, werden gleichgültig gegenüber dem, was um uns herum passiert, weil uns die Kraft fehlt, etwas zu verändern. Das Gefühl, ohnehin keinen Unterschied zu machen, lässt uns in die Eintönigkeit des Alltags abgleiten – und dabei verlieren wir unmerklich auch ein Stück von uns selbst.
Manchmal frage ich mich, ob die Monotonie im Arbeitsleben uns allmählich auch im Privatleben erfasst hat – oder ob wir von Natur aus Gewohnheitstiere sind, die sich in ihren Routinen sicherer fühlen. In jedem Fall schaffen wir uns unsere eigenen kleinen Blasen, in denen wir uns einreden, dass alles schon irgendwie gut oder zumindest nicht so schlimm ist. „Anderen geht es noch schlechter!“ In diesen Blasen fühlt sich das Leben sicherer an – es ist eine Art Selbstschutz, um den Anschein von Zufriedenheit zu wahren, auch wenn wir tief im Inneren spüren, dass etwas nicht stimmt.
Die meisten Menschen halten lieber am Bekannten fest, auch wenn es sie unglücklich macht, als sich der Unsicherheit des Neuen zu stellen. Denn es bedeutet, die Komfortzone zu verlassen, sich selbst infrage zu stellen und sich den Herausforderungen des Wandels zu stellen. Es ist einfacher, im gewohnten Trott zu verharren, auch wenn er unsere Kreativität erstickt und uns die Lebendigkeit raubt, als das Risiko einzugehen, etwas Neues zu entdecken – etwas Unbekanntes, das uns zwar herausfordert, aber auch befreien könnte. Und so bleibt man lieber in dieser Blase, die eine trügerische Sicherheit bietet, anstatt sich dem echten Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu stellen. Unser Alltag scheint genau darauf ausgerichtet zu sein: Bequemlichkeit. Nichts tun, keine Risiken eingehen – solange es komfortabel und angenehm bleibt, ohne große Herausforderungen oder Anstrengungen.
Ich bin überzeugt, dass genau diese Bequemlichkeit eine der größten Ursachen für unser Unglück ist. Sich anzustrengen, um etwas Eigenes zu schaffen – sei es ein handgefertigtes Möbelstück, ein geschriebenes Buch, ein sorgfältig gepflegter Garten, ein selbstgekochtes Essen oder ein erfolgreich absolvierter sportlicher Wettkampf – bringt eine Erfüllung, die in bloßer Bequemlichkeit nicht zu finden ist. Es geht um das Tun an sich. In diesen Momenten spüren wir, dass wir nicht nur Konsumenten sind, sondern Gestalter unseres Lebens.
Berufe, in denen Menschen etwas Greifbares und Sinnvolles schaffen, geben oft ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Handwerker, Künstler, Gärtner, Köche oder Schriftsteller – sie alle können am Ende eines Tages auf das schauen, was sie geschaffen haben, und darin einen Sinn finden. Sie sehen und spüren direkt den Wert und die Wirkung ihrer Anstrengungen. Diese Berufe fordern uns heraus, fördern unser Wachstum und geben uns das Gefühl, etwas Bedeutsames erschaffen zu haben.
Im Gegensatz dazu scheint es in vielen Fällen bei der anonymen Arbeit in Fabriken oder großen Unternehmen so, dass Menschen nur für einen winzigen Bruchteil eines Produkts verantwortlich sind. Jeder Handgriff ist standardisiert und in eine riesige Produktionskette eingegliedert. Das fertige Produkt bleibt für den Einzelnen unsichtbar – man sieht nicht, was man geschaffen hat, und spürt nicht, Teil von etwas Ganzem zu sein. Diese Arbeit ermüdet, stumpft ab und nimmt die Freude an der eigenen Leistung.
Ähnlich verhält es sich auch im sozialen Bereich – in Kitas, Schulen, der Pflege oder im medizinischen Umfeld. Diese Berufe bergen ein enormes Potenzial für tiefe Erfüllung, doch der tägliche Druck, bürokratische Hürden und Personalmangel verhindern oft den echten Kontakt. Ein guter Arzt-Patienten-Kontakt kann beispielsweise erheblich zum Heilungsprozess beitragen, doch wie oft bleibt dafür Zeit?
In Kitas und Schulen wird die menschliche Verbindung durch überfüllte Stundenpläne und starre Abläufe erschwert. Erzieher und Lehrer verbringen mehr Zeit mit Organisation als mit persönlicher Zuwendung. In der Pflege sieht es genauso aus: Kaum Zeit für echte Gespräche, alles läuft im Akkord. Doch genau diese zwischenmenschlichen Momente könnten einen riesigen Unterschied machen.
In einem System, das auf Effizienz und reibungslose Abläufe setzt, gehören auch starre Regeln und Entscheidungen dazu, die für alle gleichermaßen gelten. Individualität hat hier keinen Platz. Statt auf die Bedürfnisse und Eigenheiten jedes Einzelnen einzugehen, wird eine Einheitslösung angestrebt, die allen gerecht werden soll, aber letztlich niemanden wirklich zufriedenstellt. So gerät der eigentliche Sinn der Arbeit – die Sinnhaftigkeit im Tun, die Wertschätzung und Anerkennung – zunehmend in den Hintergrund. Man verliert das Gefühl, stark zu sein, etwas zu schaffen, das Selbstvertrauen, das daraus entsteht, dass man wirklich einen Unterschied macht.
In vielen Bereichen unseres Lebens scheint das System darauf ausgelegt zu sein, Gleichförmigkeit zu fördern – besonders auch unsere Arbeit. Wir entscheiden uns zum Beispiel ungefähr mit 14 Jahren für einen Beruf, ohne wirklich abschätzen zu können, was es bedeutet, ein Leben lang zu arbeiten. Der Gedanke, dass diese Entscheidung für das ganze Leben bindend sein soll, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Früher gab es nur wenige Berufe – Bäcker, Schneider, Schuster, Friseur – doch die Möglichkeiten haben sich vertausendfacht. Menschen entwickeln sich weiter, genauso wie ihre Interessen und Fähigkeiten. Doch das System zwingt sie, in starren Bahnen zu verharren, anstatt diese Vielfalt zu nutzen und sich neu zu orientieren.
Es wäre großartig, wenn man im Laufe seines Berufslebens die Chance hätte, den eigenen Weg neu zu gestalten. Warum sollten wir nicht die Möglichkeit haben, 2–3 Mal im Leben unsere Karriere zu ändern? Besonders Berufe, die körperlich oder emotional belastend sind – wie in der Pflege oder im Bauwesen – würden es geradezu notwendig machen, dass Menschen sich nach einer gewissen Zeit umorientieren können. Eine staatlich geförderte Umschulung, die alle 10–15 Jahre angeboten wird, könnte den Arbeitsalltag nicht nur flexibler, sondern auch menschlicher gestalten.
Solche Maßnahmen würden nicht nur die individuelle Zufriedenheit steigern, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden in der Gesellschaft fördern. Denn neue berufliche Perspektiven brechen nicht nur die Monotonie, sie schaffen auch Raum für persönliches Wachstum und Entwicklung.
Veränderung ist möglich, aber sie erfordert Mut und die bewusste Entscheidung, sich nicht in der trügerischen Sicherheit des Bekannten zu verlieren. Monotonie hat nur so viel Macht, wie wir ihr zugestehen. Der Schlüssel liegt darin, neue Wege zu gehen und sich nicht mit dem Status quo zufriedenzugeben.
Es muss nicht gleich ein radikaler Wandel sein – oft reichen kleine Veränderungen, um frischen Wind in unser Leben zu bringen: Ein neues Hobby, ein Gespräch außerhalb der gewohnten Kreise, oder der Schritt, im Berufsleben etwas Neues zu wagen.
Stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der jeder die Freiheit und Möglichkeiten hat, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten – ohne Angst vor Veränderung, sondern mit der Zuversicht, dass das Unbekannte nicht Bedrohung, sondern neue Chancen birgt.
Veränderung verlangt Entschlossenheit und die bewusste Entscheidung, sich nicht in der bequemen Illusion des Bekannten zu verlieren. Es geht darum, sich nicht als passiver Teilnehmer eines Systems zu sehen, sondern als aktiver Gestalter des eigenen Lebens – in einer Welt, die Veränderung braucht, um lebendig und menschlich zu bleiben.
Vielleicht ist es nicht für jeden notwendig, etwas zu verändern, aber es kann hilfreich sein, gelegentlich innezuhalten und zu reflektieren, ob die Routine wirklich erfüllt. Es liegt in unserer eigenen Hand, Möglichkeiten zu entdecken, die mehr Lebendigkeit in unser Leben bringen – kleine Schritte, die uns helfen können, neue Erfahrungen zu machen und vielleicht sogar neue Wege zu gehen. Am Ende ist es die Offenheit für Veränderungen, die uns die Chance gibt, das Leben voller Spontaneität und Vielfalt zu erleben.
Alt und Jung – Erbe und Wandel
Die ältere Generation, die den Krieg und seine verheerenden Folgen miterlebt hat, trägt tiefe seelische Wunden. Krieg, Entbehrungen und Hunger, Kriegsgefangenschaft und der Verlust von Angehörigen prägten diese Menschen nachhaltig. Männer und Frauen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, litten unter Todesangst und wurden von einem tief verwurzelten Überlebensinstinkt getrieben. Nach dem Krieg gab es wenig Raum, um diese Traumata zu verarbeiten. Die Gesellschaft forderte, dass einfach wieder Frieden einkehren sollte – als könnte man das Erlebte vergessen. In einer Zeit, in der man „funktionieren“ musste, gab es wenig Platz für Zuneigung, Empathie oder emotionale Fürsorge. Gewalt und Härte waren oft die Antwort auf die Herausforderungen des Lebens, das diesen Menschen eine Menge abverlangt hatte. Sicherheit und Stabilität wurden zu den höchsten Werten, da sie den Menschen nach Jahren der Unsicherheit und des Chaos ein Gefühl von Kontrolle und Schutz gaben.
So hat die eine Generation die nächste heranwachsende Generation geprägt, indem sie ihre Traumata, oft unbewusst, weitergab. Die Eltern, überfordert von den eigenen seelischen Narben, waren oft nicht in der Lage, ihren Kindern die nötige Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, und so wurde der Schmerz und die Leere an die nächste Generation weitergegeben. In einer Welt, in der ihnen bereits zu viel vom Leben abverlangt wurde, blieb wenig Raum für Zuneigung. So wuchsen die Nachkriegskinder oft in emotionaler Kälte auf – geformt durch strenge Disziplin, aber ohne tiefere emotionale Verbindung.
Es folgte die Generation, die in den 60er und 70er Jahren geboren wurde, die sich im Spannungsfeld zwischen der „alten Schule“ und einem wachsenden Wunsch nach Veränderung befand. Diese Generation erlebte noch die Strenge und die festen Werte ihrer Eltern, doch zugleich spürten sie bereits den beginnenden gesellschaftlichen Aufbruch, der von mehr Individualität und Freiheit geprägt war.
Dann hat sich zunehmend eine Laissez-faire-Haltung in der Erziehung eingeschlichen. Viele Eltern, die ihre Kinder weniger unter Druck setzen wollten als ihre eigenen Eltern es taten, entwickelten einen entspannteren Erziehungsstil. Doch mit dieser Freiheit kam auch in einigen Familien eine gewisse Nachlässigkeit. Der Bildschirm – zunächst der Fernseher, später Handy, Tablet und Computer – wurde immer öfter zum Babysitter. Dies galt natürlich nicht für alle, aber der Trend war stark genug, um spürbare gesellschaftliche Auswirkungen zu haben.
Anstatt Werte und Lebensprinzipien bewusst zu vermitteln, überließen viele Eltern die Erziehung zunehmend den Medien. Die digitale Welt, die sich in rasantem Tempo entwickelte, bot einerseits Zugang zu Wissen und Unterhaltung, aber sie entfremdete Kinder auch zunehmend von realen sozialen Interaktionen und familiären Bindungen. Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche im Durchschnitt viele Stunden täglich vor Bildschirmen verbringen, was die Zeit für persönliche Interaktionen reduziert. Eine US-Studie der „Common Sense Media“ von 2019 ergab, dass Kinder zwischen 8 und 12 Jahren durchschnittlich fast fünf Stunden täglich mit digitalen Medien verbrachten, Jugendliche sogar über sieben Stunden – und das ohne schulische Aktivitäten.
Die jüngere Generation, geprägt von der technisierten Welt und den Bildschirmen, erlebte eine ganz andere Form der Verwahrlosung – eine Art digitale Isolation.





























