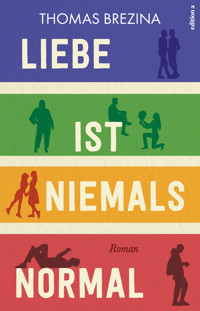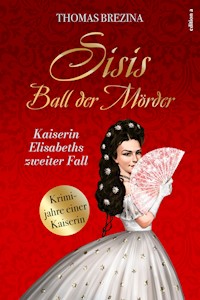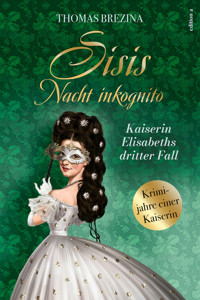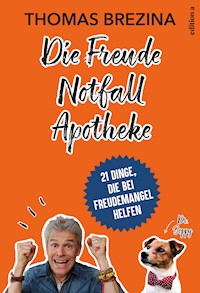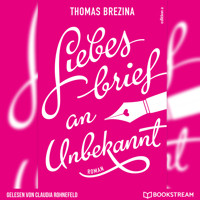Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wissen Sie, was der Sinn Ihres Lebens ist?«, fragte ich den Mann. »Klar«, sagte er. »Komm in unsere Bar, dann verrate ich es dir.« »Wo liegt die Bar?«, fragte ich. »Am Strand der Wünsche.« Eine Reise auf der Suche nach neuen Perspektiven führt auf eine ferne Insel und zu überraschenden Begegnungen. Eine philosophische Erzählung von Erfolgsautor Thomas Brezina anlässlich seines 60. Geburtstags Lebensweisheiten über die großen Fragen, die so viele Menschen sich stellen: Worum geht es im Leben und was will ich wirklich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Brezina:Was soll ich mir wünschen,wenn ich nicht weiß, was ich will?
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 edition a, Wienwww.edition-a.at
Lektorat: Maximilian HauptmannCover & Illustrationen: Feli ThunSatz: Lucas Reisigl
Gesetzt in der PremieraGedruckt in Europa
1 2 3 4 5 — 27 26 25 24 23
ISBN 978-3-99001-634-3eISBN 978-3-99001-635-0
Thomas Brezina
WAS SOLL ICH MIR WÜNSCHEN
… WENN ICH NICHT WEISS, WAS ICH WILL?
Eine Erzählung
Was soll ich mir wünschen,wenn ich nicht weiß, was ich will?
Wie soll ich mich fühlen,wenn ich nicht weiß, wer ich bin?
Wie soll ich leben,wenn ich nicht weiß,was der Sinn meines Lebens ist?
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
NACHWORT
1
Als ich im strömenden Regen aus dem Taxi stieg und innerhalb von Sekunden bis auf die Haut durchnässt war, verfluchte ich alles, was ich jemals über „erfolgreiches Wünschen“ und „Lebe deinen Traum!“ gehört hatte.
Wunschträume sollten mit einer Bedienungsanleitung kommen, die Warnhinweise enthält, dachte ich grimmig. Oder mit einer Packungsbeilage wie Medikamente, in der auf unerwünschte Nebenwirkungen aufmerksam gemacht wird.
Ich hatte seit Jahren einen großen Traum.
Jeden Tag hatte ich mir ausgemalt, wie wunderbar ich mich fühlen würde, ginge er erst in Erfüllung. Ich visualisierte den Traum, wie das in der Sprache der Lebenshelfer so schön heißt.
Nun war es so weit. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Und Stück für Stück verwandelte er sich in den größten Albtraum meines Lebens.
Hinter mir lagen mehr als 34 Stunden Flug. Die meiste Zeit war ich eingequetscht zwischen Leuten gesessen, die besser zwei Sitze hätten buchen sollen, schreienden Babys und einem Herrn, der unter heftigen Blähungen litt, was für alle deutlich zu riechen war.
Vor mir lag nun die letzte Etappe meiner Reise: ein Flug in einer sicherlich erschreckend kleinen Maschine zu der Insel, auf die ich mittlerweile gar nicht mehr wollte.
Der Fahrer des Taxis, das mich zu dem kleinen Flughafen gebracht hatte, war im Wagen sitzen geblieben und hatte es mir überlassen, mein Gepäck aus dem Kofferraum zu hieven. Geduckt, den Kopf zwischen den Schultern eingezogen, legte ich die paar Meter zu einem flachen Gebäude zurück. Hinter mir hörte ich das Taxi davonfahren.
Es war früher Abend, aber bereits stockfinster. Neben dem Eingang brannte eine einsame Lampe. Zum Glück gab es ein Vordach, unter dem ich ein wenig Schutz vor dem Regen fand. Die Tropfen hatten die Größe von Pingpongbällen. Ich zog die Tür auf und betrat das Gebäude.
Der kahle Raum vor mir wurde von ein paar Neonröhren mehr schlecht als recht erhellt. Eine Reihe von Plastikstühlen stand auf einer Seite, an der Wand hing schief das Logo der Insel-Airline. Ich war allein hier.
Laut Buchung sollte der Abflug in einer halben Stunde erfolgen. Ich war die ganze Fahrt im Taxi wie auf Nadeln gesessen, weil ich Angst gehabt hatte, den Flug zu verpassen und einen Tag auf den nächsten warten zu müssen.
Auf der anderen Seite des Raumes befanden sich eine Tür und ein Fenster, das beinahe die gesamte Wand einnahm.
Nachdem ich Koffer und Reisetasche abgestellt hatte, ging ich hin, drückte mich dicht an die Scheibe und schirmte meine Augen mit den Händen ab. Draußen war es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Die Tür war abgesperrt und ließ sich nicht öffnen.
Mir kamen Zweifel, ob ich hier richtig war.
Meine Augen brannten und ich war zum Umfallen müde. Also ließ ich mich auf einen der Stühle sinken und holte mein Handy aus der Schultertasche.
Keine Nachricht. Enttäuscht steckte ich es zurück.
„Ist hier frei?“
Ich sah erschrocken auf.
2
Vor mir stand eine zarte ältere Frau in kurzen Kakihosen und einem blauen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Ihr Gesicht hatte etwas Puppenhaftes. Sie deutete auf die Stühle. „Ist hier frei?“
„Ja, natürlich.“
Sie nickte dankend, nahm ihren Rucksack ab und setzte sich.
„Kommen Sie von draußen?“, fragte ich und deutete zur Eingangstür. Ich hatte nicht gehört, wie sie aufgegangen war.
Sie nickte. Aus ihrem Rucksack zog sie eine Art Decke. Da es schwül im Raum war, verstand ich zuerst nicht, was sie damit vorhatte. Erst als sie sich ein paar bunte Stoffflicken auf die Knie legte und aus einer kleinen Schachtel Nadel und Faden nahm, erkannte ich, dass sie einen Quilt nähte.
„Haben Sie auch die 19:10-Uhr-Maschine gebucht?“, wollte ich wissen.
„Sie meinen den ‚Ungefähr irgendwann nach sieben Uhr‘-Flug?“, antwortete die Frau, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen.
„Auf meinem Ticket steht 19:10 Uhr“, beharrte ich.
„Nehmen Sie das nicht so genau.“
Man hatte mich gewarnt, dass auf den Inseln die Uhren anders gingen.
„Kommt die Maschine also nicht pünktlich?“, hakte ich nach.
„Nie. Heute schon gar nicht. Es regnet zu stark. Aber der Regen hört bestimmt bald auf.“
Wir schwiegen eine Weile. Sie nähte, ich sah ihr dabei zu. Die Stille war mir unangenehm. Aus einem mir unerklärlichen Grund kam mir die Frau bekannt vor.
„Wohnen Sie auf der Insel? Oder besuchen Sie jemanden?“, fragte ich, um das Schweigen zu brechen.
„Keins von beiden.“
Sie erklärte mir nicht, was das bedeuten sollte, und ich wollte nicht allzu neugierig erscheinen. Wieder sagten wir eine Weile nichts.
Die nasse Kleidung klebte an meiner Haut. Deshalb öffnete ich meine Reisetasche und kramte ein T-Shirt und Shorts heraus. Ich ging an einen Platz, an dem mich die Frau nicht sehen konnte, und zog mich schnell um.
„Weshalb besuchen Sie die Insel?“, wollte sie wissen, als ich zurückkam.
„Ich habe ein Haus gemietet. Direkt am Strand. Für sechs Wochen.“
„Allein?“
„Ja, allein.“
„Urlaub?“
„Mehr eine Auszeit“, erklärte ich.
„Wie meinen Sie das?“
„Ich will aus allem raus: meiner gewohnten Umgebung, Arbeit, Freundeskreis, Alltag. Einfach weg und Abstand bekommen.“
Sie nickte. „Ich verstehe. Reisen ist dafür die beste Möglichkeit. Aber wieso wollen Sie aus allem raus?“
„Ich feiere einen runden Geburtstag und will mir Ruhe gönnen. Man kann es auch ‚Abstand von allem‘ nennen. Das ist doch nichts Ungewöhnliches.“
Die Frau unterbrach ihre Arbeit und blickte mich einen Moment lang an. „Sie wissen nicht weiter, nicht wahr?“
Ich öffnete schon den Mund, um zu protestieren, ließ es dann aber bleiben. Man konnte meine Situation durchaus so beschreiben. Mich quälten einige Zweifel. Vor allem aber verspürte ich eine Wut auf alles, was schiefgelaufen war.
Die Frau hielt den Quilt in die Höhe und begutachtete das Quadrat, das sie eingenäht hatte. „Nun etwas Blaues“, sagte sie zu sich und suchte den passenden Flicken. Als sie ihn gefunden hatte, sah sie auf.
„Fühlen Sie sich irgendwie verloren?“, fragte sie.
Das Gespräch wurde mir zu persönlich. Allerdings musste ich mir eingestehen, dass die Frau erneut den Finger auf meinen wunden Punkt gelegt hatte.
Ich hatte genau dieses Gefühl: verloren. Nicht wissend, wohin ich gehen sollte. In den Monaten vor meinem runden Geburtstag hatte ich über mein Leben nachgedacht und einige erschreckende Feststellungen gemacht. Einige meiner Wünsche hatten sich erfüllt. Statt Begeisterung hatte sich in mir allerdings Enttäuschung breitgemacht.
Andere Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen waren, vergrößerten diese Enttäuschung.
Außerdem gab es einige Wünsche, von denen mir klar geworden war, dass sie sich nie erfüllen würden. Wodurch meine Enttäuschung nur noch wuchs.
Auch wenn mir gut meinende Menschen rund um mich immer wieder versicherten, dass ich eine falsche Sicht auf mich und mein Leben hatte, fühlte ich mich als Versager.
An mir gab es, wie ich fand, viel mehr zu kritisieren als zu bewundern.
Um weiteren Fragen auszuweichen, stand ich auf und trat an das Fenster.
„Steht ein Flugzeug dort draußen?“, erkundigte ich mich.
„Natürlich.“
„Wie groß ist der Flieger?“
„Platz für 44 Passagiere und eine Toilette.“
Ich hatte mit einem viel kleineren, wackeligen Ding gerechnet und war erleichtert. Trotzdem holte ich ein Fläschchen aus der Hosentasche und schüttelte mir ein paar weiße Kügelchen in den Mund.
„Was ist das?“, wollte die Frau wissen.
„Ein homöopathisches Medikament gegen Flugangst.“
„Wirkt es?“
„Ich glaube schon.“
„Wie praktisch. Ich hätte es früher öfter gebrauchen können.“
„Haben Sie auch Angst vor dem Fliegen?“
„Nein, nein. Meine Ängste betreffen andere Dinge.“
Ich war neugierig geworden. Leider sprach die Frau nicht weiter. Um sie aus der Reserve zu locken, machte ich ein kleines Geständnis.
„Ich habe auch andere Ängste. Und ich finde sie schrecklich. Mir kommt vor, sie werden immer mehr. Manchmal lähmt mich die Angst.“
„Wissen Sie“, begann sie, „bei der Angst geht es immer darum, dass man aus ihr das Beste macht.“
3
Die Frau unterbrach das Nähen und lehnte sich zurück. „Ich hatte all die Jahre meiner Ehe Angst, mein Mann könnte mich für eine andere Frau verlassen. Eine Frau, die jünger, schöner oder einfach besser wäre als ich.“
Ich kannte eine ähnliche Angst. Ich war zwar nicht verheiratet, trotzdem nagte an mir immer wieder der Gedanke, meine große Liebe könnte eines Tages jemand Besseren finden.
„Was kann man aus dieser Angst machen?“, fragte ich.
„Ich habe darauf geachtet, die beste Partnerin zu sein, die ich sein konnte. In jeder Hinsicht. Ich ließ mich niemals gehen, weder innerlich noch äußerlich. Zuerst handelte ich verkrampft, weil ich meinem Mann ständig gefallen wollte und seine Zustimmung und Bewunderung brauchte. Irgendwann erkannte ich, dass ich alles einfach für mich selbst tun kann. Weil ich es mir wert bin. Mein Mann hat das geschätzt und das Gleiche für sich und mich getan. So konnten wir uns immer wieder neu verlieben.“
„Und natürlich hat Ihr Mann Sie nie verlassen“, fügte ich lächelnd hinzu.
„Doch.“
Das brachte mich etwas aus dem Konzept. Hatte ich die Frau falsch verstanden?
„Aber ich dachte, Sie blieben so füreinander interessant?“, sagte ich.
„Das waren wir auch. Mein Mann hat mich nicht wegen einer anderen Frau verlassen. Er ist bei seiner großen Leidenschaft, dem Klettern, abgestürzt und tödlich verunglückt.“
„Das tut mir sehr leid.“
Sie sah mich an. „Angst ist wie eine Münze. Sie hat zwei Seiten: die lähmende Seite und die Seite, die uns in Bewegung versetzt.“
Sie nahm die Arbeit an ihrem Quilt wieder auf. „Allerdings ist die Angst eine Münze ohne großen Wert. Wir können uns damit ein wenig Vorsicht kaufen, was manchmal ganz gut ist. Aber meistens tritt ohnehin nicht ein, wovor wir uns fürchten. Und wenn es doch geschieht, hat uns die Angst auch nicht davor bewahrt. Angst kostet immer nur Kraft und Zeit.“
„Haben Sie nun keine Ängste mehr?“
„Doch. Aber ich habe den Mut, sie genau anzusehen. Das lässt sie immer kleiner werden und manchmal verschwinden.“
„Das sagt sich einfacher, als es ist“, warf ich ein. „Ich weiß, dass Flugzeuge nur sehr, sehr selten abstürzen. Trotzdem habe ich Angst vor dem Fliegen.“
„Was das Flugzeug zur Insel angeht, kann ich Ihnen zur Beruhigung sagen, dass ich den Flug schon einige Hundert Mal gemacht habe.“
„Einige Hundert Mal?“
Die Frau lachte, als sie mein verdutztes Gesicht sah.
„Ich bin die Pilotin.“
4
„Kommen noch andere Passagiere?“, fragte ich.
Die Frau nickte. „Sie sollten bald eintreffen.“ Sie schloss die Tür auf, die auf das Flugfeld führte.
„Der Regen hat nachgelassen. Ich mache die Maschine startklar.“
„Ich müsste vor dem Einsteigen noch auf die Toilette, aber ich kann hier keine sehen.“
„Einfach einmal um die Ecke.“
Also verließ ich die Baracke und suchte auf beiden Seiten des Gebäudes. Toilette konnte ich keine finden. So kehrte ich zurück und fragte die Pilotin erneut. Sie schlug die Hand vor den Mund.
„Da habe ich mich schlecht ausgedrückt. ‚Um die Ecke, dort sind Büsche‘, wollte ich sagen.“
Als ich ein paar Minuten später zurückkam, waren mein Koffer und meine Tasche nicht mehr da. Die Tür zum Flugfeld stand offen und aus der Dunkelheit leuchtete mir eine Taschenlampe entgegen. Die Pilotin kam über den Rasen auf mich zugelaufen.
„Ihr Gepäck ist verstaut, wir können starten.“
„Die anderen Passagiere …?“
„Kommen Sie, schnell.“ Sie versetzte mir einen leichten Klaps auf den Arm und ging voraus.
„Die erste Reihe ist nur für Sie reserviert“, sagte sie. Der Strahl ihrer Taschenlampe hob die ovale Öffnung des Flugzeugs hervor und verlor sich im dunklen Inneren. „Das Licht funktioniert nicht, wenn die Triebwerke ausgeschaltet sind.“
Ich stieg drei Stufen hoch und ertastete den Weg zu den Sitzen. Ich schob mich auf den Fensterplatz einer Doppelsitzbank in der ersten Reihe und schnallte mich an.