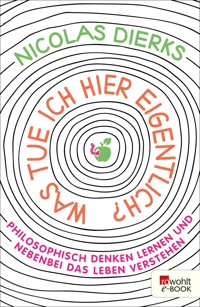
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leben wir unseren Traum oder die Träume anderer? Können wir überhaupt noch etwas mit Sicherheit wissen? Wie folgt man eigentlich seinem Herzen? Belügen wir uns selbst, und wenn ja: Wollen wir damit überhaupt aufhören? Welche Kraft können wir schöpfen, wenn uns der Tod im Leben begegnet? Und warum brauchen wir andere, um wir selbst zu sein? Übersichtlich, humorvoll und anschaulich führt Nicolas Dierks den Leser durch philosophische Fragen, die uns alle betreffen. Dabei geht es ihm nicht nur um die großen philosophischen Traditionen, sondern er lädt uns mithilfe lebensnaher Beispiele ein, uns zu eigenen Gedanken anregen zu lassen – so lernen wir nicht nur die Philosophie besser kennen, sondern auch uns selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nicolas Dierks
Was tue ich hier eigentlich
Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen
Über dieses Buch
Leben wir unseren Traum oder die Träume anderer? Können wir überhaupt noch etwas mit Sicherheit wissen? Wie folgt man eigentlich seinem Herzen? Belügen wir uns selbst, und wenn ja: Wollen wir damit überhaupt aufhören? Welche Kraft können wir schöpfen, wenn uns der Tod im Leben begegnet? Und warum brauchen wir andere, um wir selbst zu sein?
Übersichtlich, humorvoll und anschaulich führt Nicolas Dierks den Leser durch philosophische Fragen, die uns alle betreffen. Dabei geht es ihm nicht nur um die großen philosophischen Traditionen, sondern er lädt uns mithilfe lebensnaher Beispiele ein, uns zu eigenen Gedanken anregen zu lassen – so lernen wir nicht nur die Philosophie besser kennen, sondern auch uns selbst.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Umschlagabbildung: FinePic, München)
ISBN 978-3-644-51771-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für Kirstin
Vorwort
1 Selbsterfindung 4.0 – Wie will ich eigentlich leben?
Warum der Wandel unsere zweite Natur ist
Verantwortung für unsere Gewohnheiten
Das unvollendete Buch des Lebens
Selbsterfindung 4.0
Das eigene Leben überschauen
2 Mit dem Navi durchs Leben – Wie viel Religion will ich?
Mit dem Navi durchs Leben?
Das Erbe einer Verpflichtung?
Wie viel Religion passt ins moderne Leben?
Was sagen uns heilige Texte?
Die Grenzen unseres Wissens in religiösen Dingen
Woher kommt das alles?
Dürfen wir uns unsere eigene Religion basteln?
3 Im Labyrinth der Lebenswelten – Wessen Traum lebe ich?
Eine kurze Geschichte von Traum und Wirklichkeit
Eine jenseitige Welt hinter unserer?
Für wen lohnt sich die Traumjagd?
Lebe ich meinen Traum – oder den eines anderen?
Eingepflanzte Träume
Wie einzigartig wollen wir sein?
Seinen Traum mit Bedacht leben
4 Im Strudel des Zweifels – Was weiß ich wirklich?
Die Weisheit des Skeptizismus
Wem geben wir Autorität über unser Wissen?
Am Fundament des Weltwissens
Woran wir nicht zweifeln können
Ein Besuch beim skeptizistischen Zahnarzt
Sinnvolle Zweifel im Alltag
5 Im Rausch der Ratschläge – Wie höre ich auf mich selbst?
Die Tradition der inneren Suche
Die Stimme der Natur in uns
Wie wir uns selbst in die Irre führen
Tiefer als Verstand und Gefühl
6 Die Wirren des Wandels – Wie bleibe ich dieselbe Person?
Bleiben wir ohne Erinnerung noch dieselbe Person?
Zwei Arten, «ich» zu sagen
Wie es ist, ein Subjekt mit Körper zu sein
7 Die Oase der Illusion – Wie aufrichtig will ich zu mir sein?
Können wir uns selbst überhaupt täuschen?
Was tun Sie hier eigentlich – mal ganz ehrlich?
Das Leben ist doch einfach schön
Die Kraft der Illusion
Multiple Skalen des Selbstwertgefühls
8 Weckruf zur Weisheit – Wie will ich gelebt haben?
Kann man das Sterben lernen?
Formen des Todesbewusstseins
Todesbewusstsein als Weckruf im Leben
9 Warum brauchen wir andere, um wir selbst zu sein?
Warum wir immer miteinander leben
Leben in der Gemeinschaft freier Wesen
Zur weiteren Lektüre
1 Selbsterfindung 4.0 – Wie will ich eigentlich leben?
2 Mit dem Navi durchs Leben – Wie viel Religion will ich?
3 Im Labyrinth der Lebenswelten – Wessen Traum lebe ich?
4 Im Strudel des Zweifels – Was weiß ich wirklich?
5 Im Rausch der Ratschläge – Wie höre ich auf mich selbst?
6 Die Wirren des Wandels – Wie bleibe ich dieselbe Person?
7 Die Oase der Illusion – Wie aufrichtig will ich zu mir sein?
8 Weckruf zur Weisheit – Wie will ich gelebt haben?
9 Warum brauchen wir andere, um wir selbst zu sein?
Für Kirstin
Vorwort
«Philosophisch denken lernen und nebenbei das Leben verstehen» – soll das wirklich so einfach sein? Und dann noch nebenbei, ohne Anstrengung, quasi en passant? Das wäre eine Sensation – oder ist die Formulierung reine Verkaufsmasche? So oder ähnlich haben Sie vielleicht gedacht, als Sie den Untertitel dieses Buches gelesen haben.
Die Formulierung ist jedoch weder philosophischem Größenwahn noch einer Marketingstrategie geschuldet, sondern sie soll die Richtung des Buches andeuten: Ich möchte das «Verstehen des Lebens» aus dem philosophischen Elfenbeinturm holen und mit Hilfe der «großen Denker» zum eigenen Nachdenken und Umdenken im Alltag anregen. Denn wir versuchen alle, uns und unser Leben besser zu verstehen – auch wenn wir natürlich wissen, dass wir es nie ein für alle Mal verstanden haben werden.
Es gibt Momente, in denen wir unser Leben durchschauen, in denen wir den Durchblick haben und deshalb besser entscheiden können; in denen unser Handeln für uns Sinn ergibt und wir die passende Antwort auf die Ansprüche finden, die das Leben an uns stellt. Doch wie in Hollywoodfilmen gilt auch hier: Das Happy End ist erst der Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Die Umstände, in denen wir leben, ändern sich, alte Kriterien sind in neuen Phasen plötzlich nicht mehr hilfreich, und wir müssen uns ein neues Verständnis für die Situation erarbeiten. Und wer kann das in der heutigen Zeit, mit Beruf, Familie und Freundeskreis, anders bewerkstelligen als nebenbei?
Ich halte es für außerordentlich nützlich, das «Nebenbei-Philosophieren» zu etablieren, um regelmäßig die konkreten Entscheidungen des Alltags mit Überlegungen über das eigene Leben als Ganzes abzustimmen. Dabei braucht man sich von großen Namen wie Aristoteles, Kant oder Wittgenstein nicht schrecken zu lassen. «Nebenbei das Leben zu verstehen» heißt für mich, zu leben und dabei zu überlegen, was man will, was man tun soll, was man weiß – und was für einen wirklich zählt.
Wir wissen, wie wichtig es ist, sich diese Fragen zu stellen. Und wenn eine Frage gestellt werden kann, dann kann sie prinzipiell auch beantwortet werden. Manchmal stecken wir jedoch so tief in unserer Routine, sind so vom Alltag in Beschlag genommen, dass wir nur noch die ewig selben Fragen stellen und uns mechanisch immer dieselben Antworten darauf geben. Das ist besonders dann kontraproduktiv, wenn eine neue Lebensphase eigentlich ein Aufwachen und Umdenken von uns fordert. So entgehen uns offensichtliche Chancen – dabei kann bereits ein kleiner Impuls unsere ganze Sichtweise auf eine Situation verändern. Machen Sie einmal den folgenden kleinen Test: Wie viele Punkte sehen Sie hier?
Falls Sie auf zwei kommen, haben Sie einen Punkt nicht gezählt. Richtig ist, dass es drei sind. Und dabei spielen optische Täuschungen keine Rolle. Ich meine auch keine Punkte innerhalb der anderen Punkte, vorstellbare weiße Punkte auf dem weißen Papier oder mathematisch mögliche, unendlich kleine Punkte auf der Seite. Ich meine einen dritten Punkt, der eigentlich sehr offensichtlich ist.
Der dritte Punkt ist der Doppelpunkt, der aus den beiden Einzelpunkten besteht. Wenn wir Einzelpunkte und Doppelpunkte als Punkte zählen, dann ist die richtige Antwort «drei». Die Antwort «zwei Punkte» ist übrigens auch richtig – wenn Sie nur Einzelpunkte zulassen. Aber immerhin besteht vieles, mit dem wir täglich zu tun haben, aus mehreren Dingen: Autos oder auch Fußballmannschaften. Und wie über die Banalität des Doppelpunktes kann man häufig darüber stöhnen, dass man etwas nicht erkannt hat, obwohl es eigentlich offensichtlich war.
Sie selbst haben sicherlich schon erlebt, wie erbittert Menschen darüber streiten können, wer von ihnen eine Situation richtig beurteilt. Manchmal ist das so, als ob man sich darüber stritte, ob oben zwei oder drei Punkte zu sehen sind – und gar nicht bemerkt, dass man einfach verschiedene Auffassungen darüber hat, was gezählt werden soll.
Bisweilen neigen wir auch dazu, unsere eigene Zählweise für die einzig wahre zu halten, und meinen, unsere Annahmen bewegten sich auf dem Boden unerschütterlicher Tatsachen. Aber fragen Sie sich mal, wie bodenständig Sie wirklich sind. Wie gut kennen Sie z.B. Ihre Sinne, die Ihnen immerhin die Wirklichkeit zutragen? Wie viele Sinne haben Sie? Ihre Antwort lautet vermutlich: fünf. Sie haben als Kind den Ausdruck «die fünf Sinne» gelernt, und dass man am besten «alle fünf Sinne beisammenhaben» solle. Aber haben Sie Ihre Sinne schon einmal gezählt? Glauben Sie mir: Es sind nicht fünf.
Vielleicht sind Sie nun schon vorsichtiger geworden und wollen erst einmal genau wissen, was gezählt werden soll. Hier meine Definition: Mit «Sinn» meine ich einen Wahrnehmungskanal Ihres Körpers, wie ein Instrument in einem Cockpit, das Ihnen ein Stück Wirklichkeit vermittelt. Fangen wir an: Sehen – eins. Hören – zwei. Riechen – drei. Schmecken – vier. Fühlen – fünf. Gleichgewicht – sechs. Lage Ihrer Gliedmaßen – sieben. Magenzustand (Übelkeit) – acht. Nötige Blasen-/Darmentleerung – neun. Ob Sie noch Schmerz als «Sinn für Beschädigung» zählen, überlasse ich Ihnen. Wenn Sie genau sein wollen, können Sie «Fühlen» noch differenzieren, denn Ihre Haut besitzt unterschiedliche Rezeptoren: für die Unterscheidung «heiß – kalt» sowie für die Empfindung von Druck (auch «rau – glatt»). Vielleicht wollen Sie nicht alle Kandidaten gelten lassen, aber seien Sie ehrlich: Weniger als sieben zählen Sie nicht, oder? Und das ganz physiologisch konkret, ohne einen «sechsten Sinn», wie manche ihn in diffusen Ahnungen o.Ä. sehen.
Aber das ist erst der Anfang: Wenn wir uns schon bei etwas so Grundlegendem wie der Anzahl unserer Sinne täuschen, wie sieht es dann mit anderen Annahmen aus? Was wurde Ihnen gegenüber noch alles behauptet? Und was behaupten Sie sich selbst gegenüber? Wofür lohnt es sich angeblich zu leben? Wie kommen Sie angeblich im Leben am besten voran? Was ist angeblich eine «glückliche Beziehung»? Welcher Art von Menschen dürfen Sie angeblich vertrauen? Was für ein Mensch sind Sie selbst angeblich?
Weil es auf solche Fragen keine einfachen Antworten gibt, werden wir manchmal ungeduldig oder resignieren und geben uns mit gedanklichen Stereotypen zufrieden.
Und doch kommt es vor, dass wir im Handeln innehalten, besonders, wenn wir mit etwas partout nicht weiterkommen. Wir treten einen Schritt zurück und denken: «Was tue ich hier eigentlich? Ich merke doch, dass es so nicht geht.» Dann suchen wir nach einer anderen Vorgehensweise, nach einer Lösung. Es ist eine der menschlichen Stärken, immer neue, bessere Lösungen finden zu können. Gerade weil wir darin so brillant sind, fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass es Fälle gibt, in denen uns Effizienz und Optimierung nicht weiterhelfen, sondern nur etwas anderes: ein Umdenken, ein neues Verständnis der Situation, ein Wandel unserer Einstellung. Und genau dabei kann die Philosophie helfen: Sie ist kein Antwortregister und kein Lehrgebäude, sondern fördert das Erkunden und Entwickeln des eigenen Denkstils. Philosophie, wie ich sie verstehe, ist eine Einladung zum Denken.
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Einladung annähmen und vieles, was Ihnen im Folgenden begegnet, mit Ihren eigenen Überlegungen verbinden und so vielleicht überraschende Zusammenhänge entdecken oder neue Perspektiven gewinnen.
Vielleicht geht es Ihnen auch wie dem Wurm im Apfel auf dem Umschlag: Sie stecken den Kopf aus der Alltagsroutine und fragen sich, ob es noch ein anderes Leben gibt. Gerade wenn im Leben mal etwas fade wird, lohnt es sich, über den Tellerrand zu schauen.
Nicolas Dierks
Mai 2014
Ach, und übrigens: Die «Würmer» in Äpfeln sind gar keine Würmer. Sondern Raupen eines Schmetterlings – des Apfelwicklers.
1 Selbsterfindung 4.0 – Wie will ich eigentlich leben?
In einer möglichen Zukunft: Die Erde, wie wir sie heute kennen, wurde weitgehend in Computronium umgewandelt – in programmierbare Materie. Die Menschen leben überwiegend als Uploads im virtuellen Raum, der auch die gesamte Vergangenheit der Menschheit simuliert. Ohne die Bindung an physiologische Körper existieren Menschen auf eine Weise, die für uns schwer vorstellbar ist: Sie spalten ihre Identität auf, legen Backups von sich an und leben als mehrere Kopien gleichzeitig an beliebigen Orten zu beliebigen Zeiten. Die wenigen älteren Menschen mit nur einer körperlichen Existenz haben Mühe, diese Lebensweise noch zu verstehen. Hier ein Ausschnitt aus einem Gespräch des jungen Sadiq mit seiner Großmutter Pamela:
«Über welche Kindheiten würdest du denn gern etwas hören?», fragt er.
«Was meinst du mit Kindheiten?» […]
«Ich hatte mehrere. Mutter hat immer wieder auf den Reset-Schalter gedrückt, weil sie hoffte, beim nächsten Mal einen besseren Treffer mit mir zu landen.» […]
«Aber was … welche Kindheiten – Plural – hast du denn gehabt?»
«Oh, recht viele. […] Neben diesem Leben hatte ich auch andere, ich musste mich ja nur aufspalten und später wieder zusammenfügen, das lief alles parallel.»
«Hattest du nie Probleme damit zu erkennen, wer du eigentlich bist?» […]
«Je mehr Personen man darstellt, desto besser weiß man, wer man selbst ist.» (Stross 2010, S. 365)
Dieses Szenario entstammt dem Science-Fiction-Roman Accelerando des schottischen Autors Charles Stross. Stross treibt darin ein kulturell-technologisches Phänomen auf die Spitze, das Soziologen und Medientheoretiker schon heute diagnostizieren und das wir alle aus unserem Alltag kennen: die zunehmende kulturelle Beschleunigung. Was geschieht dabei mit uns?
Durch die moderne Technologie sind wir schneller, effizienter und flexibler geworden. Wir sparen gegenüber früheren Verhältnissen unglaublich viel Zeit. Statt uns beim Wäschewaschen stundenlang die Hände rot zu schrubben, unsere Zeit mit Abwaschen zu verbringen und uns auf den Weg in die Stadt zu machen, um die notwendigen Dinge des Lebens einzukaufen, laufen heute gleichzeitig Waschmaschine und Spülmaschine, während wir gemütlich auf dem Sofa mit dem Tablet online shoppen. Diesen Aspekt nennt der Soziologe Hartmut Rosa «Beschleunigung der Handlungsgeschwindigkeit». Für manche von uns hält diese fast religiöse Verheißungen bereit. Die protestantische Arbeitsethik sah hohe Produktivität als Zeichen eines gottgefälligen Lebens. Der davon zehrende Geist des Kapitalismus treibt mit der steigenden Produktivität die zu erwartenden Renditen in den Himmel.
Sie kennen es sicher aus eigener Erfahrung, und wie Ihnen geht es den meisten: Trotz der höheren Handlungsgeschwindigkeit haben wir nicht den Eindruck, mehr Zeit zu haben. Stattdessen wird Zeit immer knapper. Wir müssten eigentlich viel mehr Freizeit haben – aber wir kommen einfach nicht dazu. Veränderte äußere Anforderungen lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Von uns wird heute z.B. erwartet, immer erreichbar zu sein und die ständigen Nachrichten prompt zu beantworten.
Doch haben auch wir selbst uns verändert. Wir geben uns nicht mehr mit einem einzigen Lebensentwurf zufrieden, sondern wägen ständig ab, ob es nicht doch eine bessere Alternative gibt. Philosophen wie auch Sozialwissenschaftler weisen darauf hin, dass diese Entwicklung schwerwiegende Folgen für die menschliche Lebensform haben könnte. Die explodierende Freiheit und Flexibilität hat Schattenseiten: Veränderungsdruck und Verpassensangst.
Einerseits kommen wir kaum noch zur Ruhe, denn die Anpassung an die neuen Möglichkeiten der Zeitersparnis kostet eine Menge Zeit. Ständig werden Verfahren umgestellt, Updates durchgeführt, Mitarbeiter versetzt, Abteilungen umbenannt und Strukturen umgekrempelt. Daraus entsteht für uns ein kontinuierlicher Anpassungsdruck.
Andererseits leben wir mit der unterschwelligen Angst, etwas zu verpassen. Immer ist uns klar, dass wir etwas anderes machen könnten, unsere kostbare Lebenszeit möglicherweise nicht optimal nutzen oder nicht aus jeder Minute die bestmögliche Erledigungs- oder Erlebnisqualität herauspressen. «Verpassensangst» gehört zum heutigen Lebensgefühl wie selbstverständlich dazu. Stets müssen wir mit einem Auge lauern, ob nicht unversehens die eine große Chance auftaucht. Wenn wir nicht Vollgas geben, wenn wir uns auch nur einen Moment achtlos treiben lassen, dann laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
Die kulturellen Verhältnisse fordern heute von den Menschen, sich wie Wasser schnell und widerstandslos an rapide Veränderungen anzupassen. Der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Zygmund Bauman spricht deshalb von einem «flüssigen Leben»: Wer seine Gewohnheiten nicht schnell genug ablegt, der sei zu schwerfällig. Oberflächlichkeit wird plötzlich ein Wert, denn wer sich zu ernsthaft auf etwas einlässt, der sammelt nur Ballast. Eindrucksvoll hat der amerikanische Soziologe Richard Sennett diese Kehrseite der vielbeschworenen Flexibilität in Der flexible Mensch beschrieben: Auch was Gewohnheiten, Jobs, Kompetenzen und menschliche Beziehungen angeht, leben wir in einer Wegwerf-Gesellschaft – getarnt durch Maximen wie «Flexibilität», «Fit im Alter» und «Lebenslanges Lernen».
Wenn Sie bisweilen einfach nicht alles schaffen oder die Orientierung verlieren, dann liegt das nicht an Ihnen – die komplexen Verhältnisse wachsen uns allen über den Kopf. Den Überblick zu behalten ist heute unmöglich geworden. Dies hat Jürgen Habermas – immer noch der international renommierteste lebende deutsche Philosoph – schon in den 1980er Jahren unter dem Schlagwort der «neuen Unübersichtlichkeit» in die Debatte eingebracht. Manchmal scheint diese Unübersichtlichkeit durchaus kalkuliert. Dass gerade eine unüberschaubare Bürokratie ein «Machtmittel allerersten Ranges» darstellt, hatte bereits der Soziologe Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. Geradezu verstörend schilderte auch Franz Kafka in Der Proceß die Erfahrung der Machtlosigkeit des unbescholtenen Josef K. gegenüber rätselhaften Verwaltungsstrukturen.
Der französische Medientheoretiker Paul Virilio schreibt in Der große Beschleuniger, dass die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts uns Menschen nicht nur überfordere, sondern eine echte Gefahr darstelle. Die Mehrzahl der globalen Unglücke hätten heute mit unkontrollierbarer Technologie zu tun – wie der Reaktorunfall von Fukushima oder sekundenschnelle elektronische Finanzströme, die ganze Volkswirtschaften in den Ruin treiben können. Aber es verändert sich auch, wie jeder Einzelne von uns sein Leben erfährt.
Für viele ist die permanente Umstrukturierung des Lebens schon eine eigene Lebensweise geworden: Gestresst und überarbeitet versuchen wir die Überfülle moderner Möglichkeiten optimal zu nutzen – getrieben von Verpassensangst. Richard Sennett hat in Handwerk beschrieben, wie dadurch gerade jene Langsamkeit und Ruhe verhindert wird, die wir z.B. für eine erfüllende Arbeitsweise bräuchten, für einen liebevollen Perfektionismus. Vor lauter Optimierung wird unser Leben immer leerer und durch ständige Selbsterfindung drohen wir uns selbst zu deformieren.
Stross verleiht dieser Entwicklung in seinem Roman eine Wucht, die schließlich auf die Umwandlung des ganzen Sonnensystems zusteuert. Gleichzeitig erschüttert seine technologische Utopie stillschweigende Annahmen über uns selbst – dass wir nur einen einzigen Körper haben, dass wir sterblich sind, dass die Entscheidung für die eine Lebensweise gleichzeitig die Entscheidung gegen eine andere beinhaltet. Weil Stross’ Roman diese Beschränkungen fiktiv aufhebt, werden sie uns umso klarer. Verblüfft sehen wir uns neu vor die großen Fragen des Lebens gestellt: Wie wollen wir leben? Wie gehen wir mit Widersprüchen im Leben um? Wie bleiben wir uns selbst treu?
Wer kennt sie nicht, die Situationen, in denen wir die Zeit nur zu gerne zurückdrehen würden? Wenn wir nachts wach liegen und im Geiste immer wieder jenen Moment umkreisen, in dem sich die ganze Spannung zwischen unserer jetzigen Situation und der verlorenen Möglichkeit zusammenzog, die Sekunde, in der es auf der Kippe stand, in der wir noch anders hätten entscheiden können? Doch die Dramatik der Kindheit, des Erwachsenwerdens, der Partnerschaft, des Berufslebens, der Erziehung der eigenen Kinder und des Älterwerdens liegt darin, dass der Zeitpfeil niemals rückwärts fliegt. Wir können kein Backup von uns erstellen und haben keinen Reset-Schalter.
Die Wege unseres Lebens gehen wir unter unsicheren Bedingungen – wie durch ein Labyrinth. Wir müssen Wege einschlagen, ohne dass wir vorher wissen, ob sie die richtigen sind oder uns in eine Sackgasse führen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns versuchsweise auf den nächsten Schritt einzulassen. Von «Lebensexperimenten» sprach der englische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill in seiner Schrift Über die Freiheit aus dem Jahre 1859. Jeder von uns habe, so Mill, solche Lebensexperimente zu durchlaufen. Welche Lebensweise für uns die richtige ist, wissen wir nicht, bevor wir sie ausprobieren.
Schon der griechische Philosoph Aristoteles verglich in seiner Nikomachischen Ethik das Streben nach einem besseren Leben mit dem Lernen eines Handwerks. Um es zu erlernen, müssen wir es praktizieren: «Denn was wir erst lernen müssen, um es zu machen (poiein), lernen wir, indem wir es machen. Zum Beispiel wird man Baumeister dadurch, dass man baut […] So werden wir auch gerecht dadurch, dass wir Gerechtes tun […].» (Aristoteles 2013, S. 74)
Ein besseres, erfüllteres, glücklicheres Leben erreichen wir demnach nicht in erster Linie durch Belehrung, neue Informationen, neue Erfahrungen oder Technologien. Wir machen uns nicht erst bereit für ein besseres Leben, um es dann irgendwann zu beginnen. Der Weg beginnt direkt damit, dass wir eine bessere Lebensweise annehmen.
Gleichwohl irren wir nicht völlig ahnungslos durchs Labyrinth des Lebens. Wir können die Wege zu antizipieren versuchen. Wenn wir über uns nachdenken – z.B., indem wir mögliche Entwicklungen durchspielen, das bekannte Was-wäre-wenn-Spiel betreiben –, dann ist das der Lebensstruktur von Stross’ Romanfiguren nicht unähnlich. Wir haben zwar keinen Reset-Schalter, können aber frühere Erfahrungen auf ähnliche Situationen übertragen. Wir können unsere Identität nicht aufteilen wie eine Festplatte, aber uns parallel in verschiedenen Bereichen entwickeln und zwischen ihnen Ausgleich zu schaffen versuchen. Aber letztlich müssen wir eine Lebensweise annehmen, um herauszufinden, was es in einer neuen Konstellation heißt, wir selbst zu sein.
Warum der Wandel unsere zweite Natur ist
Neue Lebensweisen anzunehmen ist anstrengend. Ständig sollen wir reflektieren, uns überprüfen, anpassen und optimieren. Manches Mal sehnen wir uns nach weniger Komplexität – davon künden die zahlreichen Aussteiger-Geschichten und die Popularität von Vereinfachungs-Ratgebern. Gelegentlich beneiden wir sogar Tiere um ihre «einfache Lebensweise» – ohne die Irrungen und Wirrungen von kultureller Existenz und persönlicher Identität. Jedoch: Keine anderen «Meister der Verwandlung» im Tierreich, wie das Chamäleon oder der Kalmar, wären menschlichen Veränderungen gewachsen, denn äußerliche Anpassung ist zu wenig. Wir Menschen vollziehen Wandlungen in unserer gesamten Persönlichkeit und können komplexe Handlungsmuster komplett austauschen. Diese Fähigkeit ist Fluch und Segen zugleich.
Vehikel unserer Verwandlungen ist seit etwa 200000 Jahren unsere Kultur – «Kultur» im weiten Sinn der ganzen Vielfalt menschlicher Lebensformen: Wie wir sprechen und uns geben, wie wir Nahrung zubereiten und uns kleiden – von Geschichten am Lagerfeuer bis zu den Glasgiganten unserer Millionenstädte, vom Faustkeil bis zum Smartphone.
Je nachdem, wie man Sprache, Kleidung, Werkzeuggebrauch oder Ernährungsgewohnheiten definiert, gehen die Datierungen der Ursprünge menschlicher Kultur auseinander. Doch eine Übereinstimmung herrscht: Als homo faber, als menschliche Hersteller von Dingen, gestalten wir nicht nur unseren Lebensraum um – sondern auch uns selbst.
Wir Menschen haben die besondere Fähigkeit, Gewohnheiten aufzugeben, neue auszubilden und weiterzuentwickeln. Das ist weder ein Kampf gegen die Natur noch eine Befreiung von ihr: Es ist unsere Natur. Aristoteles schrieb bereits vor 23 Jahrhunderten von einer «zweiten Natur» des Menschen. Dies erläuterte er am Beispiel der Tugenden – den Gewohnheiten guter Handlungen:
«Hieraus wird auch deutlich, dass keine der Tugenden des Charakters in uns von Natur aus [physei] entsteht. […] Vielmehr sind wir von Natur aus fähig, sie aufzunehmen, und durch Gewöhnung werden sie vollständig ausgebildet.» (Aristoteles 2013, S. 74)
Ein wichtiger Teil unserer Natur besteht demnach darin, unsere Gewohnheiten zu beeinflussen. Die neuen Gewohnheiten wachsen gewissermaßen in uns hinein, bis sie ein Teil von uns sind. Auch bei Cicero, dem großen römischen Anreger des Humanismus, hieß es: «Die Gewohnheit ist sozusagen eine zweite Natur.»
Als Sprachwesen haben wir überlegene kognitive Werkzeuge, um uns zu unseren Gewohnheiten zu verhalten. Wir denken über unsere aktuelle Situation hinaus weit in die Zukunft, planen langfristige Strategien und streben sogar das Ideal eines guten Lebens an (was auch immer wir darunter verstehen). Als «selbstinterpretierende Tiere», wie der kanadische Philosoph Charles Taylor uns charakterisiert, bewerten wir, ob unsere Entwicklung zum Besseren oder Schlechteren verläuft. Auf diesen Zusammenhang zwischen Gewohnheiten und der Suche nach einem besseren Leben führt schon die Verbindung des Wortes «Ethik» mit dem griechischen Wort ethos für «Gewohnheit».
Aber unsere Verwandlungskunst hat Grenzen. Wir können nicht schadlos das Atmen einstellen oder aufhören, zu essen und zu trinken. Außerdem folgen wir, wie alle Lebewesen, chronobiologischen Rhythmen. Damit ist die Taktung gemeint, mit der die physiologischen Prozesse unseres Organismus auf unsere Umwelt abgestimmt sind – etwa der Wechsel von Schlafen und Wachen mit dem Tag-Nacht-Zyklus. Solche natürlichen Gewohnheiten können wir nicht ohne gesundheitliche Gefährdung verändern. Aber darüber hinaus haben wir Menschen einen Spielraum, der uns von anderen Spezies abhebt. Dieser Spielraum verleiht uns große Kraft – doch, um es in den Worten von Onkel Ben aus der Comicverfilmung Spiderman zu sagen: «Aus großer Kraft erwächst große Verantwortung.»
Verantwortung für unsere Gewohnheiten
Zugegeben: Wir Menschen sind nicht immer gleichermaßen in der Lage, uns zu ändern bzw. uns an veränderte Situationen anzupassen. Ein Berufsangebot in einer entfernten Stadt nehmen wir vielleicht nicht an, weil wir zu erschöpft für einen Umzug sind. Möglicherweise ist es auch nicht die Erschöpfung, die uns abhält, sondern die Befürchtung, dem Berufswechsel nicht gewachsen zu sein. Oder wir denken, dieser Beruf würde nicht zu den Plänen passen, die wir momentan für unser Leben haben. Die beiden letzten Gründe haben eines gemeinsam: Sie handeln davon, was wir über uns selbst denken und was wir für uns für möglich halten.
Manchmal meinen wir, uns selbst schon in allen Facetten zu kennen, und halten bestimmte Veränderungen deswegen für unmöglich: «So bin ich nun mal.» Dabei ist es alles andere als ausgemacht, wie unsere zukünftige Lebensform aussehen könnte. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sprach im 19. Jahrhundert, bereits vor dem Hintergrund der Evolutionslehre Charles Darwins, vom Menschen als dem «nicht festgestellten Tier». Wir selbst, wie wir jetzt sind, haben uns Nietzsche zufolge nur als ein Übergangsstadium zu begreifen. Seine Lehre vom Übermenschen in Also sprach Zarathustra (1883–1885 geschrieben, leider lange von den Nazis fehlinterpretiert und instrumentalisiert) sollte unseren Blick für die nächste Stufe unserer selbst freimachen. Gerade weil wir nicht die Krone der Schöpfung seien, sei für uns immer wieder aufs Neue Selbsterfindung möglich.
Diesen Gedanken, dass unsere Wandelbarkeit ein evolutionärer Vorteil ist, hat in jüngerer Zeit die dual inheritance theory aufgegriffen – die Theorie der zweifachen Vererbung.
Zu ihren Vertretern gehört der amerikanische Experimentalpsychologe und Linguist Michael Tomasello, Leiter des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. In Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens hat er die Sichtweise ausgeführt, dass kulturelle Überlieferung als eine evolutionäre Strategie verstanden werden kann und somit zur Biologie des Menschen gehört. Die evolutionären Vorteile sind gewaltig, insbesondere die gesteigerte Geschwindigkeit der Anpassung: Während die Mechanismen der natürlichen Auslese und der genetischen Anpassung sich über Hunderte von Generationen einer Spezies erstrecken, sind rapide kulturelle Wandlungen innerhalb von wenigen Generationen möglich. Innerhalb von drei bis vier Generationen kann sich (bei entsprechendem Selektionsdruck) die Lebensform einer Gruppe fundamental wandeln.
Die Tatsache, dass Sie selbst existieren und gerade diese Zeilen lesen, haben Sie all den Menschen zu verdanken, die Hunger und Kälte, Seuchen und Katastrophen überlebt haben. Wie konnten wir langsamen Tiere ohne Fell die letzte Eiszeit überstehen? Durch Änderung unserer Gewohnheiten in Sachen Kleidung, Werkzeuggebrauch und Nahrungszubereitung. Wie konnte sich Europa seit der Neuzeit um 1700 mit einer Geschwindigkeit entwickeln, die andere Weltreiche jener Zeit (wie etwa China) überflügelte? Durch Änderung unserer Gewohnheiten in Politik, Moralität, Wissenschaft und Künsten.
Woher können wir das – diese unglaublichen Wandlungen vollziehen, ohne unsere physiologische Natur groß zu ändern? Und warum sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich – Schimpansen und Bonobos – nicht dazu in der Lage? Immerhin unterscheiden sich ihre Gene bekanntlich nur zu 0,3 % von unseren – dieselbe Differenz, die auch zwischen Pferden und Zebras besteht. Warum bleiben der Symbolgebrauch und die Kooperation von Schimpansen selbst nach jahrelangem Training hinter der natürlichen Entwicklung dreijähriger Menschenkinder zurück?
Tomasello macht dafür eine kleine genetische Besonderheit verantwortlich: die Fähigkeit zu gemeinsamer Aufmerksamkeit. Diese Fähigkeit ermögliche überhaupt erst, die kulturelle Überlieferung aufzunehmen und daran mitzuwirken. Außerdem würden so völlig neue Formen der Kooperation möglich. Das äußere sich bereits bei Säuglingen, die schon mit acht Wochen intensiv den Blick der Mutter suchen. Das Alter von etwa neun Monaten nennen Entwicklungspsychologen dann eine kognitive Revolution: Durch das Verstehen der Zeigegeste lernen Kinder, dass andere ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand lenken wollen und auch sie selbst die Aufmerksamkeit anderer lenken können.
Dieses Verstehen ermöglicht es, verschiedene Perspektiven miteinander zu koordinieren – eine Fähigkeit, die für uns so wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Kein Wunder, dass wir von klein auf darum ringen. Dabei steht nicht nur im Fokus, ob die anderen mir Aufmerksamkeit schenken, sondern wie sie ihre Aufmerksamkeit mit der meinigen abstimmen. Überlegen Sie einmal, welche Perspektiven sich jeweils gemeinsam abstimmen müssen, wenn z.B. beim Fußball ein Spielzug durchgeführt wird. In dieser Fähigkeit sind wir Menschen herausragend – doch nicht nur hier.
Der amerikanische Verhaltensforscher Winthrop Kellogg adoptierte in den 1930er Jahren das Schimpansenjunge Gua. Er wollte studieren, inwieweit es als Teil der Familie mit der Entwicklung des Menschenkindes mithalten konnte. Anfangs lernte die siebenmonatige Gua viel schneller als Winthrops eigener zehn Monate alter Sohn David. Doch nach einem dreiviertel Jahr brach Winthrop das Experiment ab. Gua hatte sich weitgehend normal entwickelt – aber David verhielt sich immer häufiger wie ein Schimpanse!
Menschenkinder können auf unvergleichlich intensive Weise imitieren. Dadurch saugen sie kulturelle Gewohnheiten auf wie ein Schwamm. Eltern sind manchmal verblüfft, ihr eigenes Verhalten im Spiel der Kinder wiederzuerkennen, wenn diese etwa als Zweijährige «telefonieren» oder «am Computer arbeiten». (Vielleicht sollte es statt «nachäffen» besser «nachmenschen» heißen.)
Aristoteles hatte bereits die Wichtigkeit der kindlichen Gewöhnung betont: «Es kommt also nicht wenig darauf an, ob man schon von Kindheit an so oder so gewöhnt wird; es hängt viel davon ab, ja sogar alles.» (Aristoteles 2013, S. 75)
Ein Teil unseres Lebens ist zufälligen Umständen unterworfen, die wir nicht oder nur bedingt beeinflussen können. Wir suchen uns nicht aus, wann wir geboren werden, in welchem Land oder von welchen Eltern. Wir sind in eine Welt «geworfen», wie der deutsche Philosoph Martin Heidegger es nannte, von der wir abhängig sind und die wir nur bedingt beeinflussen können. Unsere Welt kann bisweilen so starr und unbarmherzig wirken, dass wir daran beinahe verzweifeln. In solchen Momenten fühlen wir uns ohnmächtig und hadern mit unserem Schicksal. Doch niemals verlieren wir ganz unsere Freiheit – auch wenn sie woanders liegt, als wir vielleicht vermuten.
Auch in dieser schicksalhaften Zufälligkeit, die Philosophen unter dem Begriff der Kontingenz diskutieren, können wir zwischen unterschiedlichen Reaktionen wählen. Je besser wir schicksalhafte Umstände verstehen, desto genauer erkennen wir unsere Spielräume in ihnen. Gerade aus dem, was wir nicht beeinflussen können, erwachsen unsere Chancen. In den Worten Erich Kästners: «Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.»
Und selbst unter den aussichtslosesten Umständen behalten wir eine grundlegende Freiheit: die Wahl unserer Einstellung – wie der jüdische Psychologe Viktor Frankl eindrucksvoll in seinen Erinnerungen an seine Internierung in Auschwitz zeigt. In Trotzdem Ja zum Leben sagen resümiert er, dass die Schrecken der Massenvernichtung auch die Kraft dieser unverlierbaren Freiheit der Wahl der eigenen Einstellung gezeigt habe: «Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat; aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist aufrecht und ein Gebet auf den Lippen.» (Frankl 2013, S. 130f.)
Der amerikanische Erfolgsautor Stephen Covey hat diesen Spielraum durch die «90/10-Regel» erklärt, nach der 10 % unseres Lebens durch Umstände beeinflusst werden, über die wir keine Kontrolle haben, die restlichen 90 % allerdings von unserer Reaktion abhängen: Wenn uns kurz vor einer wichtigen beruflichen Präsentation jemand Kaffee über das Hemd schüttet, dann liegt das jenseits unserer Einflussmöglichkeiten – wie der Tag jedoch weiter verläuft, hängt direkt von unserer Reaktion ab. Werden wir wütend und gestresst und tragen dies unbewusst in die Präsentation, oder gehen wir humorvoll und gelassen damit um? Natürlich ist es fraglich, ob sich der «Einfluss im Leben» überhaupt prozentual angeben lässt und wie man Coveys 90/10-Regel überprüfen würde. Aber dennoch hat die Regel Sinn, nämlich uns dafür zu sensibilisieren, dass unser Einfluss in Situationen häufig viel größer ist, als wir meinen – durch die Wahl unserer Einstellung.
Gerade weil wir flexible Wesen sind, die ihre Reaktionen verändern können, sind wir auch verantwortlich für unsere Reaktionen. Wir sind nicht nur von Umständen determiniert und von Ursachen getrieben, sondern können unterschiedliche Einstellungen einnehmen, Gründe abwägen und unser Handeln danach richten.
Diesen Spielraum unseres Verhaltens nannte der deutsche Aufklärer Immanuel Kant auch das «Reich der Freiheit» gegenüber dem «Reich der Notwendigkeit» physikalischer Ursachen. Heute sprechen Philosophen im Anschluss an den amerikanischen Philosophen Wilfrid Sellars von einem «Raum der Gründe», in dem wir Menschen uns bewegen. Es ist uns natürlich, gegenseitig Gründe für unser Handeln einzufordern, zu geben und abzuwägen. Deshalb ist die menschliche Sphäre, auch wenn sie bisweilen erheblichen Veränderungsdruck auf den Einzelnen ausübt, kein bloßer Schauplatz evolutionärer Mechanismen, sondern auch einer der Begegnung rationaler Wesen, die ihr Handeln nach Gründen ausrichten und ihre eigene Einstellung beeinflussen können. Und deshalb stehen wir auch in der Verantwortung, unsere Fähigkeit der Selbsterfindung nicht unserer Kontrolle entgleiten zu lassen und zum Spielball der Umstände zu werden.
Als moderne Menschen neigen wir dazu, bei einem solchen Aufruf zur Eigenverantwortung sofort an eine individuelle Lebensführung zu denken:, den eigenen Weg, den eigenen Sinn. Seine Gewohnheiten weiterzuentwickeln war zwar schon in der antiken Welt ein Thema, wie die obigen Überlegungen im Anschluss an Aristoteles zeigen. Der Gedanke jedoch, dass jeder von uns eine einzigartige Weise des Menschseins hat, die einen eigenen Wert im Leben darstellt, war Aristoteles ebenso fremd wie noch den Europäern des Mittelalters. Werfen Sie mit mir einen kurzen Blick auf die Geschichte der Individualität.
Das unvollendete Buch des Lebens
Durch eine enge Gasse treten Sie hinaus auf den Marktplatz einer mittelalterlichen Stadt, sagen wir Nürnberg. (In der üblichen Art des historischen Genres beachten Sie die gängigen Anachronismen nicht und ignorieren die Sprachbarriere zum mittelalterlichen Deutsch ebenso wie den notorischen Verweis auf die üblen Gerüche). Zwischen den Marktständen mit Gemüse, Stoffen und Federvieh bemerken Sie einen wohlhabend aussehenden Mann. Sie gehen auf ihn zu und sprechen ihn an: «Wären der Herr so freundlich, mir die Stunde zu nennen?» – Der Mann mustert Sie kurz, nimmt dann den Deckel von der runden Messingdose an seiner Halskette ab und blickt auf das Ziffernblatt. «Soeben ölf», entgegnet er.
Manches im mittelalterlichen Leben war genau wie heute. Nicht nur liebten und stritten, gebahren und starben die Leute wie heute – seit der Erfindung der tragbaren Uhr konnten Sie auch auf der Straße jemanden fragen, wie spät es ist. Und doch gab es – natürlich – in vielen Bereichen zentrale Unterschiede. Was wäre geschehen, wenn Sie den Mann danach gefragt hätten, ob er sich vorstellen könnte, sich neu zu erfinden? Ob er in der Lage sei, seine Einzigartigkeit als Mensch zu leben?
Der mittelalterliche Bürger hätte Sie vermutlich ratlos angeschaut – und das nicht aufgrund mangelnder Intelligenz. Vielmehr deswegen, weil Sie ihn nach etwas gefragt hätten, das nicht zu seinem Selbstverständnis als Mensch gehört.
Zwischen dem Weltbild des Mittelalters und unserem heutigen gibt es einen wichtigen Unterschied. Nicht nur die Erde stand im Weltbild der Menschen still, sondern die ganze Natur inklusive der Ordnung im Menschenreich wurde als statisch aufgefasst. Die Welt war Gottes Schöpfung und als solche vollendet. Heute verstehen wir die lebendige Natur im Anschluss an Charles Darwins Die Entstehung der Arten als evolutionären Strom des Werdens und Vergehens von Einzelwesen und Arten. Damals hingegen sahen die Menschen die Natur als Ausdruck eines klar bestimmten, unveränderlichen göttlichen Willens. Das galt ebenso für die Ständegesellschaft, in der sie lebten. Der Platz des Einzelnen innerhalb dieser Ordnung war im Normalfall durch seine Geburt festgelegt und damit auch der grobe Ablauf seines Lebens. Dass der Einzelne ein unverwechselbares Individuum sein könnte, das ein Recht auf seine individuelle Art zu leben habe – dieser Gedanke kam im Weltbild des Mittelalters gar nicht vor.
Der Wandel zu unserem modernen Selbstverständnis brauchte mehrere Jahrhunderte. Langsam bildete sich eine dynamische Naturauffassung heraus und beeinflusste nach und nach alle Lebensbereiche. In der Renaissance waren die Vorwehen dieses Umbruchs zu verzeichnen, doch erst um 1700 kam der Prozess in seine entscheidende Phase.





























