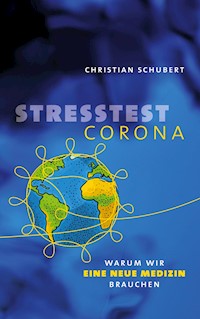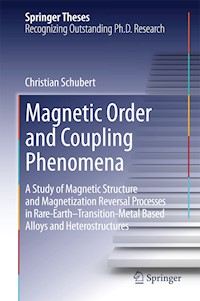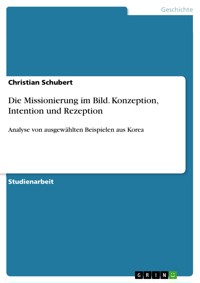21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arkana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein radikal neuer Blick auf den Zusammenhang VON GEHIRN, PSYCHE UND GESUNDHEITGRIPPEZEIT, JEDER SCHNIEFT UND HUSTET. Man hofft, heil über die Runden zu kommen. Doch wer bleibt verschont – und wer landet mit Fieber im Bett?Wie die noch junge Disziplin der Psychoneuroimmunologie beweist: Psyche, Gehirn und Immunsystem wirken aufs engste zusammen. Unser Immunsystem steht in ständiger Wechselwirkung mit unseren Gedanken, unserem Verhalten, unseren Gefühlen. Neueste Studien zeigen: Chronischer Stress, z. B. in Beziehungen oder im Job, macht uns nicht nur anfälliger für Infektionen, sondern kann unser Leben erheblich verkürzen; ja langfristig zu schweren Leiden wie Krebs und Autoimmunkrankheiten führen. Umgekehrt – so die gute Nachricht – sind positive Gedanken, seelische Ausgeglichenheit, inneres Wohlbefinden Selbstheilungskräfte, die Krankheiten verhindern.Christian Schubert plädiert für ein neues Denken in Medizin und Forschung, das den ganzen Menschen im Blick hat – und einen radikalen Wandel unseres Gesundheitswesens erfordert.'Die Medizin konzentriert sich ganz auf den Körper.Doch das ist nicht genug. Denn so wie Muskeln, Sehnen und Wirbelmiteinander verbunden sind, so sind auch Körper und Seeleals eine Einheit zu betrachten.Mich interessiert der Mensch als Ganzes.'Prof. Dr. Dr.Christian Schubert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Ähnliche
CHRISTIAN SCHUBERT | MADELEINE AMBERGER
WAS UNS KRANK MACHT – WAS UNS HEILT
fischer & gann
CHRISTIAN SCHUBERT
MIT MADELEINE AMBERGER
WAS UNSKRANK MACHTWAS UNSHEILT
AUFBRUCHIN EINE NEUE MEDIZIN
DAS ZUSAMMENSPIELVON KÖRPER, GEIST UND SEELEBESSER VERSTEHEN
fischer & gann
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist unzulässig und strafbar.
© Verlag Fischer & Gann, Munderfing 2016
Umschlaggestaltung | Layout: Gesine Beran, Turin
Umschlagmotiv: Shutterstock/haraldmuc
ISBN 978-3-903072-17-6
ISBN E-Book 978-3-903072-24-4
www.fischerundgann.com
INHALT
Vorwort
01 | Das Leben, wie es gelebt wird
02 | Wenn Stress das Herz bricht
03 | Die Weichen werden früh gestellt
04 | Wie der Körper wieder zu seiner Seele kam
05 | Mit dem Rücken zur Wand
06 | Ist Krankheit wirklich Schicksal?
07 | Wenn mir mein Körper zum Feind wird
08 | Geist und Seele über Materie und Körper
09 | Aufbruch in eine neue Medizin
Anhang:
Kurzanleitung zum Expressiven Schreiben
Danksagung
Quellennachweise
Literatur
Register
Für Sabine, Noah und Siri
VORWORT
Abb. 1A
DER KLEINE MAX SCHREIT (Abb. 1A). Er weint, dass es einem das Herz zerreißt. Was mag der Grund für so viel Unglück sein? Wie bei kleinen Kindern üblich, weiß man nicht sofort, was eigentlich los ist. Die Möglichkeiten sind ja nahezu endlos. Hunger? Eine volle Windel? Ein kaputter Eisenbahnwagen? Ohrenschmerzen? Diffuser Zorn? Eine aufziehende Erkältung? Oder fehlt ihm vielleicht ein Spielgefährte?
Abb. 1B
Kein Wunder, dass Max heult, wenn sein Papa, statt mit ihm zu spielen, seine Neurose auslebt (Abb.1B).
Dass der Cartoon »Papa nervt« nicht aus dem Leben gegriffen ist, brauche ich gewiss nicht zu betonen. Dennoch zeigt er eine Wahrheit auf: Will man eine Situation richtig interpretieren, braucht es den Blick auf das Ganze. Wenn man hingegen nur die eine Hälfte vor sich sieht – also entweder den weinenden Max oder den auf den Gleisen liegenden Vater – und sich daraufhin ein Urteil bildet, liegt man falsch. Aus diesem Grund verwende ich den Cartoon von Max und seinem Vater gern in meinen Vorlesungen und stelle die Frage: Warum findet dieses Prinzip in unserer modernen Medizin so selten Anwendung?
Wer heute zum Arzt geht, beschreibt seine körperlichen Symptome, bekommt daraufhin ein Rezept oder eine Überweisung und – das war’s dann meist auch schon. Dass auch psychische und soziale Faktoren einen Menschen ausmachen, dass sein Leiden in die vielschichtige Wirklichkeit seiner persönlichen Geschichte und seines gelebten Alltages eingebettet ist, kommt nicht einmal ansatzweise zur Sprache. Das bedeutet aber in letzter Konsequenz, dass die Therapieempfehlung auf der Basis eines unvollständigen Bildes erfolgt. Hier ein Beispiel:
Herr Meier, ein Student, durchlebt gerade eine harte Zeit. Von der Langzeitfreundin verlassen, beginnt er sein Studium in einer neuen Stadt, fern von daheim. Er lebt dort allein in einer Einzimmerwohnung. Es ist also verständlich, dass Herr Meier sich psychisch überfordert fühlt. Ausgerechnet in dieser Situation kommt eine Virusinfektion hinzu.
Wenn ein Patient wie Herr Meier heute zum Arzt geht und erklärt, dass sein Infekt stressbedingt sein könne, wird der Arzt das zwar registrieren, aber dennoch nach demselben Schema wie bei allen anderen Patienten fortfahren. Der gesunde Menschenverstand, das heißt das intuitive Gefühl des Patienten für seine Befindlichkeit, wird von vielen Ärzten als irrelevant angesehen. Das hat meiner Meinung nach fatale Folgen: Genauso wie die Ärzte im Rahmen ihres Studium vom Blick aufs Ganze abgebracht werden, bringen sie nun ihre Patienten dazu, dass diese einzig und allein auf ihre körperlichen Symptome achten. Die Psyche wird völlig vernachlässigt. Dabei hält die klassische, dualistisch-reduktionistisch orientierte Schulmedizin an einem Irrtum fest: Die Entstehung und der Verlauf einer Krankheit sowie eine starke oder geschwächte Widerstandskraft sind untrennbar mit unserer seelischen Befindlichkeit verknüpft.
Nun konnten eingefleischte Biomediziner bis vor Kurzem dagegenhalten, dass sich der Einfluss der Emotionen auf den Organismus ja nicht in den von ihnen so geschätzten, objektiven Labordaten mit ihren Grenzwerten nach oben und unten ausdrücken lasse. Doch auch diese Lücke schließt sich inzwischen, und zwar durch die Psychoneuroimmunologie (PNI). Sie ist zwar eine vergleichsweise junge Disziplin, doch ihr Grundpfeiler war schon den Ärzten der Antike vertraut: dass nämlich Körper und Seele eine Einheit darstellen. Wenn die Psyche leidet, kann sich der seelische Schmerz in körperlicher Erkrankung niederschlagen. Die Psychoneuroimmunologie (als Teildisziplin der Psychosomatik) befasst sich mit den nervalen und biochemischen Kommunikationswegen zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem, die solchen Prozessen bzw. Phänomenen zugrunde liegen. Um auf den Studenten Meier im Beispiel zurückzukommen: Sein Trennungsschmerz, seine Einsamkeit und sein Gefühl der Überforderung lösen, beginnend im Gehirn, biochemische Kaskaden aus, die sich bis in die kleinsten Bestandteile seiner Zellen fortpflanzen – bis in den Zellkern hinein, wo die Gene sitzen. Diese Prozesse schwächen sein Immunsystem dermaßen, dass es den Virus nicht mehr abzuwehren vermag.
Das Zusammenspiel von Psyche und Immunsystem kann man als eine der revolutionärsten medizinischen Einsichten der letzten Jahrzehnte bezeichnen. Noch vor vierzig Jahren waren Mediziner der Meinung, dass unser Immunsystem autonom, das heißt völlig unabhängig arbeitet und mit den anderen Systemen des Körpers nicht kommuniziert. Mittlerweile weiß man aber: Das Immunsystem ist kein Einzelgänger, sondern arbeitet sozusagen in einem Team. Psyche, Gehirn und Immunsystem sind eng miteinander verknüpft, sprechen eine gemeinsame Sprache und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie versuchen unseren Organismus zu schützen und gesund zu erhalten. Ich möchte Sie einladen, dieses biopsychosoziale Wunderwerk, das uns ein Überleben in der Welt erst ermöglicht, anhand dieses Buches näher kennenzulernen.
1995 interessierten sich für all die oben beschriebenen Dinge nur die wenigsten. Damals kam ich mit einer zu der Zeit als exotisch zu bezeichnenden Ausbildung an die Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie in Innsbruck, um dort den Forschungsbereich Psychoneuroimmunologie aufzubauen: Ich hatte Medizin und Psychologie studiert und war einige Jahre in der medizinisch-biochemischen Laborforschung tätig gewesen. In den nächsten Jahren sollte ich noch eine Ausbildung zum psychodynamischen Psychotherapeuten machen. Die verschiedenen Inhalte meiner Ausbildungen fügten sich für mich zusammen: Die Medizin repräsentierte den Körper, die Psychologie Fühlen, Denken und Verhalten, die Biochemie die Moleküle und die Psychodynamik das Unbewusste.
In den Jahren von 1995 bis heute tauchten wir vom Wissenschaftsbereich der Psychoneuroimmunologie in eine biopsychosoziale Forschungswelt ein und entwickelten ein spezielles Forschungsdesign, die integrativen Einzelfallstudien. Mit Hilfe dieses Ansatzes untersuchen wir den ganzen Menschen, wie er seinen sich ständig verändernden Alltag erlebt, welche Situationen ihn dabei emotional belasten, welche Ereignisse ihn begeistern und wie sein Organismus – insbesondere das Immunsystem – darauf reagiert. Mit anderen Worten: Wir richten unseren ganzheitlichen Fokus auf das gesamte Leben einer Person. Oder, um auf den kleinen Max des Cartoons zurückzukommen: Wir haben in unseren Studien nicht nur den weinenden Max, sondern sein gesamtes Umfeld sowie seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Auge. Dieses Buch gibt Ihnen einen Einblick in die Psychoneuroimmunologie und zeigt Ihnen, was diese nicht allein für die Medizin und ihren Fortschritt, sondern vor allem für das Leben und die Gesundheit des Menschen bedeutet.
01
DAS LEBEN,WIE ES GELEBT WIRD
ES GAB TAGE, DA WUSSTE RUTH STÖGER beim besten Willen nicht, wie sie aus dem Bett kommen sollte. »Ich konnte den Kopf nicht aus der Horizontalen heben, musste mich also auf die Seite drehen und mühsam mit den Armen irgendwie hochkrabbeln.« Ganz so schlimm sind ihre Nacken- und Rückenbeschwerden zwar nicht mehr, doch völlig schmerzfrei ist sie nie. »Das ist schon zermürbend. Manchmal strahlen die Schmerzen so sehr aus, dass ich glaube, mir explodiert der Kopf. Ich spüre einen starken Druck in den Augen und Ohren. Es kann dann auch sein, dass ich schlecht höre. Meine ganze Halsmuskulatur ist total verkrampft.«
Die Krankengeschichte der heute 62-Jährigen begann 2009 mit zunehmenden Schmerzen in der Lendenwirbelregion. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt ihrem Mann, einem orthopädischen Chirurgen, geholfen, eine florierende Praxis aufzubauen, und ihm dort dann auch viele Jahre lang assistiert. »Wir operierten an drei Tagen pro Woche, von sieben Uhr morgens bis acht Uhr abends.« Hüft- und Knieoperationen sind im wahrsten Sinne des Wortes schwere Knochenarbeit. »Dafür braucht man viel Kraft. Am Ende ging es mir aber so schlecht, dass ich nicht mehr am Operationstisch stehen konnte. Mir liefen vor Schmerzen nur so die Tränen über die Wangen.«
Ruth Stöger versuchte ihrer Tortur mit den üblichen Therapien zu begegnen: Schmerzmittel, Infiltrationen, Kältetherapie. Doch nichts half nachhaltig. Die Bilder des Magnetresonanztomographen enthüllten schließlich die Ursache der starken Schmerzen. »Im Lendenwirbelsäulenbereich hatten sich meine Bandscheiben total aufgelöst. Knochen rieb also an Knochen.« Auf die dringende Empfehlung eines Wirbelsäulenspezialisten hin ließ sie sich operieren. Doch die Beschwerden waren damit nicht völlig beseitigt. Das Problem: »Ich bin nicht sehr beleibt. Daher rieb das [chirurgisch zwischen den Wirbeln eingesetzte] Metall von innen gegen die Haut.« Außerdem entwickelte die Patientin eine Instabilität im Halswirbelbereich. Es folgte innerhalb von nicht einmal zwei Jahren eine zweite Operation. Der Chirurg entfernte das lästige Metallstück aus der Region der Lendenwirbel und versteifte die Halswirbelsäule.
Ende gut, alles gut? Davon konnte keine Rede sein. Am Dorn des zweiten Halswirbels, dem Dens, bildete sich innerhalb von wenigen Monaten eine Zyste. Die Ärzte waren alarmiert. »Denn wenn etwas so schnell wächst, besteht Verdacht auf eine bösartige Geschwulst. Ich wusste auch, dass man solche Operationen durch den Schlund macht. Genau in dieser Region des Nackens liegen sehr viele lebenswichtige Nerven und Blutbahnen.« Die Patientin hatte Glück im Unglück: Eine Operation war nicht nötig. Es handelte sich »nur« um eine Arthrose, in deren Zuge sich eine entzündliche Zyste, die den umgebenden Knochen in Mitleidenschaft zog, gebildet hatte.
Ruth Stögers Rückenprobleme hatten lebensverändernde Folgen. Die Schmerzen belasteten sie psychisch immer mehr und die zunehmende psychische Belastung verschlimmerte ihre Schmerzen. Sie musste aufhören, ihrem Mann zu assistieren. Und nun? Nun wusste sie fürs Erste nichts mit sich anzufangen. Wo stand sie? Wer war sie ohne dicht verplanten Terminkalender, ohne Ziel und Pläne? Ihre Krankensituation bildete also den perfekten Anlass, einmal in Ruhe Bilanz zu ziehen. »Ich war seit dem Staatsexamen immer erwerbstätig gewesen«, erinnert sich die Pensionistin. Mehr als zehn Jahre arbeitete sie mit viel Freude und großer Befriedigung als Kinderärztin. »Die Pädiatrie ist das Schönste, was es für mich in der Medizin gibt.« Sie erinnert sich an belastende Momente im Umgang mit krebskranken Kindern, aber auch viel Schönes sei dabei gewesen. »Wenn man am Morgen zur Visite kommt, wird man begrüßt mit ›Hallo, Tante Doktor‹; manchmal bekommt man eine Zeichnung geschenkt. Kinder freuen sich über einfache Dinge. Die motzen nicht, bloß weil die Rahmsauce zu dünnflüssig ist.«
Warum gab sie eine persönlich so bereichernde Aufgabe eigentlich auf? Es fügte sich eins ins andere: Ruth Stöger bekam zwei Kinder, und dann bat ihr Mann sie, ihm doch beim Aufbau seiner orthopädischen Praxis zu helfen. »Ich sagte, ja gut, mach ich mal. Aber wenn man einem Mann den kleinen Finger reicht, nimmt er schnell die ganze Hand.« Aus der Kinderärztin mit Leib und Seele wurde also eine unverzichtbare OP-Assistentin und eine Praxismanagerin, die 16 Angestellte dirigierte. Ihren maximalen Arbeitseinsatz hielt sie für sinnvoll, denn das Ehepaar baute sich eine gemeinsame und lukrative Existenz auf. Doch die Ressentiments ließen sich nie ganz verdrängen: »Mein Mann machte die schöne Medizin, und ich durfte mich mit dem Personal herumschlagen. Ich habe es bis zum Schluss bereut, dass ich damals Ja gesagt habe.« – Im nächsten Leben würde sie die Pädiatrie nie und nimmer aufgeben.
Dass ihr lädierter Rücken zumindest teilweise Ausdruck von Überbelastung und Frustration sein könnte, habe sie früher nie auch nur im Entferntesten in Betracht gezogen. »Ich muss ehrlich sagen: Ich war aus tiefstem Herzen Schulmedizinerin.« Wenn der Körper nicht in Ordnung war, musste er eben repariert werden. Und in ihrem Fall belegten die Befunde der bildgebenden Methoden – vom Röntgen bis zur Computertomographie – die Schäden an der Wirbelsäule ja eindeutig. »Einige meiner Freundinnen sagten immer wieder: ›Also Ruth, merkst du nicht, dass dein Rucksack viel zu schwer ist?‹« Da machte sie sich dann doch Gedanken. Heute ist sie überzeugt: »Mein Rucksack war tatsächlich manchmal viel zu schwer.«
Ruth Stöger musste ihre Meinung in vieler Hinsicht revidieren. »Ich wäre sicher nie so weit gekommen, wenn ich gesund geblieben wäre.« Die Pensionistin, die nun endlich gelernt hat, ihr Leben zu genießen, schwört auf Yoga, Pilates, Shiatsu und Akupunktur. Das individuell zusammengestellte Alternativtherapieprogramm reduziert Stress und auch die Schmerzzustände. Ganz erstaunlich, wie wirksam das sei! »Früher wollte ich immer wissen, warum und wieso etwas funktioniert. Ich habe gelernt, mich zu ergeben. Es funktioniert für mich, und das ist die Hauptsache.«
Rückenbeschwerden,die Volkskrankheit Nummer eins
RUTH STÖGER BEFINDET SICH MIT IHREM LEIDEN in erstaunlich großer Gesellschaft. Der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) in Deutschland erhob die Ursachen dafür, warum Arbeitnehmer gleich für mehrere Wochen pro Jahr Krankenstand beanspruchten. Als Volkskrankheit Nummer eins stellten sich die Rückenschmerzen heraus. Diese gehören zur großen Krankheitsgruppe der so genannten Muskel-Skeletterkrankungen, zu denen auch Probleme mit den Bandscheiben zählen. Rückenschmerzen sind für gut ein Viertel der Arbeitsausfalltage der Versicherten verantwortlich; und fast ein Sechstel der Krankenstände geht auf Kosten von psychischen Störungen. Die Tendenz ist bei beiden Krankheitskomplexen steigend. Das Interessante dabei ist: In vielen Fällen sind Patienten von beidem zugleich betroffen – beispielsweise von Depression und Rückenleiden. Ein Zufall? Das bezweifle ich sehr!
Für mich zeigt sich an diesen Daten deutlich: Probleme mit den Bandscheiben können nicht ausschließlich mechanisch begründet werden. Schwache Rückenmuskeln, abgenutzte Bandscheiben und eine schlechte Haltung führen nicht unweigerlich zu einem Bandscheibenvorfall. Manche haben ein Leben lang schwer körperlich gearbeitet, ohne jemals an Rückenproblemen zu leiden. Andere sind schon als junge, sportliche Menschen von einem Bandscheibenvorfall betroffen. Was also macht den Unterschied aus? Ist es wirklich die Genetik, vor deren Folgen für Körper und Geist es, wenn man der Schulmedizin glauben will, kein Entrinnen gibt? Oder spielen doch noch andere Faktoren mit? Bei Frau Stöger war es eine tiefer liegende psychische Zerrissenheit im Hinblick darauf, wie sie ihr Leben lebte.
Die Verbindungen zwischen Bandscheibendefekten, quälenden Rückenschmerzen und psychischen Problemen waren bei ihr besonders augenfällig. Für mich steht außer Zweifel, dass ihre körperlichen Beschwerden Ausdruck einer tiefen seelischen Verwundung waren, deren Ursachen in ihrer frühen Lebensgeschichte zu finden sind. Ihre psychischen Verletzungen – davon bin ich als Psychotherapeut überzeugt – mussten viel früher begonnen haben, als die Patientin in ihren Ausführungen zur beruflichen Beanspruchung deutlich machte. Mit anderen Worten: Es war gewiss nicht ausschließlich die harte Arbeit am Operationstisch, die Frau Stöger quasi in die Invalidität trieb. Vielmehr schienen mir so manche ihrer Persönlichkeitszüge geradezu prädestiniert für einen Rückenschaden zu sein: sehr leistungs- und erfolgsorientiert, diszipliniert, pflichtbewusst, selbstkritisch mit Hang zum Perfektionismus. Man könnte auch bildlich von einer Art strammstehen müssen sprechen, obwohl die Last am Rücken unerträglich ist. Das konnte langfristig nicht gut gehen. Frau Stöger wurde immer unzufriedener, depressiver, und dazu gesellten sich die ersten Bandscheiben- und Wirbelkörperdefekte und, damit verbunden: Rückenschmerzen.
Meine medizinisch-psychologische Ausbildung lässt mich davon ausgehen, dass Frau Stögers bedrückender, langjähriger Stress seine messbaren Spuren im Organismus und – in diesem Fall – in der überlasteten Wirbelsäule hinterließ. Das mag revolutionär klingen, denn Rückenbeschwerden gelten traditionell als rein mechanisch-körperliches Problem. Dem stehen jedoch neueste Erkenntnisse aus der jungen Disziplin der Psychoneuroimmunologie entgegen, welche im Begriff ist, die Schulmedizin auf den Kopf zu stellen. Die Psychoneuroimmunologie zeigt, dass die Seele über ihren Einfluss auf Immunaktivitäten prinzipiell jede Veränderung im Organismus bewirken kann, zum Guten wie zum Schlechten. Die Prinzipien, nach denen Nerven-, Hormon- und Immunsystem zusammenspielen, sind schon recht gut erforscht und werden in diesem Buch ausführlich dargestellt. Wir wissen dadurch, dass Stress unter anderem Entzündungsprozesse anheizt, die Wundheilung beeinträchtigt oder Knochenabbau fördert. Ich bin mir sicher, dass solche Prozesse bei Frau Stögers Rückenproblemen mitgespielt haben.
Die Arbeitsgruppe um Philip Gold und George Chrousos von den National Institutes of Health, Bethesda im US-Bundesstaat Maryland, fand beispielsweise heraus, dass Frauen, die entweder depressiv waren oder in der Vergangenheit einmal an einer Depression gelitten hatten, im Vergleich zu gesunden Frauen eine um 6,5 Prozent geringere Knochendichte in der Wirbelsäule aufwiesen. Auch hatten Testpersonen mit Depressionen in der Krankengeschichte signifikant höhere Ausscheidungsraten des Stresshormons Cortisol im Urin, welches nachweislich den Knochenaufbau hemmt und so zu Knochenschwund führt. Die Forscher schließen aus ihren Ergebnissen, dass eine Depression zu einer bedeutsamen Verringerung von Knochensubstanz führt, verbunden mit einer erhöhten Gefahr von Knochenbrüchen.
Wenn man nun weiß, dass ein so viele Menschen betreffender Krankheitskomplex wie die Muskel-Skeletterkrankungen und die damit verbundenen Rückenschmerzen von der Seele zumindest mitverursacht wird, sollten psychotherapeutische Interventionen eigentlich genauso zum Therapieangebot gehören wie die so genannten konservativen Therapien: Spritzen, Massagen, Tabletten. Was dem freilich vorausgehen müsste, wäre ein Arzt-Patienten-Gespräch, in dem die psychosoziale Befindlichkeit des Patienten als bedeutsamer Faktor miteinbezogen wird. Ein solches Gespräch findet jedoch in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht statt. Viele Ärzte verschanzen sich förmlich hinter dem ausschließlich Körperlichen, als wäre der Patient ein reparaturbedürftiges Auto und der Arzt ein Mechaniker. Von erfolgreicher Medizin kann man hierbei nicht sprechen. Frau Stögers Schmerzzustände wurden trotz zweier komplizierter Operationen nicht beseitigt, was man sich eigentlich von so schweren Eingriffen, wenn sie durchgeführt werden, erwarten müsste.
Psychotherapeutisch gesehen brauchte es bei Frau Stöger den lädierten Rücken, damit sie sich gestatten durfte, was sie unbewusst schon lange wollte: mit der Arbeit in der Praxis ihres Mannes aufhören. Bezeichnenderweise reduzierten sich ihre Schmerzen in dem Maß, in dem sie sich in der Folge selber Gutes tat, aktiv Entspannung mit Mind-Body-Techniken suchte und in psychotherapeutischen Gesprächen – unter anderem mit mir – ihre tiefe Frustration ausdrückte und somit diese auch innerlich zuließ.
Was ich im Fall von Rückenschmerzen anprangere, gilt auch für viele andere Erkrankungsbereiche. Ob Magenbeschwerden, Schwindelanfälle, Erschöpfungszustände oder viel zu häufige Erkältungen: Was über die körperlichen Symptome hinausgeht, kommt in den meisten Arzt-Patienten-Gesprächen viel zu wenig zur Sprache. Dass ein Arzt sich für den Patienten und auch für dessen inneres Befinden Zeit nimmt, ihm Aufmerksamkeit schenkt, hat in der modernen Medizin geradezu Seltenheitswert. Doch gerade der leidende Mensch braucht einen Arzt, der sich mit ihm auseinandersetzt. Wir Ärzte reden immer von der Bedeutung der Krankengeschichte eines Patiente, doch scheint sich kaum ein Arzt zu überlegen, was damit eigentlich gemeint ist. Bei einer Krankengeschichte geht es im Kern um persönliche Erlebnisse und Erfahrungen des Patienten, das heißt, wie das Wort bereits besagt, um seine Geschichte. Eine Geschichte muss jedoch erzählt werden und braucht ein Gegenüber, das zuhört. Der Patient ist der Experte für das, was ihm widerfahren ist und was er spürt.
Respektiert man in der Medizin die psychischen und psychosozialen Zusammenhänge von Krankheit? Nein, das ist absolut nicht der Fall. Der Mensch wird allzu oft auf biochemische Datensätze und Laborresultate reduziert. Ich halte das für eine grundlegende Missachtung des Individuums. Diese Haltung drückt sich im klinischen Alltag auch sprachlich aus: Ärzte reden untereinander vom Blinddarm auf Zimmer 2 oder der Gallenblase auf Zimmer 5. Wer glaubt, Patienten hörten nicht mit und würden nicht darunter leiden, wie mit ihnen umgegangen wird, verkennt die Realität.
Was man gemeinhin als die Dehumanisierung bzw. Entmenschlichung des ärztlichen Alltags bezeichnet, hat viele Gründe, darunter etwa ganz konkrete wie Raumknappheit in den Spitälern oder chronischer Zeitdruck. Diagnosen werden zwischen Tür und Angel vermittelt, denn der Arzt muss schon zur nächsten Operation hasten. Der Mangel an Empathie, der sich in solchem Verhalten ausdrückt, ist aber auch erlernt. US-amerikanische Studien zeigen, dass Medizinstudenten in den ersten zwei Jahren ihrer Ausbildung sehr viel Mitgefühl empfinden. Es sinkt stark im dritten Jahr, wenn die Studenten regelmäßig mit Patienten in Kontakt kommen. Fragt man die angehenden Mediziner nach den Gründen ihres geringeren empathischen Verhaltens, klagen sie unter anderem über den Leistungsdruck, den das Medizinstudium auf sie ausübe und der es nicht zulasse, sich eingehender auf einen Patienten einzulassen. Seitens der medizinischen Fakultät wird hier nicht entgegengesteuert, wohl weil man davon ausgeht, dass der Medizinstudent auf Zeitmangel und Arbeitsbelastung im späteren Klinikalltag vorbereitet werden muss. Das Credo lautet: Nur ein emotional distanzierter Arzt kann auch sachlich korrekt diagnostizieren und behandeln. Empathie gilt als Störfaktor.
Von Menschen und Laborbefunden
ICH BIN MIR SICHER: Was ich hier als die alltägliche Dehumanisierung und mangelnde Empathie in der Medizin beschreibe, haben die meisten schon am eigenen Leib erfahren. Die einen stört es nicht, sind sie doch als Patienten längst schon gewohnt, in der Medizin auf diese Weise behandelt zu werden. Die anderen ärgern sich sehr über ein solches Verhalten. Denn was der Arzt als gesunde Distanz empfinden mag, interpretiert der Patient möglicherweise ganz anders. Er fühlt sich von oben herab behandelt, nicht ernst genommen und fragt sich: »Warum ist meine persönliche Beschreibung der Symptome – mein subjektives Erleben – dem Arzt so viel weniger wichtiger als ein Laborbefund? Sollten sich beide nicht idealerweise ergänzen?« Das Empfinden des Patienten, wann wo welche Schmerzzustände auftreten, ist genauso Tatsache wie der Wert eines biochemischen Markers.
Der Glaube an die Allmacht von – dank der Technologie – immer präziseren Daten und die damit verbundene Geringschätzung der individuellen Erfahrung betreffen aber nicht nur die klinische Medizin und die Arzt-Patienten-Beziehung. Sie herrschen auch in der medizinischen Forschung vor. Ich finde, dass es in der medizinischen Forschung sogar noch menschenentfremdeter zugeht als in der Klinik. Dahinter stecken jahrhundertealte Wissenschaftstraditionen, die den Menschen als Maschine betrachten. Beispielsweise die philosophische Weltanschauung des Dualismus, der eine klare Trennlinie zwischen Körper und Seele zieht, oder die des Reduktionismus, der annimmt: Wenn wir die kleinsten Bestandteile – sprich: Zellen und Moleküle – und deren Wechselwirkungen verstehen, dann wissen wir, wie der Mensch funktioniert. Alle diese philosophischen Zugänge halte ich für falsch, wenn es um die Erforschung des Menschen geht. Bloß weil wir mittlerweile nachvollziehen können, wie der Stoffwechsel des so genannten Glückshormons Serotonin im Gehirn abläuft, können wir damit noch lange nicht erklären, was Glück ist. Wir an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie in Innsbruck schlagen den entgegengesetzten Weg ein. Wir glauben: Je mehr man über das Psychische und Psychosoziale eines Menschen weiß, desto besser verstehen wir dessen Physiologie und damit beispielsweise die Funktion des Serotonins. Prosaisch ausgedrückt würde ich sagen: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.
Aus dem eben Gesagten geht für mich hervor: Den idealen Zugang in der Stressforschung bietet das real gelebte Leben der untersuchten Person. Wir können dieses Leben nur dann verstehen, wenn wir die persönliche Lebensgeschichte der Person in die Auswertung miteinbeziehen, und zwar mit aller gebotenen Liebe zum Detail. Ich stehe daher besonders den experimentellen Studiendesigns zu Stress und Psyche skeptisch gegenüber, weil sie die individuelle Geschichte der einzelnen Versuchspersonen außer Acht lassen und auf konstruierten Belastungssituationen basieren, die bei möglichst allen untersuchten Probanden möglichst einheitlich zu Stress führen sollen.
Hier ein typisches Studiendesign der Laborforschung als Beispiel: Man erklärt der Testperson, dass sie sich nach einer zehnminütigen Vorbereitungszeit fünf Minuten lang gegen die Anschuldigung von Ladendiebstahl verteidigen müsse, und das vor laufender Kamera oder vor Publikum. Ein anderes Mittel zur Stresserzeugung sind mathematische Aufgaben. Die Testperson muss beispielsweise bei 1.022 beginnend so schnell wie möglich jeweils 13 subtrahieren. Sobald man einen Fehler macht, muss man zum Ausgangspunkt, also zu 1.022, zurückkehren und von vorne anfangen. Diese Aufgabe dauert ebenfalls fünf Minuten. In beiden Stressexperimenten wird den Versuchspersonen vor und nach der künstlichen Belastungssituation Blut oder Speichel entnommen, um Stresshormone und Immunparameter zu bestimmen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die meisten Menschen auch in künstlichen Situationen ein wenig Stress empfinden werden und sich dies mit mehr oder weniger großer Verlässlichkeit auch in den gemessenen Stresssystemwerten niederschlagen wird. Doch egal, ob man sich nun verzählt oder nur wenig stichhaltige Argumente gegen die Anschuldigung von Ladendiebstahl vorzubringen weiß, es geht letztlich um nichts. Und somit ist auch die Übertragbarkeit solcher Ergebnisse auf psychische Belastungssituationen im gelebten Leben – also dort, wo sich Belastungsdramen abspielen, aber auch Glücksmomente erlebt werden – nur sehr begrenzt. Ich bezweifle daher, dass das Verhalten von Menschen in konstruierten Situationen tatsächlich etwas Gültiges über die Funktion ihres Stresssystems auszusagen vermag.
Wir in Innsbruck gehen seit geraumer Zeit einen völlig anderen Weg in der Stressforschung. Wir untersuchen detailliert, wie das, was der Mensch in seiner normalen Welt Tag für Tag erlebt, was ihn aufregt oder betrübt oder rührt oder beglückt, mit seiner Stresshormon- und Immunaktivität in Verbindung steht. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Erfassung der individuellen Biografie und der aktuellen Beziehungswelt der untersuchten Person und bringen emotional bedeutsame Alltagsereignisse in zeitliche Beziehung zu Stresssystemparametern. Wir betiteln unsere Einzelfallstudien mit Absicht mit Life As It Is Lived. Uns geht es um das Leben, wie es gelebt wurde und wird. Ich möchte an dieser Stelle Nicole Bergmann zu Wort kommen lassen. Sie war die erste gesunde Probandin, die bei uns an einer Einzelfallstudie teilnahm.
Momentaufnahmen eines Lebens
»WENN ICH SO RICHTIG IM STRESS BIN, und nichts geht mehr, dann steig ich auf die Notbremse und kümmere mich um mich selbst«, erklärt Nicole Bergmann, Chemielehrerin an einem Gymnasium. »Am liebsten geh ich dann in einem Wellnesshotel in die Sauna, lasse mich massieren und entspanne mich so richtig. Ich brauche Stille.« Ähnlich reagierte die heute 41-Jährige schon in ihrer Kindheit. »Im Winter hab ich mir die Rodel genommen und bin auf den Berg zu einer Kapelle hinauf.« So habe sie oft ihr inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Heute verfolgt die Tirolerin diese Strategie noch viel bewusster. Man müsse sich Freiräume schaffen, erklärt Nicole Bergmann. »Und – ganz wichtig – man muss lernen, Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen.« Klappt das immer? »Gewiss nicht«, räumt sie ein. »Wenn’s mit Mann, Kind und Schule zu eng wird und ich zu wenig schlafe, weil ich abends zu lange vor dem Fernsehapparat sitze, merke ich bald, wie beispielsweise meine Ernährung leidet.« Dann fühle sie sich auch körperlich unwohl. So, als wäre sie nicht ganz gesund.
Nicole Bergmann war Doktorandin für Biochemie an der Universität Innsbruck, als sie an der Einzelfallstudie über die Zusammenhänge zwischen Immunsystem und Stressoren des Alltags teilnahm. »Ich dachte mir damals, etwas über meinen Körper zu erfahren, könne ja nicht schaden.« Außerdem habe Psychologie sie schon immer interessiert. Und dass sie für die Teilnahme an der Studie ein bisschen Taschengeld bekam, tat ihrem mageren Studentenbudget gut. Rückblickend kann Nicole Bergmann sich vor allem an eins im Hinblick auf die »Life As It Is Lived«-Studie erinnern: »Ich dachte mir damals: Es ist schon ziemlich stressig, bei einer Studie über Stress mitzumachen.«
Die Probandin erinnert sich an die Studie als eine sehr selbstreflexive Zeit. »Denn ich musste abends immer notieren, was mich tagsüber gestresst hatte. Ich ließ also den ganzen Tag Revue passieren und überlegte bei jedem Ereignis, ob es mich mehr, weniger oder gar nicht aufgeregt hatte.« Das ständige Abwägen und Bewerten von Stresserlebnissen sei nicht einfach gewesen. Denn: »Man reagiert nicht jeden Tag auf den gleichen Stressfaktor gleich genervt. Die Tagesverfassung spielt immer auch eine Rolle.«
Das tägliche Rekapitulieren von Ereignissen führte dazu, dass Nicole Bergmann achtsamer wurde, wenn etwas sie ärgerte. »Es gibt immer wieder Momente, da braust man auf. Doch wenn man nur kurz tief durchatmet, merkt man, es war alles nicht so schlimm und den Zorn gar nicht wert. Vor der Studie habe ich mir kaum überlegt, wann und warum ich überreagiere.« Ein typisches Beispiel betraf damals eine Studiengruppenbetreuerin. Einerseits nahm diese eine Art Mutterrolle bei den Studentinnen ein. Andererseits schien sie zu erwarten, dass diese sich auch in nicht studienbezogenen Belangen nach ihrem Vorbild richteten. »Die Frau war Vegetarierin, aber ich habe eben weiterhin mit großem Genuss meine Fleischlaibchen verzehrt. Sie sagte klipp und klar, dass sie das nicht in Ordnung finde. Ich habe mich durch ihre Kritik niedergemacht gefühlt. Zuletzt war es so schlimm, dass ich, egal, was sie sagte, in kürzester Zeit innerlich in Wut geriet.« Sie erklärt sich ihren großen Zorn heute damit, dass sie damals intellektuell flügge werden und sich vom Einfluss der Betreuerin lösen wollte. Die Kritik wegen ihrer Ernährung erlebte sie daher als eine ständige, extreme Bevormundung. Rückblickend sei die Sache mit den Fleischlaibchen viel zu banal, um sich darüber derart aufzuregen.
Während der zweimonatigen Studiendauer musste sich Nicole Bergmann einmal pro Woche mit ihren Harnproben sowie mit Fragebögen und Tagebuchnotizen in unserer Klinik einfinden. Eine psychologisch versierte Ärztin besprach mit ihr ihre Aufzeichnungen im Detail. »Nervig war das, weil sie immer und immer wieder nachhakte und alles bis ins kleinste Detail abklären wollte. Manchmal gelang es mir nicht, diffuse Gefühle in Worte zu fassen. Ich kam mir oft wie an den Pranger gestellt vor. Dabei hatte ich ohnehin schon so viel von mir preisgegeben! Und nicht nur das: Unsere Gespräche wurden immer auf Kassette aufgezeichnet!« Rückblickend schätzt die 41-Jährige diese Gespräche jedoch als äußerst lehrreich ein. »Es fühlte sich an, als wäre ich in einer Psychotherapie. Man lernt aus den Fragen, die ein Therapeut stellt, und daraus, wie er diese stellt. Solche Fragen kann man sich ja auch selber stellen.«
Den roten Teppich ausrollen
ALS NICOLE BERGMANN DIE STUDIE MIT UNS MACHTE, hatten wir über die Jahre bereits mehrere Einzelfallstudien durchgeführt. Bei diesen Studien waren Patientinnen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE), einer Autoimmunkrankheit, untersucht worden. Nicole Bergmann war, wie gesagt, unsere erste gesunde Probandin, was uns einen faszinierenden Vergleich zwischen dem Stresssystem von gesunden und jenem von kranken Menschen ermöglichte.
Die Formulierung »Life As It Is Lived« stammt ursprünglich von Gordon Allport (1897 – 1967). Der US-amerikanische Psychologe war zu seiner Zeit einer der führenden Persönlichkeitsforscher. Als Vertreter des idiografischen – das heißt, sich auf die Einzelperson konzentrierenden – Ansatzes forderte er von der Persönlichkeitspsychologie, dass sie sich primär mit der Individualität einer Person und der ihr eigenen Struktur und Dynamik zu befassen habe. »Alles dreht sich um die zentrale Frage nach der Natur des menschlichen Wesens«, erklärte der an der Harvard University lehrende und forschende Psychologe einmal in einem Interview. Gordon Allport war überzeugt davon, dass sich eine vielschichtige menschliche Persönlichkeit mit all ihren Ängsten, Hoffnungen und Leidenschaften durch Tests und Fragebögen nicht einmal annähernd erschöpfend erheben ließ. Er propagierte daher Langzeitstudien, die sich mit Hilfe verschiedener Methoden auf das Alltagsleben eines einzelnen Menschen konzentrierten. Gordon Allport war für uns fraglos ein Vorbild.
Folgende Forschungsfragen sind in unseren Einzelfallstudien von zentraler Bedeutung: Wie funktioniert das Stresssystem der Person? Welchen Rhythmen des Alltags gehorcht es? Welche emotional belastenden Erfahrungen stellen eine deutliche Herausforderung dar, welche registriert es kaum? Wie wirken sich diese Erfahrungen auf das Immunsystem aus? Wie sieht das Ganze aus, wenn die Person etwas Erfreuliches erlebt? Und umgekehrt: Wie wirkt sich die Aktivität des Immunsystems auf die Psyche der untersuchten Person aus?
Um solche alltagsnahen Fragen zum Funktionieren des Stresssystems eines Menschen beantworten zu können, müssen wir viel Persönliches von der untersuchten Person erfahren. Es ist für den Forschungsprozess unabdingbar, dass wir das Vertrauen der Testpersonen gewinnen, und das verlangt eine bestimmte Art und Weise, ihnen zu begegnen. Ich formuliere es gerne so: Wir rollen der jeweiligen Probandin den roten Teppich aus. Diese Frau ist für uns keine anonyme Nummer. Das sehr persönliche Datenmaterial, das die Testperson uns zur Verfügung stellt, ist für uns wertvoll. Und das vermitteln wir ihr. Die Person weiß somit aber auch: Wenn sie uns ihr Vertrauen nicht schenkt, sich nicht öffnet, dann wird die Forschung darunter leiden. Denn je mehr sich die Probandin auf die Studie einlässt, als desto facettenreicher, desto vielschichtiger erweist sich das Datenmaterial. Der rote Teppich ist für mich ein Bild dafür, dass wir dieser Person für ein bis zwei Monate unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Menschen spüren, wenn man ihnen mit Respekt und Wertschätzung entgegenkommt, und sind dann eher bereit, aus sich herauszugehen.
Es gibt nichts im Alltag unserer Probandin, das uns nicht interessiert. Ich bin mir sicher, dass manche der Testpersonen uns als geradezu übertrieben analysierend empfinden. Doch für uns ist nichts zu nebensächlich, sobald es die Person berührt. Es gibt für uns keine Banalität des Alltags. Denn jedes Erlebnis, das auf der emotionalen Skala registriert wird, schlägt sich biologisch nieder. Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig: Fast alles, was die Person als erfreulich oder unangenehm erlebt, hat letztlich Bedeutung für die Immunreaktion.
Die Biochemie des Körpers rangiert für mich dabei immer auf der niedrigsten Stufe; auf der höchsten rangieren hingegen die so genannten psychosozialen Beziehungsaspekte. Wesentlich sind daher Fragen wie die folgende: Welche Bedeutung haben vergangene und gegenwärtige zwischenmenschliche Beziehungen für die Probandin und wie geht sie damit um? Ihre Beziehungswelten loten wir im Interview aus. Es kommt dabei zwangsläufig auf feinste sprachliche Differenzierungen an. Als Interviewer muss man seine Fragen mit Bedacht formulieren und bei den Antworten auf Nuancen im Ausdruck hören, auf sprachlich subtile Signale von seelischer Befindlichkeit. Am Anfang der Zusammenarbeit steht immer ein ausführliches Interview über das bisherige Leben der Probandin. Wir fragen vor allem nach belastenden Ereignissen oder chronischen Problemen der vergangenen zwei bis fünf Jahre. Solche Tiefeninterviews helfen uns zu verstehen: Wer ist dieser Mensch, der hier vor uns sitzt, und welche bisherigen Erfahrungen haben ihn geprägt?
Unser Studienprotokoll ist für die Probanden durchaus anspruchsvoll. Über den gesamten Studienverlauf sollen sie täglich alle zwölf Stunden ihren gesamten Harn in einem speziellen Urinkanister sammeln. Also jeweils von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends, und dann wieder von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens. Da man diesen Kanister ständig mit sich führen muss, schenken wir jeder Probandin unserer Studien vorab eine Tragetasche nach eigener Wahl, damit das Urin-Sammeln für sie selbst nicht zu unangenehm und für andere Personen nicht zu auffällig wird. Nach Ende einer Zwölf-Stunden-Einheit pipettiert die Probandin mit einer mitgegebenen Computerpipette ihren Harn in vorbeschriftete Röhrchen. Diese schiebt sie dann in die Gefriertruhe. Von Nicole Bergmann lagen uns somit über die 63 Tage der Studiendauer 126 Röhrchen und damit 126 Messpunkte vor. Man sieht also schon: Eine solche integrative Einzelfallstudie kann nur funktionieren, wenn die Probandin den ganzen Zeitraum über motiviert mitmacht. Sie wird nicht quasi von oben herab, also von einem hierarchisch über ihr stehenden Forscher getestet, sondern ist ein echtes Forschungsteammitglied.
Außer dem Sammeln der Urinproben soll die Probandin zusätzlich alle zwölf Stunden – also wiederum jeweils um acht Uhr abends bzw. acht Uhr morgens – eine Batterie von Fragebögen ausfüllen. Darunter ist ein langer, 60 Punkte umfassender Fragebogen, der nur aus Eigenschaftswörtern besteht. Beispielsweise: verärgert, freudig, unbekümmert, nervös usw. Relativ spontan soll die Testperson nun auf einer so genannten 4-Punkt-Lickert-Skala angeben, ob die jeweilige Befindlichkeit in diesem Augenblick stark, ziemlich, etwas oder gar nicht ausgeprägt vorhanden ist. Die Probandin muss außerdem zwei Mal täglich eine Reihe von Fragen zu ihrem Alltagserleben und -verhalten (zum Beispiel Ausmaß der körperlichen Aktivität, Schlafverhalten) beantworten und tagebuchartig niederschreiben, welche positiven und negativen Ereignisse sie in den letzten zwölf Stunden erlebte.
Stressoren,unter die Lupe genommen
EINMAL PRO WOCHE KAM NICOLE BERGMANN schließlich zu uns in die Klinik und lieferte die Fragebögen sowie den eingefrorenen Harn ab. Das ist auch Teil der Studie. Wir setzen uns mit der jeweiligen Probandin dann jedes Mal für etwa anderthalb Stunden zusammen und rekapitulieren die Ereignisse der vergangenen Woche. Zunächst geben wir einen halb-strukturierten Interviewleitfaden vor, bei dem wir der Probandin Fragen zu 39 vorab definierten potenziellen Alltagsstressoren stellen. Zum Beispiel: Hatten Sie Streit in der Partnerschaft? Gab es einen Vorfall mit der Polizei? Wurden Sie am Arbeitsplatz kritisiert? Hatten Sie eine Auseinandersetzung mit Kollegen? Haben Sie etwas verloren? Und irgendwann sagte die Probandin dann: »Ja, genau, das ist mir in der vergangenen Woche passiert.« Wenn man nachfragt, erinnert sie sich, dass sie ihren Schlüssel verlor, und zwar am vorigen Dienstag zwischen acht Uhr früh und acht Uhr abends. In diesem Zeitraum habe sie den Schlüssel verlegt und erst drei Tage später wiedergefunden. Über diese Zeit sei sie auch beunruhigt gewesen. Ich gehe mit meinen weiteren Fragen immer sehr ins Detail. Ich möchte etwa wissen: Was führte dazu, dass sie den Schlüssel verlor? Was waren die spezifischen Umstände? Hat ihr jemand beim Suchen geholfen – und, wenn ja: war das eine Person oder waren es mehrere? Passiert ihr das häufiger?
Wenn wir die Liste der 39 Standardsituationen abgefragt haben, gehen wir die Tagebuchnotizen durch, um festzustellen, ob bzw. welche Ereignisse bisher möglicherweise vergessen wurden. Natürlich stoßen wir dabei wieder auf den verlorenen Schlüssel vom vergangenen Dienstag. Aber vielleicht gibt es noch andere Geschehnisse des Alltags, die der Probandin entfallen sind. Auf der Basis der Tagebuchaufzeichnungen können wir ein noch detaillierteres Bild des Alltagslebens nachzeichnen. Das heißt also: Mit dieser Art der minutiösen Erhebung und der Befragung erhalten wir ein unglaublich facettenreiches Bild von potenziellen Stressoren, aber auch von erfreulichen Ereignissen im Alltag.