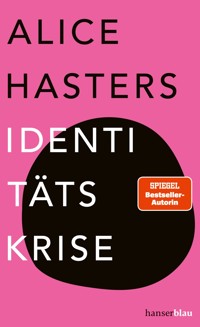9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten – und die fängt bei einem selbst an. „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen weiße Menschen oft nicht hören. Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten — und die fängt bei einem selbst an.»Darf ich mal deine Haare anfassen?«, »Kannst du Sonnenbrand bekommen?«, »Wo kommst du her?« Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind rassistisch. Warum, das wollen weiße Menschen oft nicht hören.Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.
Alice Hasters
Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen
aber wissen sollten
hanserblau
Für meine Schwestern
Vorwort
An der Journalistenschule besuchte ich ein Seminar, in dem wir lernten, Zeitungskommentare zu verfassen. Wir durften uns das Thema frei aussuchen. Wichtig war es, eine klare Haltung zu formulieren. Ich schrieb meinen Kommentar über einen Karnevalsverein, der nicht einsah, warum seine Mitglieder aufhören sollten, ihre Gesichter schwarz anzumalen, Afro-Perücken aufzusetzen und sich als »lustige Afrikaner*innen« zu verkleiden. »Darf man jetzt etwa keinen Spaß mehr haben?«, fragten sie sich.
Meine These lautete: Wir sprechen falsch über Rassismus. Der Fokus liegt nur darauf, was man heutzutage noch dürfe und was nicht. Aber Gleichberechtigung kann man nicht durch ein Einhalten von Verboten erreichen. Rassismus zu bekämpfen, ist keine Sache der Höflichkeit. Menschen müssen verstehen, was hinter ihrem rassistischen Handeln steckt. Mein Dozent verstand diesen Ansatz nicht. »Was soll das sein, ein Gesinnungstext?«, schrieb er darunter. Außerdem wurde meine Themenwahl kritisiert. Rassismus hätte zu wenig mit der aktuellen Politik zu tun.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mittlerweile erkennen viele Menschen die politische Aktualität von Rassismus — oder haben zumindest mitbekommen, dass sich Leute damit beschäftigen. Manche finden, das Thema sei hochgekocht und es würde zu viel darüber gesprochen. Ich finde hingegen, der Diskurs steckt noch in den Kinderschuhen. Das Problem ist der Sprung in der Schallplatte. Wir hüpfen immer wieder an den Anfang. Wir verhandeln darüber, ob Rassismus überhaupt existiert und wenn ja, ob und wie schlimm er ist. Das werde ich in diesem Buch nicht tun.
Dass wir bei diesem Thema nur schleppend vorankommen, erkenne ich unter anderem daran, dass viele immer noch nicht verstehen, wie man rassistisch sein kann. Oder dass sie überrascht reagieren, wenn Menschen von Diskriminierungserfahrungen erzählen. Für sie war Rassismus nie ein Thema. Es sind oft gerade diese Menschen, die momentan nicht mehr mitkommen. Es reicht nicht aus, sich über Rassismus zu wundern, und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie man rassistisch sein kann. Gerade jetzt. Politik und Gesellschaft rücken immer weiter nach rechts, und auf einmal sind es eben nicht mehr nur Nazis, sondern auch die eigene Tante auf dem Familienfest, die ein Problem damit hat, »dass man ja keine Deutschen mehr auf der Straße sieht«.
Eine geläufige Reaktion auf so eine Aussage: Kopfschütteln, Augen verdrehen, schweigen. Muss man nicht dramatisieren, die eigene Tante ist schließlich kein Nazi. Doch hier liegt ein Missverständnis vor: Nicht nur Nazis sind rassistisch, und man muss Rassismus nicht erst bekämpfen, wenn er in radikaler Form auftritt. Rassismus beginnt schon viel früher.
Das scheinen viele Menschen nicht zu wissen oder zu akzeptieren. Ich früher auch nicht. Lange dachte ich, Menschen, die ungefragt in meine Haare fassen, mich automatisch auf Englisch ansprechen, die mich, noch bevor sie meinen Namen wissen, fragen, wo ich herkomme, oder meine Hautfarbe mit allem auf der Welt vergleichen, was braun oder schwarz ist — das sei einfach normal und zu akzeptieren. Freundliche Neugier. Ich sah es als meine Aufgabe an, diese Dinge hinzunehmen, darüber zu schweigen oder höchstens mit anderen Betroffenen darüber zu sprechen.
Doch der Rassismus im Kleinen, im Alltag, hängt mit dem Rassismus im Großen zusammen — und wie, das versuche ich in diesem Buch an einem konkreten Beispiel zu erklären: mir selbst. Meine Expertise rührt in erster Linie aus meiner Existenz als Schwarze Frau. Ich erzähle von Rassismus, der mir in meinem Leben begegnet ist. Der auf den ersten Blick vielleicht harmlos wirken mag und eben doch große Auswirkungen hat. Im Alltag, in der Schule, auf meinen Körper, in der Liebe und in der Familie. So ist das Buch deswegen auch aufgeteilt.
Ich will transparent machen, dass meine Welt oft anders aussieht als die von weißen Menschen. Das geht natürlich mit einer bestimmten Perspektive einher. Ich bin eine Schwarze Frau, mit einem weißen Elternteil, ich bin heterosexuell, und ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Genau genommen müsste das Buch also heißen: »Was weiße Menschen nicht über bestimmte Aspekte von Anti-Schwarzem-Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Das Buch hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie gesagt, wir sind beim Thema Rassismus noch längst nicht am Ende. Es braucht noch viel mehr Stimmen, die gehört werden müssen.
Viele Menschen, vor allem Schwarze Frauen, haben bereits kluge Bücher geschrieben, die umfassend und anschaulich erklären, wie Rassismus, insbesondere in Deutschland, aussieht. Einige von ihnen werden Erwähnung in diesem Buch finden, denn ohne ihre Arbeit hätte dieses Buch nicht entstehen können. Während ich ihre Texte las, habe ich mich oft gefragt, warum ich das Ganze noch einmal aufschreibe. Aber dann gehe ich ins Internet, lese Kommentare in sozialen Netzwerken, schaue mir Talkshows an — und dann fällt es mir wieder ein. Die Arbeit dieser Menschen wurde noch nicht ausreichend gelesen, gehört oder ernst genommen. Wie gesagt, es braucht noch mehr.
»Your silence will not protect you« — euer Schweigen schützt euch nicht. Das schrieb die Schwarze Dichterin und Aktivistin Audre Lorde. Schweigen zu brechen, mache Angst, gerade weil das Risiko bestehe, dass man missverstanden oder verletzt werde. Dinge müssen ausgesprochen werden, auch wenn dieses Risiko besteht, so Lorde. Gut, dann fange ich mal damit an.
Bevor es losgeht, noch eine kleine Einführung zu dem Gebrauch von Schrift und Sprache in diesem Buch.
Dieses Buch enthält rassistische Begriffe. Im Fließtext habe ich die Begriffe, die leider nicht so altertümlich sind wie angebracht, zensiert. Gerade um deutlich zu machen, dass sie nicht mehr genutzt werden sollten. Bei historischen Zitaten habe ich mich dazu entschieden, sie unzensiert auszuschreiben.
Die meisten Namen der im Buch vorkommenden Personen wurden geändert.
Dass Schwarz groß geschrieben wird und weiß kursiv, ist Absicht. Warum, wird in diesem Buch auch noch erklärt. Außerdem verwende ich genderneutrale Sprache. Es mag für manche zunächst ein wenig ungewohnt sein, aber darum geht es ja auch — um das Ändern von Gewohnheiten.
1 Alltag
Das R-Wort
Ich bin in Köln-Nippes aufgewachsen. Kölner*innen pflegen einen besonderen Patriotismus, wenn es um ihre Heimatstadt geht. Nippeser*innen legen noch einmal eine Schippe drauf. Sie lieben ihr Viertel. So sehr. Sie lassen sich die Nippeser Postleitzahl tätowieren und tragen T-Shirts und Mützen, die erkennen lassen, wo sie wohnen.
Als ich klein war, witzelte Stefan Raab im Fernsehen gerne darüber, dass Nippes ein hartes Pflaster sei. Das stimmte nicht. Zumindest nicht in meinen Augen. Es war das Lieblingsviertel von Künstler*innen und Freiberufler*innen. Die Mieten waren verhältnismäßig günstig, und trotzdem war es nicht ab vom Schuss. Viele Familien mit überwiegend türkischer Zuwanderungsgeschichte lebten dort. Rückblickend reichte das wahrscheinlich, um Nippes als ein Problemviertel darzustellen.
Auf dem Nippeser Markplatz thront ein hässlicher Betonklotz mit großen Treppenstufen, die nirgendwo hinführen. Was dieser Bau genau soll, wofür er gut ist, weiß ich bis heute nicht. Von dort aus kann man gut beobachten, wie mittags Menschen zwischen den Ständen hin und her wuseln, und der Geräuschkulisse aus den Schreien der Verkäufer*innen und dem kölschen, nachbarlichen Gequatsche lauschen. Als ich jung war, spielten wir dort nach der Schule zwischen zermatschtem Gemüse. Im Sommer kauften wir uns für zwanzig Pfennige Wassereis und Kaugummis am kleinen Kiosk, setzten uns auf die nach Urin und Essensresten stinkenden Betonstufen und streckten uns gegenseitig unsere blau gefärbten Zungen entgegen.
Mittlerweile ist Köln-Nippes gentrifiziert.
Imbissbuden, Ramschläden und alteingesessene Kneipen mussten Burgerläden, Bars und Cafés weichen. Der hässliche Betonklotz auf dem Marktplatz wurde von einem lokalen Künstler bunt angemalt und sieht jetzt ein bisschen besser aus. Immerhin. Den Kiosk gibt es nicht mehr. Dort hat eine kleine Kaffeebude aufgemacht.
Als ich noch, einige Jahre älter inzwischen, in Nippes gewohnt habe, habe ich mich dort, an der Kaffeebude, oft mit meiner Freundin Luise getroffen. So saß ich mit Anfang zwanzig wieder gerne auf den Betonstufen, statt Wassereis einen Cappuccino in der Hand. Der Kaffeeladen wird von zwei Frauen betrieben, die Kund*innen mit einem Lächeln begrüßen und ihre Kaffees mit viel Liebe durch das Durchreichfenster übergeben.
Eines Tages, als Luise ihren Kaffee bezahlte und Trinkgeld geben wollte, stellte eine der Frauen eine Spardose vor uns. »Hier kannst du es reinschmeißen«, sagte sie vergnügt. Es war eine antike Spardose: der Oberkörper eines Schwarzen Mannes. Rote Lippen, breit zu einem absurden Lächeln geformt, große Augen und Nase. Vor seinem Mund eine Hand, in die man die Münze hineinlegen konnte. Als die Frau einen Hebel betätigte, hob sich die Hand. Die Augen des Mannes rollten nach hinten, die Münze verschwand in seinem Mund und landete scheppernd im Inneren der Spardose.
Ich hatte so eine Sparbüchse schon einmal gesehen. Meine Mutter hatte vor vielen Jahren eine weibliche Version in einem Antiquariat in Irland gekauft, als wir dort Urlaub machten. Damals war ich neun Jahre alt. Ich wunderte mich über diese seltsame Spardose. »Warum hast du sie gekauft?«, fragte ich meine Mutter. »Ich will nicht, dass jemand so etwas Rassistisches besitzt, deshalb muss ich sie aus dem Verkehr ziehen«, sagte sie. Sie erklärte mir auch, dass diese Spardose symbolisieren sollte, dass Schwarze das ganze Geld der Weißen verschlucken würden. Damals habe ich noch nicht genau verstanden, warum.
Heute weiß ich, dass diese Spardosen zwischen dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt waren, »Jolly N**ger Bank« genannt wurden und aus den USA kommen. Nach der offiziellen Beendigung der Sklaverei 1865 dort wurden Schwarzen Menschen im Zuge einer Agrarreform sechzehn Hektar Land und ein Esel versprochen. Außerdem fielen Schwarze Menschen als kostenlose Arbeitskraft weg. Das kam weißen Landbesitzer*innen natürlich erst einmal sehr teuer vor. Die ehemaligen Sklav*innen wurden also als Geldfresser*innen der Weißen gesehen, einfach nur, weil sie jetzt bezahlt werden mussten. Schwarze Menschen bekamen das ihnen zugesicherte Land und Vieh nicht, das Versprechen wurde schnell wieder zurückgezogen. Das Narrativ der gierigen Schwarzen blieb. Aus dieser Ansicht entstand unter anderem diese Spardose.
Unter Sammler*innen sind Spardosen wie diese heute immer noch begehrt. Allerdings nicht zu verwechseln mit den sogenannten »Nickn**gern« — Spendendosen, die lange Zeit auch in deutschen Kirchen zu finden waren, mit denen die Gemeinden Geld für »die Armen in Afrika« sammelten. Diese Spendendosen kamen meist in Form eines Schwarzen Jungen, der eine Art Korb vor sich trug und, wenn man eine Münze einwarf, artig und demütig den Kopf verneigte. Ebenso rassistisch, doch aus einem anderen historischen Kontext — dazu kommen wir noch.
Hier war ich nun auf dem rummeligen Marktplatz vor der netten Kaffeeverkäuferin und der rassistischen Spardose, die gerade Luises Trinkgeld verschluckt hatte. Offensichtlich kannte oder erkannte die Frau den historischen Zusammenhang nicht. Vielleicht war diese Spardose für sie nur ein antikes Trödelstück — eben ein Mann, der Geld verschluckt. Vielleicht fand sie das witzig. Wahrscheinlich fiel der Kaffeeverkäuferin die Darstellung des Mannes mit den großen weißen Augen und Zähnen, den roten Lippen und der wulstigen Stirn nicht als rassistisch auf. Eine Sekunde lang überlegte ich, einfach nichts zu sagen. Die Frau in ihrem friedlichen Unwissen zu lassen. Das machte ich oft — einfach nichts sagen. Ich bin nicht besonders schlagfertig und eher konfliktscheu. Ich wusste, wenn ich das »R-Wort« aussprechen würde, wäre die Stimmung dahin.
Selten fühlen sich weiße Menschen so angegriffen, allein und missverstanden wie dann, wenn man sie oder ihre Handlungen rassistisch nennt. Das Wort »Rassismus« wirkt wie eine Gießkanne voller Scham, ausgekippt über die Benannten. Weil die Scham so groß ist, geht es im Anschluss selten um den Rassismus an sich, sondern darum, dass ich jemandem Rassismus unterstelle. Meist sind solche Auseinandersetzungen kräftezehrend und wenig zielführend. Denn so viel haben die meisten schon verstanden: Rassistisch sollte man nicht sein. Rassismus, so die geläufige Annahme, sei offener Hass, Verachtung, und trete seit 1945 nur noch vereinzelt auf. Kaum ein Land habe sich so viel Mühe gegeben wie Deutschland, die eigene rassistische Vergangenheit aufzuarbeiten, heißt es dann. Deshalb sei es jetzt auch mal gut. Und überhaupt: Rassismus gegenüber Schwarzen sei doch ohnehin ein Problem der USA — oder Großbritanniens oder Frankreichs.
Weiße Menschen haben so wenig Übung darin, mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert zu werden, dass sie meist wütend darauf reagieren, anfangen zu weinen oder einfach gehen.
Am Ende bin oft ich es, die sich dafür entschuldigen soll, das Thema überhaupt adressiert zu haben. Diese Dynamik nennt man Täter*innen-Opfer-Umkehr. Egal, wie ruhig ich mich verhalte, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Menschen meine Reaktion als irrational, empfindlich, dramatisierend oder überemotional bewerten. Für viele Menschen wirkt das R-Wort so, als ob man eine Fliege mit einem Baseballschläger erschlagen würde. Wenn ich jemanden rassistisch nenne, dann hört dieser Mensch meist nicht, was ich ihm oder ihr sage. Was er oder sie hört, ist: »Du bist ein schlechter Mensch. Du bist böse. Du bist ein Nazi.«
Das liegt auch daran, dass Menschen eine einseitige Vorstellung davon haben, was Rassismus ist.
Für Rassismus gibt es unterschiedliche Definitionen. Der Historiker Ibram X. Kendi definiert es in seinem Buch Gebrandmarkt zum Beispiel so: »Jegliche Vorstellung, die eine bestimmte ethnische Gruppe als einer anderen ethnischen Gruppe unterlegen oder überlegen betrachtet.«
Doch in einer Welt, in der Ungleichheit besteht, ist auch Rassismus ungleich gewichtet. Viele Menschen gehen davon aus, dass grundsätzlich jede Person von Rassismus betroffen sein könnte. Diese Menschen sehen Rassismus als rein individuelle Haltung. Wie ein einzelner Mensch die Welt für sich ordnet, hat erst einmal wenig Konsequenzen. Doch Rassismus ist ein System, das mit der Absicht entstanden ist, eine bestimmte Weltordnung herzustellen. Es wurde über Jahrhunderte aufgebaut und ist mächtig. Darin wurde die Hierarchie rassifizierter Gruppen festgeschrieben, und die lautet, ganz grob, so: Weiße ganz oben, Schwarze ganz unten. Wenn also jemand glaubt, Schwarze seien von Natur aus Weißen überlegen, dann ist das zwar theoretisch ein rassistischer Gedanke — aber praktisch ein recht wirkungsloser. Dafür gibt es keine Echokammer, dieser Gedanke wird sich nicht in der Welt widerspiegeln. Anders ist es, wenn jemand glaubt, weiße Menschen seien Schwarzen überlegen. Diese Vorstellung füttert das ohnehin bestehende System. Die Echokammer dafür ist riesig. Dieses System nennt sich White Supremacy — Weiße Vorherrschaft. Wenn ich von Rassismus spreche, dann meine ich diesen wirkungsvollen, systemischen Rassismus, der die Fähigkeit hat, Menschen zu unterdrücken. Dieser Rassismus steckt überall. In meinem Alltag äußert er sich meist in kleinen, unbedachten Handlungen.
Eine Person, die das schon lange vor mir erklärt hat, ist Noah Sow. Sie merkt in ihrem wichtigen Buch Deutschland Schwarz Weiß an, dass Rassismus nicht erst bei dem Unterlegenheitsgedanken anfängt. Sow schreibt: »Heutzutage ist Rassismus der Glaube, dass Menschen bestimmte Prädispositionen (Veranlagungen) jedweder Art haben.« Würde man also annehmen: »Weiße Menschen sprechen hoch, Schwarze Menschen haben ein tiefe Stimme«, dann mag da erst einmal keine Wertung vorliegen. Rassistisch ist die Aussage trotzdem.
Wenn man Rassismus als Denkweise begreift, die ausschließlich bewusst und mit böser Absicht erfolgt, dann ist die Kaffeebudenbesitzerin keine Rassistin. Die Spardose, die sie hat, bleibt allerdings rassistisch. Und während ich vor ihr stehe, frage ich mich: Hätte sie wohl die Spardose so amüsant gefunden, wenn sie einen lächerlichen weißen Menschen abgebildet hätte? Vielleicht wäre dann die Identifikation höher gewesen. Vielleicht wäre ihr aufgefallen, wie degradierend die Figur eines geldfressenden Menschen ist — völlig abgesehen vom geschichtlichen Kontext. Denn das ist meine Auffassung von Rassismus: Er ist schon so lang und so massiv in unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Sprache verankert, hat unsere Weltsicht so sehr geprägt, dass wir gar nicht anders können, als in unserer heutigen Welt rassistische Denkmuster zu entwickeln. (Wer will, kann diesen Satz noch einmal lesen, er ist nämlich sehr wichtig, auch für den Rest des Buchs). Rassismus ist in unserem System. So sehr, dass er oft unbewusst geschieht — besonders der sogenannte Alltagsrassismus.
Rassismus wird man also nicht los, nur weil man behauptet, nicht rassistisch zu sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man am Tag gegen Rassismus demonstriert — und trotzdem Angst bekommt, wenn ein Schwarzer Mann einem nachts über den Weg läuft. Oder dass man kurz überrascht ist, wenn eine Frau mit Hijab perfekt Deutsch spricht. Auch wenn diejenigen, die auf die andere Straßenseite wechseln oder kurz verdutzt sind, nicht weiter darüber nachdenken und glauben, diese eine Sekunde, diese eine harmlose Handlung bliebe unbemerkt und würde keinen großen Unterschied machen, tut sie es doch. Und zwar für die Betroffenen. Eine deutsche Hijabi bekommt täglich verdutzte Blicke, wenn sie den Mund aufmacht. Ein Schwarzer Mann sieht in seinem Leben Hunderte verängstigte Gesichter, wenn er durch die Straßen läuft. Sie bemerken es. Ich bemerke es.
Diese kleinen Momente, sie wirken wie Mückenstiche. Kaum sichtbar, im Einzelnen auszuhalten, doch in schierer Summe wird der Schmerz unerträglich. Diese Mückenstiche haben einen Namen: Mikroaggressionen. Auch davon gibt es unterschiedliche Abstufungen. Das können Angriffe oder Beleidigungen sein wie die Verwendung des N-Wortes oder Aussagen wie: »Wir sind hier in Deutschland.« Es können unbewusste Handlungen sein, wie wenn eine Frau ihre Tasche umkrallt, sobald ich mich in der Bahn neben sie setze. Aber auch das Negieren und Absprechen der eigenen Perspektive und Erfahrungen gehört dazu. Viele Menschen glauben mir nicht, wenn ich sage, dass alte Frauen Angst vor mir haben und mich für eine Diebin halten. Auch Ignoranz ist eine Form der Mikroaggression. Wer vermeidet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann sich immer mit unschuldiger Unwissenheit herausreden. Nur, weil man sich nie bewusst Gedanken über Herkunft, Hautfarbe und Identität gemacht hat, läuft man nicht vorurteilsfrei durch die Gegend. Man bemerkt bloß nicht, dass man diese Vorurteile hat.
All diese Verhaltensmuster tragen dazu bei, das rassistische System aufrechtzuerhalten. Es ist quasi Mikro-Unterdrückung.
Diese Unterschiede im Alltag, die für die meisten um mich herum unsichtbar bleiben, habe ich selbst lange nicht als Form von Rassismus wahrhaben wollen. Ich wusste um den offenen, gewalttätigen, radikalen Rassismus in Deutschland, dessen Opfer ich werden könnte, wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich hatte schreckliche Angst vor Nazis. Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Mölln, die NSU-Morde, Polizeigewalt — diese Vorfälle, und diese Vorfälle allein, waren Rassismus für mich. Davon war mein Alltag weit entfernt. Meine Erlebnisse mit dem gleichen Begriff zu beschreiben, kam mir lange anmaßend vor, als ob ich Opfern offener rassistischer Gewalt das Rampenlicht stehlen oder ihr Leid kleinreden wollte. Stattdessen habe ich selbst von mir gedacht, ich sei zu empfindlich und sollte andere nicht mit meinen Gefühlen belasten. Lieber mitlachen, nichts sagen, lieber bestätigen, dass alles in Ordnung sei. Das wäre doch eine kleine Bürde im Vergleich dazu, um das eigene Leben fürchten zu müssen. Doch gerade die vergangenen Jahre haben aufgezeigt, dass man eine Gesellschaft eben nicht in »die bösen Rassist*innen« und »die Guten« aufteilen kann.
Noch einmal: Rassismus steckt überall in unserer Gesellschaft. Es ist das Märchen über angeborene Eigenschaften, die Annahme, dass wir von Natur aus verschieden seien. Es braucht nur einen bestimmten Kontext, die passende Stimmung und Verkettung von Ereignissen — schon trägt Rassismus nicht mehr nur am rechten Rand Früchte, sondern wuchert überall. Ein blöder Witz, ein heimlicher Gedanke, ein unüberlegtes Vorurteil — es stammt alles aus der gleichen Geschichte, aus der gleichen historischen Wurzel, und gerade treibt und keimt sie ordentlich. Längst sind Dinge wieder salonfähig geworden, die vor ein paar Jahren noch verpönt schienen. Heute diskutieren wir darüber, ob man überhaupt Menschenleben auf dem Mittelmeer retten muss. Wir haben nichts mehr dagegen, wenn nicht-weiße Menschen unter Generalverdacht gestellt werden, Leute haben ernsthaft Angst davor, Muslim*innen könnten in den nächsten Jahren Deutschland vollkommen einnehmen und ein Kalifat errichten. In dieser Stimmung begann ich mich zu fragen, wie lange ich noch mitlachen, schweigen, gut zureden musste. Wie viele Mückenstiche ich noch ertragen musste. Wie schwer die Bürde sein dürfte, bevor ich anfangen könnte, mich zu beschweren. Aber ich begriff, dass es die falsche Haltung war. Da hätte ich lange warten können. Die richtige Frage war: Warum muss ich überhaupt irgendeine Bürde tragen? Wer hat mir die auferlegt?
Ich stand also vor der Kaffeebudenbesitzerin und wusste nicht genau, was nun der beste Schritt für mich und für sie war. Sollte ich eine lange Diskussion riskieren, wenn ich doch einfach nur einen Cappuccino trinken wollte, oder diesen einen weiteren Mückenstich aushalten? Ich schaute sie an und versuchte, möglichst nett zu sagen: »Na ja, das ist doch ein wenig rassistisch, oder?« Wie erwartet fiel ihr das Lächeln aus dem Gesicht. Sie schaute ungläubig auf die Spardose. »Das hier?«, fragte sie. Ich nickte, erzählte ihr von meiner Mutter und ihrer damaligen Aktion in Irland. Die Frau blickte verunsichert auf die Dose. Mir tat es direkt leid, dass ich ihr nun die Freude an ihrer rassistischen Sparbüchse genommen hatte. Als ob ich gerade einem Kind erzählt hätte, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Meine Harmoniebedürftigkeit geht halt nicht so gut mit Rassismus einher. Weil ich befürchtete, dass sie gleich zu einer Rechtfertigung ansetzen könnte, nahm ich den Kaffee und ging zu meinem Platz. Mehr brachte ich nicht übers Herz — aber immerhin, mehr als sonst.
Ich glaube, dass man rassistisches Verhalten nur durch bewusste Konfrontation ändern kann. Das ist nicht leicht. Wer wirklich etwas gegen Diskriminierung tun möchte, sollte bei sich selbst anfangen. Damit meine ich wirklich alle, auch mich. Rassismus ist vielschichtig, nur weil ich davon betroffen bin, heißt das nicht, dass ich nicht dazu beitrage, das System aufrechtzuerhalten. Allerdings müssen vor allem diejenigen, die nicht betroffen sind, sich mal bewegen. Das verlangt Offenheit. Aushalten. Von Scham, von Wut, von Traurigkeit. Von diesem unangenehmen Gefühl, das sich in der Magengegend ausbreitet, sich auf die Brust legt und in den Kopf schießt. Das einen erst einmal dazu bewegt, den Kopf zu schütteln. Sich den eigenen Vorurteilen zu stellen, verlangt Veränderung. Loslassen von Dingen, die einem lieb sind. Und Verantwortung. Klingt erst einmal nicht so toll. Klingt aber auch wie Therapie. Und danach geht es einem bekanntlich meist besser.
Ein Diskurs über Rassismus lohnt sich nicht, wenn Menschen nur das Ziel haben, ihren eigenen Hintern vor Vorwürfen zu retten. Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten — und die fängt bei einem selbst an. Das kann hier und da unbequem werden, und es ist normal, dass wir empfindlich auf Rassismusvorwürfe reagieren. Aber wir sollten lernen, das auszuhalten. Gerade weiße Menschen brauchen da mehr Rückgrat. Ich will, dass sich etwas ändert, und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Kontext und Aufklärung zu dieser Veränderung beitragen können.
Als ich ein paar Wochen später wieder an der Kaffeebude stand, war die Spardose übrigens weg. Ich weiß nicht, ob mein verhaltener Hinweis der Grund war. Vielleicht hat die Frau selbst recherchiert. Vielleicht hat sie andere Menschen gefragt. Ich weiß es nicht, jedenfalls ist das Ding nicht mehr da. Und das machte mir Hoffnung, dass Reden vielleicht doch hilft.
Doppelt oder Halb?
»Na, wie alt bist du denn?« »Wie heißt du?« »Gehst du schon in den Kindergarten?« »Bist du schon in der Schule?« Ich erinnere mich an diese Fragen aus der Froschperspektive. Sie wurden mir von Erwachsenen gestellt, die heruntergebeugt mit hoher, manchmal etwas zu lauter Stimme mit mir sprachen. Es waren Freund*innen von Eltern, Menschen im Supermarkt, in der Bahn. So wie jedes andere Kind auch streckte ich die entsprechende Anzahl von Fingern in die Luft, beantwortete alle Fragen entweder sehr leise, sehr laut, nickte oder schüttelte den Kopf. Durch diese Fragen lernen Kinder, was sie in dieser Welt interessant macht, was für Informationen Menschen brauchen, um sie einzuordnen. An die Fragen sind Erwartungen und Bewertungen geknüpft. Seit ich denken kann, wurde mir allerdings noch eine Frage gestellt, die die weißen Kinder um mich herum nicht beantworten mussten: »Wo kommst du her?«
Ich lernte schnell, dass nicht nur Name, Alter, Familie und Bildungsstand Bedeutung hatten, sondern für mich noch eine weitere Sache essenzieller Bestandteil meiner Person war: meine Herkunft. Oder besser gesagt: die meiner Mutter. Ich kam nämlich, wie alle anderen auch, aus Köln — doch ich merkte schnell, dass das nicht die »richtige« Antwort auf die Frage war. »Woher kommst du wirklich?«, lautete stets die Nachfrage. »Wo liegen deine Wurzeln?«
Als ob mein Deutschsein nicht echt wäre und sich dahinter noch eine wahrhaftigere Identität verbergen würde. »Aus Amerika«, sagte ich stattdessen. Das führte allerdings dazu, dass die Menschen glaubten, ich sei dort geboren und könne deshalb alle weiteren Fragen über Amerika beantworten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich wenig über die USA. Primär verband ich das Land mit Wolkenkratzern und McDonald’s. Mir war klar, dass meine Mutter und meine Oma dort zur Welt gekommen waren und dass ich einen Onkel hatte, der dort lebte. Ich konnte Englisch sprechen. Mehr allerdings nicht.
Es gibt wohl zwei Wege, wie man mit der Wo-kommst-du-her-Frage umgehen kann. Man wehrt sich gegen das Schubladendenken, oder man versucht hineinzupassen. Das Erste ist zwar empfehlenswerter — leider war ich eher Typ zwei. Ich merkte, dass Menschen spannende Geschichten über mein Leben und meinen Alltag erwarteten. Die Wahrheit war jedoch, dass sich mein Alltag nicht besonders von dem der anderen Kinder unterschied. Ich hatte eine blühende Fantasie, also dachte ich mir manchmal Dinge über Amerika aus. Alles, was ich aus dem Fernsehen, aus Büchern und aus Erzählungen meiner Mutter und meiner Oma über die USA wusste, wob ich in meine Beschreibungen hinein.
Das funktionierte nur bedingt — denn die Fragen hörten nicht auf. Oft wollten Menschen wissen, wann und wie ich nach Deutschland gezogen sei und warum. Je nach Situation gestand ich entweder meine Lügen, gab sie teilweise zu oder log einfach weiter.
Besonders deutlich wurde mein Dilemma an einem Tag in der Grundschule. Unsere Klassenlehrerin hatte eine besondere Aufgabe für die nicht-weißen Kinder in unserer Klasse. Das waren die gleichen Kinder, die statt in den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht in die »Auffanggruppe« geschickt wurden. Sie bat uns, etwas aus »unserer Heimat« mitzubringen — und anhand dessen etwas über »unser Land« zu erklären. Blöd nur, dass ich kein Vorzeigeobjekt aus den USA besaß. Zumindest nichts, worüber ich eine Geschichte hätte erzählen können.
Ich beschloss, einen kleinen rosafarbenen Traumfänger mitzubringen, den mein Vater mir einmal auf einem Mittelaltermarkt geschenkt hatte. Ich erzählte, dass wir ihn in Amerika gekauft hätten, von »In*ianern«, und dass mir der »Häuptling« höchstpersönlich gesagt hätte, ich würde damit keine Albträume mehr bekommen. Das hat alle ziemlich beeindruckt, auch meine Grundschullehrerin. Wenn ich mich heute daran zurückerinnere, bin ich erstaunt, dass sie mir das überhaupt abgenommen hat. Ich frage mich auch, warum ich mir genau diese Geschichte ausgedacht habe, wenn ich doch bei »USA« zunächst an Hochhäuser und Fast Food dachte. Vielleicht wusste ich schon, dass ein gewisser Exotismus von mir erwartet wurde. Etwas Mysteriöses, das mit alten Bräuchen oder Aberglauben zu tun hatte.
Viele mögen die Frage nach der Herkunft als freundliche Neugier verbuchen, als besonderes Interesse am Hintergrund einer Person. Aber die Frage nach der Herkunft, wie sie mir auch heute noch gestellt wird, bekundet meist kein Interesse an mir, sondern an der Bestätigung bestimmter Vorurteile. Vorurteile, die eine ganz bestimmte Antwort erfordern. Das fing schon damit an, dass viele fragten: »Woher kommt dein Vater?«, selten hingegen: »Woher kommt deine Mutter?« Weil sie die Zuwanderung Schwarzer Menschen mit Männern verbanden anstatt mit Frauen. Genauso wenig zogen sie die USA als mögliches Herkunftsland in Betracht. Nicht selten kamen Nachfragen auf meine Amerika-Antwort, wie: »Meinst du Südamerika?«, oder: »Meinst du Afrika?«, oder: »Hast du noch Wurzeln anderswo?« Die Fragenden erwarten etwas »Exotisches«, sie wollen etwas über Orte hören, an denen die Sonne scheint und Kokospalmen wachsen. Etwas über andere Sitten, ein simpleres Leben, wo die Menschen zwar wenig haben, dafür aber viel lachen und tanzen, sie wollen etwas hören über scharfes Essen und wilde Tiere. Als Kind hatte ich das Gefühl, es läge an mir, diese rassistischen Klischees irgendwie zu erfüllen.
Die Frage nach Herkunft ist eine intime Frage, wenn sie von weißen Menschen an nicht-weiße Menschen gestellt wird. Sie schafft ein Ungleichgewicht. Ich muss mich erklären, ich muss Dinge über meine Familiengeschichte offenbaren. Mein Gegenüber muss das nicht. Diese Frage kann Wunden aufreißen: Sie kann indirekt nach Geschichten über getrennte Familien, Flucht, Verlassen- oder Verstoßenwerden verlangen. Sie will auch wissen, warum man denn jetzt in Deutschland ist, fordert also eine Art Rechtfertigung.
Ich müsste die Frage »Hast du noch Wurzeln anderswo?« ehrlicherweise so beantworten:
»Ja, Teile meiner Wurzeln liegen in Afrika. Allerdings kann ich sie nicht mehr genau nachvollziehen, weil meine Vorfahr*innen entführt, ihrer Heimat entrissen, in die USA gebracht und versklavt wurden. Ihnen wurde verboten, ihre Sprache zu sprechen, sie mussten ihre eigenen Namen ablegen und den ihrer ›Besitzer*innen‹ annehmen. Die Spuren sind also absichtlich verwischt worden und nur schwer bis gar nicht recherchierbar. Das führt bis heute zu einer massiven Lücke in meiner Identität, so wie bei vielen anderen Afroamerikaner*innen auch. Die Sehnsucht, mehr über diese Wurzeln zu wissen, nimmt nicht ab, weil Afroamerikaner*innen bis heute als US-Bürger*innen zweiter Klasse gesehen und behandelt werden.
Die Identifikation mit den afrikanischen Wurzeln ist ein schwer diskutiertes Thema in der afrikanischen Diaspora, besonders bei Nachfahr*innen von versklavten Schwarzen, also denjenigen, die mehrheitlich in den Amerikas und der Karibik leben. Viele Menschen sind der Meinung, dass die Hervorhebung der afrikanischen Herkunft immer wieder an Wurzeln erinnere, die mittlerweile lange zurücklägen, und die ständige Betonung davon einen daran hindere, als gleichwertig akzeptiert zu werden. Man nennt weiße Amerikaner*innen ja auch nicht Euro-Amerikaner*innen.
Wieder andere meinen, dass ein Herunterspielen dieser Wurzeln die vollendete Anpassung an eine kolonialisierte Welt sei. Eine Resignation im Kampf gegen ein rassistisches System, wo einzig der Lebensentwurf weißer Menschen als erstrebenswert gilt. Man würde dem brutalen Entreißen aus afrikanischen Kulturen, dem Verlust von Familie und Identität letztendlich stattgeben. Ich persönlich finde beide Ansätze nachvollziehbar, für mich ist es ja noch komplizierter, weil ich als Tochter einer US-Amerikanerin in Deutschland geboren bin. Meine Wurzeln sind ein komplexes Thema, ich könnte darüber ein ganzes Buch schreiben.«
Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass diese Antwort den Rahmen des Smalltalks sprengen würde.
Die eigentliche, versteckte Frage hinter »Wo kommst du her?« ist: »Warum bist du Schwarz?« oder »Wie Schwarz bist du?«. Als ich das verstand, formulierte ich im Laufe der Jahre meine Antwort um. »Ich bin halb deutsch, halb Schwarz«, sagte ich. Tatsächlich funktionierte das viel besser, es kamen meist keine Nachfragen. Mir ist es noch nie untergekommen, dass jemand diese Formulierung komisch fand, aber eigentlich ist sie das. Wie sieht denn eine halbe Identität aus? Eine halbe Nationalität? Mein deutscher Pass ist vollständig, mein amerikanischer auch. Somit ist meine Herkunft nicht halb, sondern doppelt. Das würde die Existenz mehrerer Herkünfte aber nicht defizitär, sondern positiv beschreiben — und das scheint irgendwie nicht vorgesehen, das wäre ja sonst unfair gegenüber den Menschen mit nur einer Herkunft.
Zusätzlich brachte mich meine Halb-Halb-Antwort dazu, zwei Dinge strikt zu trennen: deutsch und Schwarz. Ich war Schwarz, deshalb konnte ich wohl nicht deutsch sein. Ich teilte mich immer wieder in die Bestandteile meiner Eltern auf. Als ob meine Herkünfte wie Öl und Wasser wären, nicht zusammengingen. Als ob daraus nichts Neues entstehen könnte, das es wert wäre, einen eigenen Namen, einen eigenen Platz in der Gesellschaft zu bekommen.
Warum unterscheiden wir überhaupt zwischen Schwarz und weiß? »Tja, weil es ziemlich offensichtlich ist«, wäre eine einfache Antwort, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit.
Denn wo ziehen wir die Grenze zwischen Schwarz und weiß? Nicht unbedingt bei der Farbe der Haut. Farbenmäßig haben Schwarze Menschen ein weitaus breiteres Spektrum als weiße. Genetisch gesehen bin ich zu einem größeren Teil weiß als Schwarz, weil es im Stammbaum meiner Mutter schon weiße Menschen gab, auf der Seite meines Vaters aber, soweit ich weiß, keine Schwarzen Menschen. Aber Weißsein ist wie ein exklusiver Club, da kommt man nicht einfach so rein. Meine Schwester zum Beispiel hat so helle Haut wie viele weiße Menschen auch. Doch sie wird genauso oft nach ihrer Herkunft gefragt wie ich, wegen ihrer lockigen Haare, ihrer braunen Augen und vollen Lippen. Es gibt Schwarze Menschen mit schmalen Lippen, glatten Haaren oder blauen Augen. Was also macht einen Schwarz? Wie muss man aussehen, wo muss man herkommen, um Schwarz zu sein?
Ein besonders anschaulicher Fall in dieser Frage sind die Zwillinge Lucy und Maria A. aus Großbritannien. Lucy hat rote wellige Haare und blasse Haut, Maria Locken und braune Haut. Das heißt, die eine ist Schwarz, die andere weiß — zumindest für den Rest der Welt. Doch sie haben dieselben Eltern, wachsen beide mit Schwarzen und weißen Einflüssen auf. Wo ist also der Unterschied?
Es wäre schön, sagen zu können, es gäbe keinen Unterschied, und damit die Diskussion um Hautfarbe, Herkunft und Rassismus einzustellen. Wir könnten uns darüber freuen, dass es Schwarz und weiß gar nicht wirklich gibt und dass wir alle eins sind. Hautfarbe ist egal, Bezeichnungen wie Schwarz und weiß sind obsolet. Wäre schön — so einfach ist es aber nicht.
Vor allem ist es wichtig, eines zu verstehen: Es gibt keine Menschenrassen. Es gibt allerdings die Erfindung der Menschenrassen — die Rassifizierung. Sie dient dazu, eine Hierarchie zwischen Menschengruppen zu etablieren. Bereits Aristoteles fing damit an. Er schrieb über die »Barbaren« und meinte damit Völker, die seiner Ansicht nach den Griech*innen kulturell unterlegen waren. Später wurde insbesondere nach Familienzugehörigkeit rassifiziert. Während der Reconquista, den Kreuzzügen und der damit einhergehenden Christianisierung wurde das Konzept der Blutlinien stärker etabliert. Adelsfamilien sicherten so ihren Status, aber es diente auch dazu, weiterhin zwischen »echten Christen« und beispielsweise ehemaligen Juden und Jüdinnen oder Muslim*innen unterscheiden zu können.
Ende des 15. Jahrhunderts setzte ein neues Zeitalter der Rassifizierung ein. Mit der Erkundung der Welt begannen Europäer*innen, eine globale Ordnung herzustellen, die auf Hautfarbe und Ethnie beruhte. Dieses Denken wurde bis zum 20. Jahrhundert kaum angezweifelt. Ziemlich lang also stützte sich das Verständnis der Europäer*innen von der Welt auf dieses ausgedachte Konstrukt. Dazu trug besonders die verwissenschaftlichte Rassifizierung ab dem 17. Jahrhundert bei. Sogenannte »Rassentheorien« gab es über die Jahrhunderte einige. Ein maßgeblicher Konstrukteur der Menschenrassen war der schwedische Zoologe Carl von Linné mit seinem Systema Naturae. Er unterteilte die Weltbevölkerung in vier Hautfarben: Weiß für die Europäer*innen, Rot für Amerikaner*innen, Braun für Asiat*innen und Schwarz für Afrikaner*innen. Später änderte er die Farbe der Asiat*innen von Braun zu Gelb.
In der Rassentheorie gab es, grob gesagt, zwei unterschiedliche Ansätze. Manche Forschende gingen tatsächlich von unterschiedlichen Menschenrassen aus, die nicht miteinander verwandt waren. Diese These nennt man die »Polygenese«. Andere Forschende vertraten die Theorie der Monogenese, die besagt, alle Menschen wären zwar derselben Abstammung, jedoch unterschiedlich weit entwickelt — beziehungsweise degeneriert. Viele waren damals der Ansicht, dass der Mensch weiß und vollkommen auf die Welt gekommen wäre und sich immer weiter von seinem Ursprung entfernt hätte. Ob Poly- oder Monogenese, alle Forschende kamen zum gleichen Schluss: Unter den »Menschenrassen« gab es eine Hierarchie. Ganz oben waren weiße Menschen.
Dass sich die Zuschreibung der Hautfarben bis heute gehalten hat, haben wir übrigens besonders einem Deutschen zu verdanken: Johann Friedrich Blumenbach. Er teilte 1775 die Menschheit in fünf Farben und Abstammungen ein: Weiß für die »kaukasische Rasse«, Gelb für Menschen ostasiatischer Abstammung (»mongolische Rasse«), Braun für Menschen südasiatischer Abstammung (»malayische Rasse«), Rot für indigene Völker amerikanischer Abstammung (»amerikanische Rasse«) und Schwarz für Menschen afrikanischer Abstammung (»äthiopische Rasse«). Blumenbachs Theorie ging in offizielle US-amerikanische Dokumente ein und sorgte so dafür, dass seine Farbzuschreibungen und Begriffe zum Teil erhalten blieben. Wegen ihr sprechen US-Amerikaner*innen oft von caucasians, wenn sie weiße Menschen meinen.
Schon damals hatten Forscher*innen unterschiedliche Haltungen dazu, wer genau in welche Kategorie gehörte. Besonders uneinig waren sie sich bei weißen Menschen. Wer durfte in den Club der Privilegierten — wer war am Weißesten —, wer unter ihnen war die tatsächliche »Herrenrasse«? Menschen aus dem Kaukasus und Europa, nur Menschen aus Europa? Waren Juden und Jüdinnen mit inbegriffen? Waren die aus Nordindien stammenden Arier*innen weiß, die mittlerweile im Irak lebten?
Forschende legten ihre Rassentheorien nach ihren eigenen Interessen aus. Sie erstellten diese Konstrukte, um eine Rechtfertigung zu finden, andere Menschen auszubeuten und zu vereinnahmen. Tupoka Ogette bringt es in ihrem Buch exit RACISM auf den Punkt:
»Die Europäer waren nicht zu Sklavenhändlern geworden, weil sie Rassisten waren. […] Sie wurden zu Rassisten, um Menschen für ihren eigenen Profit versklaven zu können. Sie brauchten eine ideologische Untermauerung; eine moralische Legitimierung ihrer weltweiten Plünderungsindustrie. Kurz und plakativ: Sie wollten gut schlafen.«
Dieser riesige Teil Weltgeschichte hat unsere Gesellschaft geprägt — und tut es noch bis heute. Das kann man an großen Dingen sehen: zum Beispiel daran, dass Afrika als der ärmste Kontinent der Welt gilt, obwohl er so viele Bodenschätze besitzt, dass die Straßen eigentlich mit Gold gepflastert sein müssten. Oder an kleinen Dingen: dass ich nicht als deutsch wahrgenommen werde, weil ich Schwarz bin, und deshalb ständig gefragt werde, wo ich herkomme.
Hautfarbe ist nicht egal. Leider nicht. Das zu ignorieren, bringt uns nicht weiter. Deshalb bezeichne ich mich selbst als Schwarz. Es ist ein wichtiger Teil meiner Identität und spiegelt mein Verhältnis zur Weltgeschichte wider. Ich schreibe »Schwarz« groß, denn es bezieht sich nicht auf die tatsächliche Farbe meiner Haut, schon gar nicht auf eine biologische »Rasse«. Es ist meine Selbstbezeichnung, Teil meiner Identität.
Der Duden definiert Identität so: »Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird«. Diese Identität ist aus gesellschaftspolitischen Gründen entstanden. Mit weiß ist ebenso wenig eine biologische Rasse oder eine tatsächliche Farbe gemeint. Um das zu verdeutlichen, wird es in diesem Buch kursiv geschrieben.
Weiße scheinen sich allerdings erst noch daran gewöhnen zu müssen, dass man sie, wie alle anderen Menschen auch, kategorisieren kann. Oft merke ich, dass es weißen Menschen unangenehm ist, auszusprechen, dass sie weiß sind. Sie finden es sogar rassistisch, wenn man sie darauf hinweist. Aber weiße Menschen sind kein Neutrum, sondern haben eine ganz bestimmte Perspektive auf die Welt. Sie sollten merken, dass ihre Hautfarbe und ihre Herkunft ebenso von Bedeutung sind wie bei allen anderen auch. Weiße waren es, die Menschen rassifiziert und uns voneinander getrennt haben. Sie profitieren bis heute davon, so wie nicht-weiße Menschen bis heute noch die Nachteile dessen spüren.
Die Frage, wer weiß