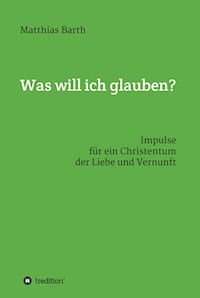
10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Christentum und Kirche haben in den vergangenen Jahrzehnten massiv an Bedeutung verloren. Neben gesellschaftlichen Ursachen liegt dieser Entwicklung auch ein Versagen der Kirche zugrunde: Sie hat viel zu lange an traditionellen Glaubenswahrheiten festgehalten. Dass die Bibel Gottes Wort ist, Jesus Gottes Sohn und Gott selber ein allmächtiges, jenseitiges Wesen - mit diesen Glaubensaussagen können viele Menschen heute nichts mehr anfangen. Auch mit der traditionellen Vorstellung des dreieinigen Gottes oder dem Gebet zu einem jenseitigen Gott haben manche ihre liebe Mühe. Sie geraten deshalb an den Rand der Kirche oder treten aus. Denn sie hören nichts davon, dass die traditionellen Glaubenswahrheiten auch anders verstanden werden können. Das Buch zeigt auf, wie der Verzicht auf die Vorstellung eines in die Welt eingreifenden Gottes Raum schafft für ein aufgeklärtes, weltzugewandtes Christentum. Grundlage ist ein Verständnis von Religion als kulturelle Errungenschaft des Menschen ohne göttliche Offenbarung. In weiteren Kapiteln werden mögliche Konsequenzen für die kirchliche Praxis skizziert. Auch die traditionellen christlichen Feste lassen sich neu verstehen und anders feiern. Was will ich glauben? Die Frage ist keine Einladung zu religiöser Beliebigkeit, sondern ermutigt zum selbstbestimmten Umgang mit der christlichen Tradition. Ein Buch über den Glauben - auch für 'Ungläubige'.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Matthias Barth (*1955), Theologiestudium an der Universität Basel, dazwischen Ausbildung zum Sozialpädagogen in Zizers, Pfarrer in Kriens, Nidau und Schwarzenburg, Synodalrat in der Reformierten Kirche Kanton Luzern, seit 2019 im Ruhestand in Port (BE)
Matthias Barth
Was will ich glauben?
Impulse für ein Christentum der Liebe und Vernunft
© 2020 Matthias Barth
Verlag und Druck:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-19546-2
e-Book:
978-3-347-19548-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Über mich und dieses Buch
Hinweise zur Lektüre
1. Glaubenswahrheiten – hinterfragt und neu gedeutet
1.1 Offenbarung – vom Himmel geholt
1.2 Bibel – von Menschen für Menschen geschrieben
1.3 Gott – wenn Liebe geschieht
1.4 Schöpfung – natürlich, nicht göttlich
1.5 Theodizee – ein Problem löst sich in Luft auf
1.6 Jesus – ein unfreiwilliger Religionsstifter
1.7 Dreieinigkeit – ein Konstrukt hat ausgedient
1.8 Mensch – gut oder böse?
1.9 Gebet – vom Wort zur Tat
1.10 Glauben – von den Fesseln der Tradition befreit
1.11 Lieben – nichts mehr
2. Religion – nicht vom Himmel gefallen
2.1 Was ist Religion?
2.2 Wie ist Religion entstanden?
2.3 Wie verhalten sich Religion und Kultur zueinander?
2.4 Ist die Religion auf dem Rückzug?
2.5 Ist Religion Privatsache?
2.6 Ist das Christentum Religion?
2.7 Ist Atheismus das Gegenteil von Religion?
2.8 Ist Agnostizismus der Verzicht auf Religion?
3. Und was ist mit der Kirche?
3.1 Kirche – nicht Gott, sondern dem Leben dienen
3.2 Verkündigung – vom Monolog zum Dialog
3.3 Diakonie – gelebte Nächstenliebe
3.4 Abendmahl – Festfreude statt Todesstimmung
3.5 Lebensrituale
3.5.1 Taufe – Liebe als Verheissung und Bedingungslosigkeit
3.5.2 Konfirmation – Liebe als Verantwortung und Vertrauen
3.5.3 Trauung – Liebe als Versprechen und Offenheit
3.5.4 Abdankung – Liebe als Vergebung und Dankbarkeit
4. Feste und Feiertage
4.1 Ostern – Auferstehung ins Diesseits
4.2 Karfreitag – wenn die Liebe gekreuzigt wird
4.3 Himmelfahrt Jesu – der Glaube wird erwachsen
4.4 Pfingsten – wenn die Liebe Rückenwind erhält
4.5 Weihnachten – Menschwerdung des Menschen
4.6 Was wollen wir feiern?
Zum Schluss: Will ich mich (noch) Christ nennen?
Dank
Literatur-Verzeichnis
Link-Verzeichnis
«Die den Lehren der Stifter aller grossen östlichen und westlichen Religionen gemeinsame Haltung besagt, das höchste Ziel des Lebens sei die Sorge um die Seele des Menschen und die Entfaltung seiner Kräfte der Vernunft und der Liebe.»
Erich Fromm
«Es ist ein ganz normaler, ja ein notwendiger Vorgang, dass eine Religion in einem sich geistig verändernden Umfeld neue Ausdrucksformen sucht, ja suchen muss. Eine Krise entsteht nur dann, wenn dies nicht geschieht.»
Helmut Fischer
Über mich und dieses Buch
Was will ich glauben? Ein ungewöhnlicher Titel für ein Glaubensbuch.
Die Frage erweckt den Anschein, als sei der christliche Glaube eine Angelegenheit subjektiver Beliebigkeit. Erwarten wir von einem Buch über den Glauben jedoch nicht eher Klarheit und Gewissheit? Ein stabiles Fundament, auf das wir bauen können? Zudem: Haben wir in unserer Kindheit nicht alle die christliche Überlieferung kennen gelernt als etwas Vorgegebenes, das menschlichem Wünschen und Wollen entzogen ist?
Noch heute heisst der kirchliche Unterricht im Kanton Bern Kirchliche Unterweisung, in anderen Kantonen Religionsunterricht (zu meiner Zeit Christenlehre). Der Begriff Sonntagschule ist inzwischen in den meisten Kirchgemeinden durch andere Bezeichnungen ersetzt worden. Alle diese Begriffe legen nahe, dass der christliche Glaube ein Gegenstand des Lehrens und Lernens ist. Eine Sammlung von unveränderlichen Glaubensinhalten: Dass Gott die Welt geschaffen hat, sich verschiedenen Personen offenbart und das Volk Israel als sein Volk erwählt hat. Dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, der geboren wurde von der Jungfrau Maria. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und dass er nach drei Tagen leiblich auferstanden und danach in den Himmel aufgefahren ist. Sind das nicht Glaubenswahrheiten, die bleibende Gültigkeit haben, die unveränderlich sind und die man eben einfach glauben muss?
Auch ich habe eine religiöse Sozialisation erlebt, die mir den Glauben als etwas Vorgegebenes nahebrachte. In der Sonntagschule und im Religionsunterricht erzählten die LehrerInnen die biblischen Geschichten als wären es Tatsachenberichte. Die christlichen Glaubenswahrheiten hatten für mich als Kind denselben Stellenwert wie die Regeln der Rechtschreibung oder die Grundsätze der Mathematik. In meinem Elternhaus gab es an der
Existenz eines himmlischen Gottes keine Zweifel. Als meine Mutter mich auf dem Fussballplatz einmal fluchen hörte, rief sie mich nach Hause und fragte mich, ob ich wisse, was dieser Fluch bedeute. Ob es wirklich mein Wunsch sei, dass Gott mich dereinst verdammen werde. Ich weiss nicht mehr, was ich erwiderte, meine aber mich zu erinnern, dass die Ernsthaftigkeit in ihrer Stimme mir Eindruck machte. Heute ist mir bewusst: Auf Grund ihrer eigenen religiösen Sozialisation war es für sie eine echte Not, ihren Sohn so fluchen zu hören.
Meine religiöse Sozialisation erreichte ihren Kulminationspunkt, als ich mich mit knapp 17 Jahren an einer Evangelisationsveranstaltung der Jesus People-Bewegung bekehrte. Auf der Erinnerungskarte, die ich aufbewahrt habe, ist folgender Text zu lesen: „Durch Gottes Wort habe ich erkannt, dass ich verloren bin. Ich bekehre mich darum heute von ganzem Herzen zu meinem Erlöser Jesus Christus. Ich stehe ehrlich zu meinen Übertretungen und glaube, dass Jesus zur Vergebung auch meiner Sünden am Kreuz gestorben ist. Im Glauben an den Beistand des Heiligen Geistes bin ich entschlossen, ein neues Leben zu führen und mich zu Christus zu bekennen. Ich danke Gott für diesen entscheidendsten Tag meines Lebens.“ Unter diesem Text steht, in meiner Handschrift, das Datum und mein Name.
In den Jahren danach besuchte ich die Jugend-Bibelgruppe in meiner Kirchgemeinde. Ich schätzte dort die Möglichkeit, mich am Austausch über biblische Texte selber beteiligen zu können. Allerdings standen diese Bibelgespräche einzig im Dienst der Aneignung und Vertiefung der traditionellen Glaubenswahrheiten. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen fand nicht statt; es ging um ihre Anwendung auf unser Leben. Auch später in der Jungen Kirche, wo ich gerne im Leitungsteam Verantwortung übernahm, bewegte sich der Interpretations-Spielraum im selben Rahmen.
Eine erste kritische Distanz zu dieser in sich geschlossenen Glaubenswelt gewann ich durch mein Theologiestudium. Vor allem im Hinblick auf den Umgang mit der Bibel. Ich lernte, sie historischkritisch zu lesen. Historisch, das heisst als geschichtliches und nicht ihrer Entstehungszeit quasi enthobenes, göttlich inspiriertes Buch. Kritisch, weil unterschieden wird zwischen dem biblischen Bericht über ein Ereignis, allfälligen Vorstufen dieses Berichts und dem tatsächlich geschehenen Ereignis.
Dieser neue Zugang weckte mein Interesse. Er entsprach meiner Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen. Für bisher überlesene oder kleingeredete Ungereimtheiten erhielt ich einleuchtende Erklärungen. So lösten sich beispielsweise Widersprüche in der Schöpfungsgeschichte dadurch auf, dass ich sie als Zusammenstellung von zwei unterschiedlichen Erzählungen verstehen lernte: Ursprünglich von verschiedenen Verfassern aufgeschrieben, wurden sie später miteinander verbunden. Ich begriff, dass die Schöpfungserzählungen auch symbolisch verstanden werden können und nicht wörtlich geglaubt werden müssen. Meinen Glauben an die Existenz eines Schöpfergottes sah ich jedoch nicht in Frage gestellt. Ebenso wenig die anderen traditionellen christlichen Glaubenswahrheiten. Sie überstanden mein Theologiestudium unbeschadet.
Diesbezügliche Fragen und Zweifel meldeten sich dann aber je länger desto stärker im Laufe meiner pfarramtlichen Arbeit. Zweifel beispielsweise an der traditionellen gottesdienstlichen Gebetssprache bzw. deren Voraussetzung eines allmächtigen Gottes, der in unser Leben eingreift. Zweifel daran, dass der Unfalltod einer jungen Frau, die ich beerdigen musste, Gottes Wille war. Zweifel an der Vorstellung, dass ein guter Gott seinen Sohn für die Sünden der Menschheit kreuzigen lässt.
Bei der Suche nach Klärung meiner Zweifel stiess ich auf das Buch «Jenseits von Gott und Göttin. Plädoyer für eine spirituelle Ethik» (Carola Meyer-Seethaler). Das Buch war eine Offenbarung für mich: Es öffnete meinen Blick und bestärkte mich darin, meine
Fragen ernst zu nehmen und jenseits der traditionellen Glaubenswahrheiten nach neuen Antworten zu suchen. Grosse Bedenken hatte ich allerdings, meine Glaubensfragen und meine Zweifel in die pfarramtliche Arbeit einfliessen zu lassen. Ich war der Meinung, ich müsste zuerst neuen Boden gewinnen, neue Antworten geben können. Auch befürchtete ich, Gemeindeglieder in ihrem Glauben zu verunsichern.
Zu einem ersten Umdenken führte mich der unerwartete Kirchenaustritt eines Mitglieds meiner damaligen Kirchgemeinde. Ich lud die austrittswillige Person zu einem Gespräch ein. Zu meiner Überraschung schilderte mir mein Gegenüber mehr oder weniger dieselben Zweifel und Fragen an die christlichkirchliche Tradition, die auch mich umtrieben: Er könne vieles einfach nicht mehr glauben und deshalb nicht mehr guten Gewissens Mitglied der Kirche sein. Mein Einwand, dass gerade in der reformierten Kirche auch kritisch mitdenkende Mitglieder erwünscht seien, mochte ihn nicht zu überzeugen. Zu wenig hatte er wohl die Erfahrung gemacht, mit seinen Fragen willkommen zu sein. Zu sehr war sein Entfremdungsprozess vorangeschritten.
Diese Erfahrung motivierte mich, meine Fragen und kritischen Gedanken mit etwas weniger Zurückhaltung in meine pfarramtliche Praxis einfliessen zu lassen. Nach wie vor aber befand ich mich in einer Spannung zwischen meinem persönlichen Glauben, der in grundlegender Veränderung begriffen war und demjenigen, den ich als Pfarrer in der Öffentlichkeit meinte vertreten zu müssen. Es war ein längerer und herausfordernder Weg des Lernens, auf diesen Glaubens-Spagat mehr und mehr zu verzichten.
Als anspruchsvoll empfand ich diesen Weg aus zwei Gründen: Einerseits bedeutete er, selber Abschied zu nehmen von langjährigen, prägenden und liebgewordenen Glaubensvorstellungen. Auch wenn sie für mich nicht mehr plausibel und nicht mehr lebbar waren, empfand ich diesen Abschied als schmerzhaften und mit Trauer verbundenen Prozess. Und ich musste erfahren, wie schwierig es ist, ohne Skrupel und schlechtes Gewissen ein Gottesbild hinter mir zu lassen, das viele Jahre Grundlage meines Glaubens war. Anderseits ging ich diesen Weg in den ersten Jahren alleine. Setzte mich quasi im stillen Kämmerlein mit meinen Fragen und Zweifeln auseinander. Meine Begleiter waren einzig weitere Bücher, zum Beispiel die kritische Schrift des anglikanischen Bischofs John Shelby Spong «Was sich in der Kirche ändern muss», die mir in vielem aus dem Herzen sprach.
Ich ahnte zwar schon damals, dass es manch einer Pfarrkollegin, manchem Pfarrkollegen ähnlich ergehen musste. Es dauerte jedoch noch eine ganze Weile, bis sich im Anschluss an einen Weiterbildungskurs eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen zusammenfand, die sich weiter zum Austausch treffen wollten. Uns verband die Erfahrung, dass die alten Glaubensvorstellungen uns nicht mehr zu tragen vermochten. Eine Glaubensreform schien uns unabdingbar – eine Reformation des Glaubens, die diesen Namen auch verdient. Und wir teilten die Überzeugung, dass in der Kirche Platz sein muss für Menschen, die zu den traditionellen Glaubensvorstellungen keinen Zugang mehr finden.
In der Folge entwickelte sich ein äusserst fruchtbarer Austausch und eine gegenseitige Unterstützung, insbesondere bei der Suche nach einer neuen liturgischen Sprache im Gottesdienst. Weg vom traditionellen Bild eines jenseitigen und allmächtigen Gottes, der die Welt regiert, gingen wir der Frage nach: Was kann nach dem Abschied von dieser Gottesvorstellung der neue Sinn des Wortes ‘Gott’ sein? Eine Frage, die weitere Fragen auslöste. Und bei mir selber letztlich zur ganz grundsätzlichen Frage führte: Was will ich glauben?
Auch wenn diese Frage als Ausdruck subjektiver Beliebigkeit verstanden und damit diskreditiert werden kann – ich halte sie für unverzichtbar. Sie stellt sich jedem Menschen, der heute als (religiös) mündiger Mensch seinen Glauben selber verantworten will.
Man mag kritisch einwenden, ob dieser selbstbestimmte Umgang mit dem Glauben nicht dessen Unverfügbarkeit – traditionell gesprochen dessen Geschenkcharakter – in Frage stellt. Ich sehe dies anders. Denn vieles, das mich inspiriert, bewegt, überzeugt, kommt mir weiterhin von aussen zu. Fällt mir zu, ohne mein Zutun.
Ich habe dieses Buch verfasst als eine Art Bilanz meines zurückliegenden Suchprozesses. Es ist der Versuch, meine Antworten auf die Frage: Was will ich glauben? in Worte zu fassen. Diese Frage wird mich weiter begleiten. Insofern verstehe ich meine Überlegungen und Impulse nicht als Schlussbilanz, sondern als Standortbestimmung auf meinem persönlichen Weg des Glaubens.
Zum Schreiben motiviert hat mich auch die Begegnung mit Menschen, die ebenso auf der Suche waren. Die sich – in Anknüpfung an die christliche Überlieferung oder sich von ihr abgrenzend – mit ihren Glaubensfragen und Glaubenszweifeln auseinandersetzten. Zu oft finden sie in der Kirche keinen Raum dafür. Er bleibt denen vorbehalten, die mit den alten Antworten noch gut leben können. Ich widme dieses Buch all denen, die sich damit nicht mehr zufriedengeben wollen und nach neuen Antworten suchen.
Hinweise zur Lektüre
Es ist ein waghalsiges Unterfangen, auf ein paar Dutzend Seiten die breite Palette traditioneller christlicher Glaubensbegriffe neu zu deuten, wie ich es im ersten Kapitel tue. Ohne Verkürzung und Vereinfachung ist das nicht möglich. Dabei habe ich versucht, den Ratschlag von Albert Einstein zu befolgen: «Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.»
Trotzdem mag wohl der eine oder die andere mein Vorgehen wegen allzu grober Vereinfachung als theologisch fragwürdig beurteilen. Ich würde diesen Einwand mit Fassung tragen und entgegnen: Nicht wegen zu grosser Vereinfachung, sondern weil sie zu kompliziert und zu welt- und lebensfremd geworden sind, haben Theologie und Christentum für weite Kreise ihre Bedeutung verloren.
Neben Kürze und Einfachheit setzte ich mir zum Ziel, klar und prägnant zu formulieren, um die Konturen meiner Überlegungen möglichst deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wichtiger als umfassend abgestützte und wohlabgewogene Formulierungen war mir eine eindeutige Ausdrucksweise – da oder dort auch provokativ zugespitzt – um die Aspekte, auf die es mir ankommt, ins Licht zu rücken. Diese Prägnanz soll nicht als Absolutheit verstanden werden. Ich sehe meinen Ansatz auch nicht als einzig mögliche Alternative zum traditionellen Glaubensverständnis. Ich möchte jedoch für diejenigen eine Brücke schlagen, die sich vom Christentum innerlich distanziert haben, weil sie vieles nicht mehr glauben können, von dem sie meinen, es glauben zu müssen.
In der Regel – auch wenn dies nicht explizit vermerkt ist – beziehe ich mich auf die christliche Tradition und religiöse Entwicklungen, wie sie sich im europäischen Raum manifestiert haben. Im dritten und vierten Kapitel richte ich den Fokus auf die kirchlichen Verhältnisse in der Schweiz und dabei insbesondere auf die reformierte Kirche.
Damit die einzelnen Kapitel in sich selber verständlich sind, liess sich die eine oder andere Wiederholung nicht vermeiden. Da und dort verweise ich auf Ausführungen in einem anderen Kapitel. Es ist auch möglich, nach der Lektüre des ersten, grundlegenden Kapitels, die Lese-Reihenfolge nach eigenem Interesse zu gestalten.
Die Literatur, auf die ich Bezug nehme und aus der ich zitiere, ist weder ausgewogen noch umfassend. Es handelt sich hauptsächlich um diejenigen Bücher, die mich im Laufe der vergangenen etwa 15 Jahre begleitet und angeregt haben. Die Zitate sind auch als Referenz an deren Verfasser zu verstehen und bringen zum Ausdruck, dass ich meine Gedanken vielfacher Anregung verdanke.
Die Quellen der Zitate aus Büchern sind im Literatur-Verzeichnis zu finden, diejenigen aus dem Internet unter der jeweiligen Nummer (L1,2,3, usw.) im Link-Verzeichnis. Das Link-Verzeichnis ist auch online abrufbar.
1. Glaubenswahrheiten – hinterfragt und neu gedeutet
Um es vorwegzunehmen: Ich sehe hinter den Glaubensvorstellungen des Christentums keinen himmlischen Ursprung mehr. Sie haben irdische Wurzeln. Menschen haben sie formuliert, weiterentwickelt, über sie gestritten – und haben sie schliesslich zu göttlichen Glaubenswahrheiten erklärt. Als solche sind sie heute für viele unglaubwürdig geworden. Trotzdem halten die Kirchen an ihrer Unabänderlichkeit fest. Mein Anliegen ist es, sie vom Ballast der göttlichen Herkunft zu befreien und sie neu zu deuten als religiöse – wenn man will auch spirituelle – Ressourcen einer menschenfreundlichen Lebensbewältigung.
Mit den Begriffen Liebe und Vernunft im Untertitel des Buches signalisiere ich, zwischen welchen Polen sich meine Deutung bewegt. Zur Liebe wird in den folgenden Kapiteln vieles ausdrücklich und wiederholt gesagt werden. Deshalb verzichte ich hier auf weitere Ausführungen. Die Vernunft hingegen kommt weniger explizit zur Sprache, sie steckt aber deutlich spürbar in meiner Argumentation. Ja, für den einen oder die andere mag es des Guten etwas gar viel sein. Trotzdem – oder gerade deshalb – an dieser Stelle einige Gedanken dazu.
Oft werden Glaube und Vernunft, glauben und denken als unvereinbare Gegensätze gesehen. Einerseits von Religionskritikern, die fragen: Glaubst du noch oder denkst du schon? Anderseits von Religionsvertretern, die fordern: Das musst du eben einfach glauben! In beiden Fällen steckt hinter dieser Entgegensetzung ein Verständnis von Glauben als Übernahme vorgegebener Glaubensinhalte – auch dann, wenn diese vernünftigem Denken widersprechen. Ein Verständnis von Glauben als – wenn es sein muss blinder – Glaubensgehorsam.
Glaube, so wie ich ihn verstehe (siehe Kap. 1.10), steht nicht im Widerspruch zur Vernunft. Im Gegenteil: Der Glaube ist auf die Vernunft angewiesen. Der katholische Theologe Gotthold Hasenhüttl illustriert das mit folgendem Bild: Die Religionen bzw. deren Heilige Schriften gleichen Seen, aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Das Seewasser stammt aus verschiedenen Quellen und enthält auch durch Menschen verursachte Verunreinigungen. Deshalb darf man dieses Wasser nur trinken, wenn es von einer Kläranlage gereinigt worden ist. Zu dieser Kläranlage der Religionen und ihrer Heiligen Schriften sagt Hasenhüttl: «Sicher … ist, dass der Name der Kläranlage Vernunft und Liebe ist.» (GH 15)
Die Bedeutung des Klärfilters Vernunft stellten die Kirchen lange Zeit kaum grundsätzlich in Frage. Die Kirchen- und Theologiegeschichte mit ihren Debatten, den Gottesbeweisen, den Versuchen, die kirchliche Lehre mit philosophischen Erkenntnissen in Einklang zu bringen, strotzt von denkerischen Leistungen. Mittelalterliche Kirchenlehrer wie Petrus Abaelardus (11./12. Jh.) konnten Sätze sagen wie: «Man kann nicht glauben, was man nicht versteht.» (HH KeC 127) Als jedoch die Erkenntnisse der Aufklärung etwa ab dem 17. Jahrhundert den Klärfilter Vernunft auf revolutionäre Art verbesserten und verfeinerten, verweigerten die Kirchen dessen weitere Verwendung. Sie befürchteten, das Wasser des Glaubens verliere seine Substanz. Mit dieser Verweigerung erklärten sie Glauben und Vernunft zu Kontrahenten. Sie verhinderten damit – auch zu ihrem eigenen Schaden – eine vernünftige, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des christlichen Glaubens.
1.1 Offenbarung – vom Himmel geholt
Warum halten sich die traditionellen christlichen Glaubenswahrheiten so hartnäckig, obwohl sie für einen Grossteil der Menschen nicht mehr mit ihrem Weltbild vereinbar sind? Das hat zunächst damit zu tun, dass sich christlicher Gottesglaube seit seinen Anfängen als Antwort auf eine übernatürliche, göttliche Offenbarung versteht.
Hinter der Offenbarungs-Idee steht einerseits die Vorstellung eines überirdischen Gottes. Anderseits die Überzeugung, dass dieser Gott den Menschen seinen Willen kundtut. Offenbarung wird also verstanden als übernatürliches Geschehen, als Einbruch von einem Jenseits ins Diesseits.
Im engeren Sinn gilt Jesus Christus als Offenbarung Gottes. Weil das Neue Testament von dieser Offenbarung Zeugnis ablegt, wird in einem weiteren Sinn auch die Bibel als Offenbarung, als geoffenbartes Wort Gottes verstanden. Mehrfach lesen wir im Heidelberger Katechismus (16. Jh.) – dem Klassiker für reformiertes Glaubensverständnis – Gott habe sich in seinem Wort offenbart.
Die Unveränderlichkeit der überlieferten christlichen Glaubenswahrheiten hat ihren Grund also letztlich in der Autorität übernatürlicher göttlicher Offenbarung. Traditioneller christlicher Glaube ist damit im Kern immer Gehorsam dieser Autorität gegenüber.
Offenbarung, verstanden als Manifestation von etwas Übernatürlichem, kommt mehr oder weniger in jeder Religion vor. Auch in Religionen, die sich – anders als das Christentum mit der Menschwerdung Jesu – nicht auf ein bestimmtes geschichtliches Offenbarungsereignis berufen.
Von göttlicher zu menschlicher Autorität
Die Behauptung übernatürlicher bzw. göttlicher Autorität hat notwendigerweise zu menschlicher Autorität geführt, welche die Offenbarung vermittelt, interpretiert und durchsetzt. Am deutlichsten Ausdruck gefunden hat dieser Umstand im päpstlichen Lehramt der römischkatholischen Kirche. In der reformierten Kirche ist diese menschliche Autorität weniger fassbar. Es sei denn, sie tritt in Gestalt von geistliche Autorität beanspruchenden, oft fundamentalistisch ausgerichteten (Pfarr-)Personen auf.
Durch die Entwicklung des frühen Christentums zur Kirche, im 4. Jahrhundert dann zur Staatskirche, verband sich diese menschliche Autorität mehr und mehr mit institutioneller Macht. Dies erleichterte die Durchsetzung einer bestimmten Interpretation der göttlichen Offenbarung erheblich. Wer sich ihr nicht fügte, musste mit dem Ausschluss, während Jahrhunderten gar mit dem Tod als KetzerIn rechnen.
Darin zeigt sich ein weiteres Problem des traditionellen christlichen Offenbarungsglaubens, nämlich die ihm innewohnende Tendenz zur Absolutheit. Diese wirkte sich nicht nur innerkirchlich aus, sondern bestimmte ebenso das Verhältnis zu anderen Religionen.
Der Absolutheitsanspruch des Christentums gegen aussen kleidete sich beispielsweise in Worte wie diese: «Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus gilt als abschliessend, endgültig, unüberbietbar, universal. Mag Gott sich auch sonst noch auf mancherlei andere Weise … offenbart haben und noch offenbaren … – entscheidend hat er es durch Jesus Christus getan … In ihm hat Gott endgültig und ein für allemal zur Welt ‘geredet’: Jesus Christus ist das ‘Wort Gottes’ an die ganze Menschheit.» (HZ 261)
Ein grosser Teil der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Religionen hat mit deren je behauptetem Anspruch auf die Letztgültigkeit der eigenen Offenbarung zu tun. Und je stärker sich eine Religion für ihre Wahrheit auf exklusiven, übernatürlichen Ursprung beruft, desto weniger wird sie zu einem Dialog auf partnerschaftlicher Ebene bereit sein. (Ohne hier näher auf die Problematik der Religionskriege eingehen zu wollen, möchte ich immerhin festhalten: Nicht jede als ‘Religionskrieg’ deklarierte Auseinandersetzung hat rein religiöse Ursachen. Die Wirklichkeit ist meist komplexer als es die Etiketten suggerieren, mit denen sie versehen wird.)
Behauptete Autorität
Die grundlegende Problematik von durch Menschen beanspruchter göttlicher Autorität liegt darin, dass sie einfach behauptet werden kann. Sie lässt sich weder beweisen noch widerlegen. Man kann ihr höchstens widersprechen. Am wirkungsvollsten natürlich, wenn man sich ebenfalls auf göttliche Offenbarung beruft. Göttliche Autorität steht dann gegen göttliche Autorität. Die Berufung auf göttliche Autorität entpuppt sich so letztlich als Totschlagargument – wie die Geschichte zeigt, manchmal gar im wörtlichen Sinn.
Damit ist auch gesagt, dass durch Berufung auf göttliche Autorität die Inhalte letztlich beliebig werden. Göttliche Autorität lässt sich in Anspruch nehmen für alles Mögliche; und damit sowohl für, aber auch gegen dasselbe Anliegen. So haben beispielsweise der Theologe Karl Barth und die Bekennende Kirche in Deutschland ein deutliches Nein im Namen Gottes zum Nationalsozialismus ausgesprochen. Aber auch Adolf Hitler hat sich auf göttliche Autorität berufen, u.a. in «Mein Kampf»: «So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre kämpfe ich für das Werk des Herrn.» (L1)
Da ich nicht mehr an einen überirdischen Gott glauben kann und will, ist für mich die Vorstellung einer göttlichen Offenbarung sinnleer geworden. Trotzdem behält der Begriff ‘Offenbarung’ für mich eine Bedeutung. Im Vorwort habe ich geschrieben, dass die Lektüre des Buches von Carola Meier-Seethaler eine Offenbarung für mich war, weil sie mir neue Horizonte eröffnete. Der Theologe Gotthold Hasenhüttl beschreibt diese innerweltliche Möglichkeit einer Offenbarungserfahrung so: «Wir meinen damit, dass wir im Umgang mit Sachen und vor allem mit Menschen eine Erfahrung gemacht haben, die uns etwas zeigt, wodurch wir klüger, erfahrener geworden sind.» (GH 16)
Das bedeutet, dass Offenbarung zwar von aussen zu mir kommt, aber doch eine irdische Erfahrung ist. Zudem hat nichts aus sich selbst heraus Offenbarungscharakter. Es braucht meine Reaktion, damit etwas für mich zur Offenbarung wird. Der holländische Pfarrer Klaas Hendrikse illustriert dies am Beispiel einer Inschrift über einem Fischladen: «Unser Hering, eine Offenbarung!» (KH 153) Nur wenn ich zugreife und der Hering mir schmeckt, entscheidet sich, ob er auch für mich eine Offenbarung bedeutet.
Solche Offenbarungserfahrungen kann ich ebenso in der Musik oder Literatur, in der Kunst überhaupt oder in der Natur machen. Oder in zwischenmenschlichen Begegnungen. Und – gewiss – beim Lesen der Bibel. In diesem Sinn kann auch die Begegnung mit Jesus in den von ihm überlieferten Geschichten für mich zur Offenbarung werden. Wenn ich denn diese Erfahrung so nennen will.
Fazit





























