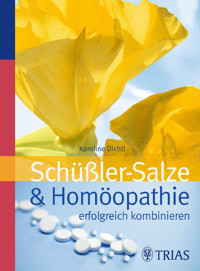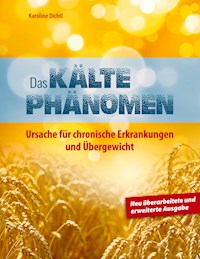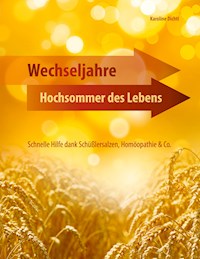
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Autorin bietet einen wertvollen Überblick, wie die Wechseljahre mit ihren zahlreichen Beschwerden durch naturheilkundliche Mittel leicht zu überwinden sind. Sie wirft einen Blick auf verschiedene Erklärungsmodelle, lässt die Schulmedizin nicht außer Acht und beleuchtet die Wechseljahre aus psychologischer Sicht. In gewohnter Manier verbindet Sie die Sichtweise der chinesischen Medizin, speziell der 5-Elemente-Lehre mit der Homöopathie und den Schüßlersalzen und gibt zu über 70 verschiedenen Beschwerden praktische Tipps, angefangen von Altersflecken über Herzbeschwerden und Hitzewallungen bis zu Schweißausbrüchen und Schlafstörungen. Die Brücke zwischen TCM, Homöopathie und Schüßlersalzen ist in dieser Form einzigartig. Sie ist für Anfängerinnen leicht verständlich und bietet der erfahrenen Anwenderin zahlreiche, neue Inspirationen. Eine Pflichtlektüre für die Frau ab 30 - denn früh übt sich, wer gut durchkommen will. Mehr als lesenswert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wechseljahre
– Aufbruch in eine neue Lebensphase
Was den Körper prägt
– die schulmedizinische Sicht
Wie die Seele reift
– eine psychologische Betrachtungsweise
Was Bewegung ins Leben bringt
– Weisheiten aus China
Das Wandlungsphasenmodell
– Rhythmus leben
Die Feuerphase
– Hochsommer im Körper
Die Seele entspannen
– was Homöopathie leisten kann
Arsenicum album
Aurum metallicum
Calcium carbonicum
Causticum
Graphites
Ignatia
Kalium carbonicum
Lac caninum
Lachesis
Lilium tigrinum
Natrium chloratum
Platinum
Pulsatilla
Sepia
Silicea
Staphisagria
Veratrum album
Den Mangel beseitigen
– Mineralstofftherapie nach Dr. Schüßler
Körperliche Beschwerden
– schnelle Hilfe für die Zeit des Aufbruchs
Altersflecken
Angst
Antriebslosigkeit
Atemnot
Beziehungsprobleme
Bindegewebsschwäche
Blasenentzündung
Blasenschwäche
Burnout
Cellulite
Couperose
depressive Verstimmungen
Endometriose
Erschöpfung
Falten
Fersensporn
Fibromyalgie
Geräuschempfindlichkeit
Geruchsempfindlichkeit
Gesundheitswahn
Gewichtsschwankungen
Haarausfall
Halux valgus
Herzbeschwerden
Heißhunger/Essattacken
Hitzewallungen
Humorlosigkeit
Hyperaktivität
Kinderlosigkeit
Klimakterium
Konzentrationsstörungen
Kontrollverlust
Krebserkrankungen
Kummer (Trauer)
Lactoseintoleranz
Lichtempfindlichkeit
Logorrhoe
Menstruationsbeschwerden
Migräne
Myom
Neidgefühle
Osteoporose
Panikattacken
Planlosigkeit
Perfektionismus
Pilzinfektion
Rheumatische Beschwerden
Reizblase
Reizmagen
Reizdarm
Ruhelosigkeit
Rosazea
Schilddrüsenfunktionsstörungen
Schlafstörungen
Schwerhörigkeit
Sexualität
Stimmungsschwankungen
Schluckbeschwerden
Schwitzen
Trägheit
Trauer
Trauma
Trockenheit
Übergewicht
Vergesslichkeit
Verstopfung
Venenschwäche
Verstimmung/Gereiztheit/Wut
Wassereinlagerungen
Zugempfindlichkeit
Zysten
Veränderungen gestalten
– den Hochsommer des Lebens genießen
Die passende Unterstützung suchen
– geteilte Stärke – doppelte Kraft
Erfolgreiche Umsetzung
– jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt
Literaturempfehlungen und die Autorin
Vorwort
Nicht die Dinge beunruhigen Frauen, sondern
ihre Gedanken und Urteile über die Dinge.
Frei nach Epiktet, „Handbüchlein der Moral“
Die Wechseljahre sind neben der Pubertät und den Schwangerschaften eine der herausforderndsten Phasen im Leben einer Frau. Bei manchen Frauen gelingt die Umstellung leicht und nahezu unbemerkt, doch bei manchen machen sich massive Beschwerden bemerkbar.
Die Naturheilkunde, allen voran die Schüßlersalze und die Homöopathie haben einiges zu bieten, um diese schwierige Phase leichter zu überwinden. Zudem ist es hilfreich, wenn man eine Erklärung für bestimmte Dysbalancen hat. Hier kommt die TCM, die Traditionelle Chinesische Medizin mit ihrem Erklärungsansatz von Yin und Yang zu Hilfe, die vor allem das unangenehme Schwitzen und Erschöpfung gut erklärt.
Dieses Buch soll einen Beitrag dazu leisten, dass Sie für sich selbst passende Mittel und Schüßlersalze auswählen können, so dass Sie die kleinen Klippen das Alltags gut umschiffen können. Für Frauen, die sich noch nie mit naturheilkundlichen Methoden beschäftigt haben, ist es eine Einführung und fortgeschrittene Kennerinnen erfahren mit der Fünf-Elemente-Lehre der TCM neue Aspekte und Betrachtungsweisen. Vor allem durch den Einsatz der Schüßlersalze kann vorbeugend gearbeitet werden, so dass es gar nicht erst zu Beschwerden kommt. Aber es können auch bereits bestehende Beschwerden gelindert werden. Idealerweise sollten Sie die Begleitung mit Naturheilkunde frühzeitig beginnen.
Einer der schwierigsten Faktoren in dieser Phase ist die Unberechenbarkeit der Symptome, was Auswirkungen auf den Alltag hat. Sei es die unregelmäßige Blutung, die eine unvorbereitet überrascht und zu Unannehmlichkeiten führt, aber auch die Hitze und das Schwitzen ist für viele Betroffene äußerst unangenehm. Stimmungsschwankungen krönen das Ganze und geben manchen Frauen das Gefühl, nicht mehr Herrin ihrer Selbst zu sein. Das ist vor allem dann schwer zu ertragen, wenn man sich und sein Leben geordnet und in einem schönen Rhythmus gelebt hat. Die „Unordnung“, die bisweilen durch Wechseljahrsymptome entsteht, lässt sich am besten durch die Fünf-Elemente-Lehre in einen neuen Zusammenhang bringen.
Daher empfehle ich Ihnen einen Stift zur Hand zu nehmen, rot, rosa oder grün – welche Farbe Ihnen auch immer gefällt – und ein Lineal oder etwas anderes, um „sauber“ unterstreichen zu können und dann: ran an den Speck. Machen Sie dieses Buch zu einem persönlichen Ratgeber für schwierige Zeiten. Knicken Sie die Seiten um, die besonders interessant für Sie sind, damit Sie sie schnell wiederfinden.
Schreiben Sie Bemerkungen an den Rand und überprüfen Sie deren Richtigkeit von Zeit zu Zeit. Legen Sie es an einen Ort, an dem Sie häufig vorbeikommen, beispielsweise in die Küche und bitten Sie andere Personen im Haus, die Finger davon zu lassen – es ist IHR Buch!
Sehr wahrscheinlich werden Sie es nicht in einem Stück durchlesen. So ist es auch nicht gedacht. Daher sind die Seiten für die „schnelle Hilfe“ bei unangenehmen Symptomen zwischen einer grünen und roten Seite eingebunden, damit Sie sie rasch finden können. Dort finden Sie alles, was Sie für die kleinen und großen Hürden des Alltags brauchen: von Altersflecken über Hitzewallungen und Schwitzen bis zu Zysten ist „alles“ drin.
Vielleicht gelingt es Ihnen, zu der Haltung zu kommen, dass es eine Freude ist, dass jeder Tag anders ist – das hatten Sie zuletzt als die Kinder klein waren oder als Sie selbst noch Kind waren, sofern Sie keine eigenen haben! Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Leseerlebnis und viele gute Gedanken zu dieser wunderbaren Zeit, die einzigartig in Ihrem Leben ist. Nutzen Sie sie für Ihre persönliche Entwicklung! Für die Leserinnen, welche die erste Auflage gekauft haben und sich über die veränderte Seitenzahl wundern: die zweite Auflage wurde bezüglich der Seitengestaltung etwas „luftiger“ gestaltet. Inhaltlich entspricht sie der Ersten und ist bis auf das Vorwort unverändert.
Ihre
Karoline Dichtl
Wechseljahre – Aufbruch in eine neue Lebensphase
Um die Wechseljahre zu betrachten gibt es sehr unterschiedliche Standpunkte. Das griechische Wort Klimakterium bedeutet „kritischer Zeitpunkt im Leben“. Daher ist es nicht ganz richtig, nur die Wechseljahre als Klimakterium zu bezeichnen, denn auch alle anderen Lebensphasen beinhalten eine „Klimax“ (Stufe, Treppe, Leiter).
Genau genommen besteht das ganze Leben aus Stufen, wie Hermann Hesse es in seinem Gedicht sehr schön zum Ausdruck bringt:
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Die Lebensstufen bestehen in unserer Art von Gesellschaft aus Geburt, Kleinkindphase, Kindergartenzeit, Schulbeginn und Schulzeit, Pubertät, Erwachsenendasein, Elternphase, Wechseljahre, Neubeginn, Alter, Tod. Die Betonung liegt auf „unserer Art von Gesellschaft“, denn es gibt Kulturen, die noch nicht einmal ein Wort für „Klimakterium“ haben, wie z.B. Japan oder China
Wenn Sie einem chinesischen Mediziner in den 80er Jahren erklären wollten, welche Beschwerden Sie durch Wechseljahre haben, war das nahezu unmöglich, da er von diesem „Krankheitsbild“ nie gehört hatte. Es wird vermutet, dass dies mit dem hohen Konsum an Sojaprodukten zusammenhängt, die in Asien sehr viel gegessen werden und die bei uns im Westen oft erst zum Einsatz kommen, wenn Beschwerden da sind.
Wechseljahre sind also präzise betrachtet nur 1 Phase von vielen, wobei unser modernes Leben diese Stufe besonders hoch werden lässt. Viele Wirtschaftsbereiche haben ein erhebliches Interesse daran, die Stufe zu einer Hürde zu machen, um die Umsätze zu steigern oder zumindest zu erhalten. Das ist verständlich, aber leider für uns Frauen wenig hilfreich.
Der Begriff Menopause (altgr.) bedeutet einfach das „Ende des Monats“. Wenn man Berichte darüber liest, könnte man meinen, dass es das Ende des Lebens ist. Vielleicht fühlen sich viele Frauen schon allein aufgrund der vielen Gerüchte über diese Phase so schlecht. Wenn ihnen dann noch „angedroht“ wird, dass diese „schreckliche Zeit“ 10 bis 15 Jahre dauern soll, dann beginnt man sich schon sehr früh davor zu fürchten und kann keinen Reiz darin entdecken. Deshalb ist es sinnvoll, den Blick zu heben, um neue Denkansätze kennen zu lernen:
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
entwickelt eine neue, ermutigende Sichtweise.1
Alle Lebensphasen sind im Ursprung geprägt von tiefer Unsicherheit: das Kleinkind, das die Welt neugierig erkundet, schaut immer wieder zur Mutter zurück. Wer erinnert sich nicht an die ersten Kindergarten- oder Schultage, die von Tränen und Heimweh begleitet waren, bis wir erkannt haben, was es für Vorzüge mit sich bringt, dort zu sein. Die Höhen und Tiefen der Pubertät sind für viele Frauen eine schmerzliche Erinnerung und sie sind froh, dass sie vorüber sind. Doch genau dort liegt der Ursprung dafür, wenn die Verunsicherung stetige Begleiterin der Wechseljahre ist.
Denn wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, haben viele von uns die Phase der Kindheit und Pubertät gar nicht abgeschlossen, sondern leben immer noch kindlich anmutende Verhaltensweisen als Erwachsene aus: das beleidigt sein in Beziehungen, der Futterneid, wenn es etwas zu holen gibt, der Kampf um Anerkennung am Arbeitsplatz, bei dem der Chef oder die Chefin mit der Mutter oder dem Vater verwechselt wird, das „Aufblähen“, um an Größe zu gewinnen und die Gier nach Leistungen und Erfolgen unserer Kinder. All das spricht nicht gerade für vernünftige, reife Erwachsene, die erfahren und weise auf das Leben schauen. Wenn wir tief in uns hinein sehen, können wir erkennen, wie viele Fäden uns noch mit alten Kindheitsmustern verbinden, die wir nie wirklich gelöst und aufgetrennt haben. Wir müssen uns eingestehen, dass es noch einen alten Schleier gibt, der die Entwicklung einer eigenen, realistischen Wahrnehmung unseres Selbst, der Selbst-Sicherheit verhindert. Deshalb rät uns Hesse:
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Abschied nehmen ist ein heikles Thema und immer mehr Menschen tun sich schwer damit. Es geht scheinbar leicht bei allem, was man auf elektronische Datenträger speichern kann, wie Bilder oder Erinnerungen. Schwieriger wird es mit Möbeln, Räumen, Erfahrungen. Alte Erfahrungen loszulassen und den Geist zu öffnen für Neues, wird mit zunehmendem Alter meist schwerer als leichter.
Nun fordern die Wechseljahre eine massive Neuorientierung, denn so vieles gerät aus der gewohnten Bahn. Das Klimakterium beendet eine Zeit, die von Rhythmus und Regelmäßigkeit geprägt war. Auch wenn die monatliche Regel unangenehm oder von Schmerzen begleitet war – jahrzehntelang hat sich eine Frau daran gewöhnt. Nun ist dieser Takt zu Ende. Ein Faktor, der Routine ins Leben gebracht hat, geht verloren, Unsicherheit und Verunsicherung tritt an ihre Stelle. Unregelmäßige Blutungen führen dazu, dass unverhofft eine Störung auftauchen könnte, vielleicht in einem völlig unerwarteten Moment. Starke, ununterbrochene Blutungen können so sehr einschränken, dass die Unabhängigkeit im Alltag verloren geht. Hitzewallungen und Schweißausbrüche überfallen eine, wie eine Diebin oder ein Räuber, mit dem man nicht gerechnet hat. Das Gewicht schwankt ebenso wie die Stimmung und lässt sich schwerlich an Ernährung und Umständen fest machen. Glückliche Umstände gehen mit depressiven Verstimmungen einher, an trüben Tagen passt die Stimmung zum Wetter. Der Einfluss auf den Körper geht verloren. So scheint es zunächst.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Die Schwierigkeit, den Zauber des Anfangs bei den Wechseljahren zu sehen, ist groß. Da die Verunsicherung nie aufgehört hat und die Antwort meist im Außen, beim Mann, bei anderen gesucht wurde, ist eine wichtige Frage bis heute nicht beantwortet: Wer bin ich und wer will ich sein? Wie will ich sein? Was ist für mich wichtig im Leben? All diese Fragen wurden meist zugunsten des Funktionierens im Alltag hinten angestellt. „Es ging ja nicht anders!“ höre ich oft in meiner Praxis.
Viele Frauen sind durch ihre Erziehung zu Entscheidungen gedrängt worden, die nicht wirklich zu ihrem Wesen passen. Sie haben keine Zeit für eine intensive Suche bekommen, wo ihr Lebensweg hingehen soll. Die fehlende Selbst-Sicherheit hat dazu geführt, dass die Meinungen der Eltern, von Erzieherinnen und Lehrerinnen fraglos übernommen wurden und wir glauben tragischer Weise heute noch daran. Doch tief im Verborgenen rumort etwas, das endlich ernst genommen werden möchte. Diese in uns schlummernden Anteile nutzen jede erdenkliche Chance, sich zu melden, solange sie kein gelebter Anteil von uns geworden ist.
Bevorzugt natürlich genau dann, wenn es nicht passt und vor allem, wenn wir uns gerade selbst wieder in Vorstellungen hineinpressen, wie wir sein sollten und was das Richtige ist. Meist orientieren wir uns an unseren Müttern. Selbst wenn wir sie völlig ablehnen und ihr Verhalten mehr als scheußlich fanden, so sind doch die Erfahrungen mit ihr zu unserem alltäglichen Maßstab geworden – vor allem, wenn wir das Gegenteil tun, weil wir erkannt haben, was unsere Kinder NICHT erleben sollen! Das „auf jeden Fall anders“ machen wird nun zum zwingenden Maßstab.
Von Freiheit, eigener Meinung, unserer persönlichen Sicht auf das Leben sind wir himmelweit entfernt. Nicht umsonst sind vor allem Frauen oft so unzufrieden mit ihrem Leben. Selbst wenn sie gerade das bekommen oder erreicht haben, was sie sich kurz zuvor noch sehnlichst wünschten: schon betrachten sie das nächste, was ihnen fehlt. Sie hangeln sich von Unzufriedenheit zu Unzufriedenheit und nerven damit nicht nur ihr Umfeld, sondern sind tief im Inneren vor allem von sich selbst genervt. Die eigentliche Frage wird aber nicht gestellt:
„Lebe ich das Leben, das mir entspricht?“2
Die Antwort auf diese Frage gibt uns einen Hinweis darauf, warum Frustration, Missmut und Gereiztheit den Lebensalltag von vielen Frauen bestimmt, besonders wenn sie in der sogenannten Lebensmitte angekommen sind. Ich ahne schon die Reaktion: „Ja, wie soll man das denn finden, wenn man…“ (sich um die Kinder, um den Haushalt, um andere, um…was auch immer kümmern muss).
Genau dieses MUSS ist das zentrale Thema, denn Frauen sind Meisterinnen darin, sich selbst ein hübsches Gefängnis aus Perfektion und Funktionstüchtigkeit zu zimmern, aus dem sie selbst kaum mehr aussteigen können, weil sie ihre Familie an ihre ewige Dienerschaft gewöhnt haben. Daraus entsteht das Phänomen der Hyperaktivität bei Frauen, die nur noch durch ihr Leben hetzen. Sie dient allein dem Ziel, tiefste Gefühle nicht mehr wahrnehmen zu müssen, die unser ganzes Leben beherrschen: das Gefühl, nicht willkommen zu sein, nicht angenommen zu sein oder sich ungeliebt zu fühlen. Das Gefühl abgrundtiefer Einsamkeit oder des Verlassen seins. Das Gefühl von Versagen und ausgelacht werden. Das Gefühl nicht gesehen zu werden mit all dem, was man in die Welt bringen kann.
Wer kann diese schmerzlichen Gefühle aus der Vergangenheit schon gut aushalten? Arbeit bis zur Erschöpfung, extrem hoch gesteckte Ziele oder blinder Aktionismus halten diesen Schmerz in Schach und betten ihn in ein System aus Kontrolle, Normen und scheinbaren Aufgaben ein, so dass keine Luft bleibt, auch einmal zur Ruhe zu kommen und sich zu erinnern.
Spätestens mit den Wechseljahren bricht das System zusammen, die Kinder gehen aus dem Haus, die lebendige Beziehung ist der Gleichgültigkeit zum Opfer gefallen, vieles nervt und zudem schleichen sich körperliche Veränderungen in den Alltag und werden begleitet von den leisen Ahnungen vergangener Tage. Die Verunsicherung wächst und Veränderung wäre auf vielen Ebenen nötig, aber es gibt mehrere Faktoren, die sie verhindern:
1. Der Mensch lebt gerne ökonomisch und solange es keinen Grund zu Veränderung gibt, findet keine statt!
Alles, was biologisch oder physiologisch abläuft ist den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit unterworfen. Veränderungen finden nur statt, wenn sie wirklich gewinnbringend oder lebensnotwendig sind. Dies bedeutet für unser Leben als Frauen: solange wir attraktiv und leistungsfähig sind und mit unserem jugendlichen Charme oder unserer Arbeitskraft andere Menschen für uns gewinnen können, gibt es keinen Anlass andere Qualitäten entwickeln zu müssen.
Solange unser in jungen Jahren angebahntes Leben funktioniert, gibt es keinen Grund, das Wettspiel „meine Kinder“ – „mein Mann“ – „mein Körper“ – „mein Job“ in Frage zu stellen. Solange die Energie dafür da ist, gibt es keine Veranlassung, die Anstrengungen für die Karriere oder berufliche Entwicklungen in Frage zu stellen oder zu relativieren. Das Gehirn läuft im (ökonomischen) Sparmodus der Gewohnheitsmuster, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Schon Veränderung zu denken, ist eine Herausforderung:
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
2. Der Mensch neigt zum Vergleich und übersieht dabei den Einsatz der anderen
Wir betrachten unser Tun meist nicht im luftleeren Raum, sondern bewerten das Ergebnis fast immer im Vergleich mit anderen. Es ist ein Muster, das wir in der Kindheit gelernt haben. Wer erinnert sich nicht an die Frage, was für Noten die anderen hatten oder wie der Notendurchschnitt war. Erst dieser Rapport führte zu der Bewertung, ob die „2“ – gemessen an der „Norm“ – gut oder schlecht war.
Selten wurde die Frage gestellt, was diese Note für mich, für meinen Schulweg, für mein Berufsleben bedeutet. So haben sich die meisten Frauen angewöhnt, sich, ihr Tun und auch ihre Kinder im Vergleich zu anderen zu betrachten. Bewertungen und Vergleiche sind zu unserer zweiten Natur geworden und bestimmen also, was „normal“ ist – und was „man“ erreichen muss.
Vergleich führt unweigerlich zu Unzufriedenheit, denn leider ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner als auf der eigenen. Dies hat damit zu tun, dass wir keinen Einblick in die Kalkulation der anderen bekommen. Somit können wir nicht wissen, welchen Preis sie für ihre Leistung oder ihr Ergebnis bezahlt hat. Da wir unser Preis-Leistungsverhältnis kennen, schneidet die andere Seite des Zauns immer besser ab, denn wir spüren nur unsere eigene Anstrengung. Deshalb glauben wir, dass andere es vermeintlich leichter haben und ihnen im Handumdrehen gelingt, was uns so schwer fällt.
Frauen kämpfen daher gern für Gleichheit: Chancengleichheit, Gleichberechtigung, gleiche Bildungsmöglichkeiten. Alles in der Hoffnung, dass das Vergleichen und die damit einhergehende Unzufriedenheit dann aufhört. Aber Ungleichheit wird nie enden, da z.B. Charme oder körperliche Attraktivität immer unterschiedlich verteilt sind und nie alle gleich „ausgestattet“ sind.
Dasselbe gilt für Erfolg: so mancher Zufall hat der einen oder der anderen zu einem großen Wurf verholfen, nur weil sie gerade zur rechten Zeit am rechten Ort war. Wahrscheinlich hat sie es noch geschafft, im rechten Moment zu strahlen, denn (fast) alle Menschen teilen das, was sie haben, lieber mit Menschen, die positiv wirken. Man sät ja auch einen Samen lieber in fruchtbaren Boden als in Wüstengelände.
Der Wunsch nach Gleichheit und Gerechtigkeit ist ein Kampf, der so lange dauern wird, solange es mehr als zwei Menschen gibt. Er ist sinnlos. Deshalb wäre es hilfreicher, einen eigenen Maßstab zu entwickeln. Doch dazu braucht es Vorbilder.
3. Medien arbeiten mit Zerrbildern und verhindern, dass wir eigene Vorbilder suchen
Wenn man ein Ziel erreichen will, sollte man sich dieses immer wieder als Vision vor dem inneren Auge betrachten. Medien führen unseren Blick jedoch weg von der Wirklichkeit. Wenn Barbie Ihre Vorstellung von körperlicher Attraktivität geprägt hat, dann werden Sie immer unzufrieden sein, da dieses Körperformat bei maximal 0,1% aller Frauen zu finden ist.
Wenn wir durch die Medien täglich Frauen mit makelloser Haut und perfekter Erscheinung vor Augen geführt bekommen, hat das eine Wirkung auf unser Unterbewusstsein und die Zufriedenheit mit uns selbst.
Unser Geist kann nicht erkennen, dass (fast) alle Bilder in Zeitschriften, Filmen oder im Internet per Bildbearbeitung verändert wurden, um diese Illusion der Makellosigkeit zu erzeugen. Wir vergleichen uns mit dem „Vorbild“ und werden unzufrieden oder wir gehen in eine Abwehrhaltung und erklären uns zumindest innerlich immer wieder, warum wir das Ziel nicht erreichen. Die Folge ist ein andauerndes Versagensgefühl.
1 Das Originalgedicht lautet hier: „mag lähmender Gewöhnung sich entraffen“!
2 Ulrike Janz (Hrsg.) „Wandlungen“, Krug&Schadenberg 2005, Seite 155
Was den Körper prägt – die schulmedizinische Sicht
Der weibliche Zyklus wird von Hormonen bestimmt – genauso wie unser Schlafrhythmus, der Stoffwechsel, Stressreaktionen und alle andere Abläufe in unserem Körper. Der weibliche Hormonhaushalt ist also wiederum nur 1 von vielen. Alle hormonellen Abläufe sind Schwankungen unterworfen, denn es macht keinen Sinn, dass z.B. Ihr Melatonin-Spiegel immer gleich hoch ist, wenn er nur dem Schlafen dient. Kein Hormon befindet sich dauerhaft in derselben Konzentration im Blut! So ist es auch bei den Hormonen, die den weiblichen Organismus prägen.
Mit dem Einsetzen der Blutung in der Pubertät und bis zu deren Versiegen in den Wechseljahren entsteht ein monatlicher Rhythmus, innerhalb dessen die Hormone absinken und ansteigen. Dazu gehören zum Beispiel die Östrogene, die ein Zeichen für Fruchtbarkeit sind, denn es wird von den heranreifenden Eizellen gebildet. Durch Östrogene wird die Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut und verdickt, so dass sich die Eizelle einnisten kann. Diese Östrogenwirkung zeigt sich im ganzen Körper durch Wassereinlagerungen und Fettansammlung, die natürlich auch zur Straffheit und Drallheit des Körpers beiträgt. Aus diesem Grund sind junge Frauen eben faltenlos und wirken auf Männer jeglichen Alters anziehend, denn sie tragen die Zeichen der Fruchtbarkeit – das hat die Natur schon sehr klug eingerichtet.
Das Ansteigen des Östrogenspiegels führt besonders nach dem Eisprung zu einer Zunahme an Körpergewicht, der so weit gehen kann, dass manche Frauen sich kurz vor ihrer Menstruation wie eine Qualle fühlen: der Körper ist angereichert mit Substanz, in der chinesischen Medizin „Yin“ genannt. Wenn sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutter eingenistet hat, wird Progesteron gebildet, das diese Schleimhautverdickung erhält, so dass sich die Eizelle fest verankern und darin wachsen kann. Also auch die sogenannten Gestagene tragen zu einem Substanzwachstum bei.
Dieser Prozess verläuft über einen Zyklus von plusminus 28 Tagen, also grob gesagt einmal im Monat. Mit den entsprechenden Hormonveränderungen gehen körperliche und seelische Veränderungen einher, vor allem Stimmungsschwankungen sind ein Thema. Auch dies ist ein kluger Mechanismus, denn es ist doch sinnvoll, dass eine Frau zu der Zeit ihres Eisprungs Nähe bedürftig und auf „Kuscheln“ eingestellt ist. Wie sollte auch sonst ein Kind entstehen? Andererseits ist es auch wieder natürlich, dass die Frau kurz vor der Abstoßungsreaktion einer Eizelle, die nicht befruchtet wurde, mehr für sich sein möchte. In den meisten Kulturen zieht man sich für Ausscheidungsvorgänge zurück, warum sollte es bei der Menstruation anders sein als bei der Blasenentleerung oder der Verdauung?
Was an unserer Kultur unnatürlich ist, ist die Sichtweise, dass diese Schwankungen als Störung angesehen werden und wenig Berücksichtigung im Leben finden. Dabei ist genau diese seelisch-körperliche Fähigkeit zum Wandel eine große Stärke von uns Frauen! Während betrieblicher Veränderungsprozesse besteht das Team meistens aus einem hohen Frauenanteil, weil der Umgang mit Wandlungsphasen Frauen leichter fällt. Sie sind in solchen Situationen eher fähig, alle zusammen zu halten und unterschiedliche Fähigkeiten zu integrieren. Sie können das Auf- und Ab eines neuen Projektes oft besser aushalten, als viele und v.a. junge Männer, die ausschließlich Anstieg und Zuwachs erreichen wollen, die nur erobern wollen, ohne Rückversicherung oder Reflexionsphasen.
Eine fruchtbare Frau geht also mit ihrem Zyklus durch verschiedene hormonelle Stadien, die bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Eine Frau in den Wechseljahren verwandelt sich durch die Abnahme aller weiblichen Hormone zu einem Wesen höherer emotionaler Stabilität und Beständigkeit. Allerdings kann die Wandlungsphase äußerst turbulent sein. Meine Beobachtung ist, dass sie umso turbulenter wird, je weniger die Frau in Kontakt mit sich und ihrem Körper ist. Frauen, die ihrem Rhythmus mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben, haben automatisch viel Erfahrung in der Hingabe an Abläufe, die sie nicht kontrollieren können. Der Wechsel aus Rückzug und Tatkraft wird angenommen. Während der Wechseljahre treten diese Veränderungen nur in kürzeren, teilweise sehr kurzen Abständen auf, aber das Prinzip der Unkontrollierbarkeit bleibt dasselbe. Frauen, die ein großes Bedürfnis nach Kontrolle und Gewohnheit haben, tun sich sehr viel schwerer mit dieser Phase und sie sind verführbar für jegliche Form der Einflussnahme.
Eine Hormon(ersatz)therapie wird häufig bei den ersten Anzeichen der Wechseljahre empfohlen, weil sie vor Krankheiten schützen soll. Sie wird verschrieben, um Stimmungsschwankungen und Depression wieder in den „Griff“ zu bekommen. Verschwiegen wird, dass die Symptome oft bleiben und Nebenwirkungen dazu kommen. Sie wird als einziger Ausweg bei Problemen mit Trockenheit betrachtet, dabei könnten die Schüßlersalze es nebenwirkungsfrei lösen!
Oft werden die Hormone auch deshalb präventiv empfohlen, um Herzerkrankungen oder Schlaganfällen vorzubeugen. In Studien wurde beobachtet, dass eine späte Östrogenbehandlung die Gefahr eines Schlaganfalles erhöht, da gerade durch sie arteriosklerotische Plaques in den Blutgefäßen gelöst werden. Aus diesem Grund sollen Frauen bereits vor den ersten Anzeichen des Klimakteriums Östrogene zuführen. Ein direkter Umstieg von der „Pille“ auf die „HET“ (Hormonersatztherapie) wäre für manche Schulmedizinerin ideal, um immer auf der sicheren Seite zu sein. Hier findet Kontrollbedürfnis zu Kontrollbedürfnis und viele Frauen lassen sich in ihrer großen Verunsicherung gern darauf ein!
Mit dem Begriff der Osteoporose und deren Verhinderung durch die „HET“ wird mit einem Schreckgespenst gearbeitet, dessen wirkliche Ursachen noch gar nicht bekannt sind. Es wird eine Angst aufgebaut, gegen die sich die meisten Frauen nur schwer erwehren können. Wer möchte schon zerbrechliche Knochen haben? Eine ängstliche Patientin wird den Aussagen der Therapeutin vertrauen und stellt die eigene Meinung hinter der angenommenen Kompetenz zurück. Dabei werden nebenwirkungsfreie Alternativen, wie z.B. die Schüßlersalze oder auch homöopathische Unterstützung, meist verschwiegen. Unkenntnis ist dabei nur einer von vielen Gründen, denn die Ärztinnen wissen, dass eine solche Beratung zeitaufwändiger wäre, doch diese Zeit wird nicht bezahlt.
Aus den im ersten Kapitel beschriebenen Faktoren entwickelt sich bei vielen Frauen ein starker Wunsch, immer und ewig jung und leistungsfähig zu bleiben, vor allem wenn sie sich mit anderen Frauen vergleichen. Außerdem haben die meisten Frauen ein extrem hohes Bedürfnis nach Autonomie und Selbständigkeit, die natürlich leichter zu erhalten ist, wenn der Körper gesund und stark ist. Die Illusion, dass Hormoneinnahmen dazu beitragen, ist weit verbreitet.
In der Presse liest man allenthalben von den „silver agers“, deren Leben wie gewohnt läuft, die immer fit sind und aktiv sein können, wann immer sie wollen. Maximal „best ager“ darf man sein, denn Schwächen, Einbrüche oder Unvermögen ist genauso eine Makel wie Inkontinenz. Hier findet eine unglaubliche Normierung statt. Es gibt geradezu einen Zwang, frisch und jugendlich zu bleiben, straffe Haut zu haben, volles Haar und dralle Brüste. Wer das nicht vorweisen kann, macht etwas falsch im Markt der Möglichkeiten. Nicht selten führt das Risiko oder das Auftreten eines Brusttumors zum schlagartigen Absetzen der Hormon(ersatz)therapie. Diese jähe Veränderung entspricht überhaupt nicht den Bedürfnissen des weiblichen Körpers nach Rhythmus und ruhigen Verläufen. Frauen, die bisher viel Vertrauen in ihre Behandlerin hatten, werden plötzlich mit ihren klimakterischen Beschwerden im Regen stehen gelassen. Kaum eine klärt darüber auf, dass die Hormoneinnahme nur eine Verschiebung der Problematik bringt und nicht wirklich eine Lösung ist. Da viele aber schon in der „Behandlung“ von Menstruationsbeschwerden gute Erfahrungen mit Hormoneinnahmen gemacht haben, ist die Neigung, dies auch im Klimakterium zu versuchen, natürlich sehr hoch. Die Enttäuschung, wenn dieses einfache Rezept im Chaos mündet, ist unausweichlich.
Um das Brustkrebsrisiko zu senken, hat die Schulmedizin natürlich auch schon wieder eine Lösung gefunden: Östrogene werden nun mit Gestagenen kombiniert. Dies reduziert das Risiko enorm, das wurde in Studien nachgewiesen. Gestagene in geringer Dosis halten Frauen in einer Art „Dauerschwangerschaft“. Es lebe die freie Gestaltung des Lebens mittels beständiger Künstlichkeit! Was Freiheit wirklich ist, wissen jedoch die wenigsten.
Es ist sicher ein Problem, dass die meisten Frauen ihre Menstruation und das Frauwerden als beschwerlich erlebt haben. Nicht umsonst sind viele zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr bereit, durch Pilleneinnahme die Dinge ins Lot zu bringen. Außerdem gewährleistet die Pilleneinnahme auch Funktionstüchtigkeit im Sexualleben: Mann kann immer – frau auch. Aber will sie das?
Dabei sind diese Beschwerden oft nur erste Zeichen für eine Mangelsituation gemäß der Mineralstofftherapie nach Dr. Schüßler. Sie könnten auch der Ausdruck eines emotionalen Knotens sein, dann wäre die Homöopathie hilfreich. Eine kühlende Ernährung gemäß der chinesischen Medizin führt ab der Pubertät zu Schwierigkeiten, weil die (kühlenden) Östrogene das Leben des Mädchens nun prägen. Kinder sind generell „yang“ und vertragen aufgrund ihres hitzigen Wesens eine kühlende Ernährung mit Rohkost und viel rohem Obst sehr gut, aber in der Pubertät kann sie dann ein Auslöser für Krämpfe werden3. Eine Umstellung auf wärmende Kost würde das Problem nebenwirkungsfrei und ohne Manipulation des Hormonhaushaltes auch lösen.
In der Phase des Klimakteriums findet dann genau genommen nur eine Wiederholung statt: die Hormoneinnahme bietet eine vermeintlich unkomplizierte Lösung. Es ist ähnlich wie mit der Laktosefreien Milch: statt weniger wird noch mehr Hormon (oder bei der Milch das Enzym) zugeführt und der Körper immer stärker künstlich beeinflusst. Die Schulmedizin hat keine Zeit für die einzelnen Symptome, die mit einem aus dem Lot geratenen Hormonhaushalt einhergehen. Sie setzt auf einseitige Hormongaben statt einer ganzheitlichen Sichtweise. Die Erfahrung mit dem weiblichen Rhythmus, Möglichkeiten auf sich selbst Einfluss zu nehmen und persönliche Entwicklungsschritte bleiben dabei auf der Strecke.
Der Wunsch vieler Frauen im Klimakterium, wieder „die Alte“ zu sein, macht sie anfällig für das leicht verfügbare Angebot verschiedenster Hormonpräparate, die „nur eine ganz kleine Dosis“ sind oder als „nur ein lokal einzusetzendes Mittel“ (Gel) scheinbar kaum zu Buche schlagen. Die Pille(n) sind „zufälligerweise“ winzig klein, um den Eindruck zu vermitteln, es handele sich nicht wirklich um ein Medikament.
Hinter all der Verführbarkeit von Hormonen und der Weigerung zu altern, steckt letztendlich die Verweigerung von (Ver-)Wandlung und dem Ruf des Lebens. Die Betroffenen nehmen die schnelle und vermeintlich alternativlose Pilleneinnahme gerne aus ökonomischen Gründen an, denn den Blick nach innen zu wenden ist auch anstrengend. So scheinen zwar alle Beteiligten von der schnellen Lösung zu profitieren, doch der Kontakt zum Selbst, zum Rhythmus einer Frau, zu den verborgenen, inneren Anteilen wird dabei unterdrückt.
Nicht wenige Businessfrauen, die viel auf Reisen sind, nehmen in der Zwischenzeit Präparate, durch die sie gar keine Menstruation mehr haben. Manchmal frage ich mich wirklich, ob es einen Preis für maximale Entfernung von weiblicher Natürlichkeit gibt.
Dabei können wir schon bei kleinen Kindern beobachten, dass Erkrankungen Wendepunkte der Entwicklung sind. Viele machen nach den typischen Kinderkrankheiten einen reiferen Eindruck, haben sich so verändert, dass sie „vernünftiger“ sind, also der Vernunft zugänglich. Das ist wichtig für die weitere Laufbahn. Sie lernen durch diese Erfahrung den Umgang mit Krankheit und Schwäche, mit Schmerzen und Unwohlsein, mit einer hilflosen oder genervten Mutter, was ein Bestandteil des Lebens ist. Leider nehmen wir auch unseren Kindern durch überzogene Impfungen immer mehr die Chance auf den Umgang mit der Schattenseite des Lebens. Dies setzt sich bei den Mädchen in der Pubertät fort und es ist nur eine Wiederholung eines immer wiederkehrenden Denkens, das auf Funktionstüchtigkeit des Körpers ausgerichtet ist und den Menschen zur Maschine macht.
Zum Glück gibt es immer mehr Frauen, die gerade in der Phase des Klimakteriums damit nicht mehr zufrieden sind. Sie spüren, dass ihnen etwas Grundsätzliches im Leben vorenthalten wurde und sind bereit, sich auf die Suche zu machen. Der erste Schritt dazu ist der Abschied vom Glauben an die Vertrauenswürdigkeit der Schulmedizin, den sie leider längst verloren hat. Und auch Hesse weiß darum:
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Diesen Zauber bietet auch die Naturheilkunde, wenn Frauen merken, wie schnell und einfach sie helfen kann. Dabei bringt die erste Auseinandersetzung eine gewisse Verwirrung mit sich. Nicht jede Behandlungsweise ist für jede Frau geeignet. Deshalb ist zu Beginn eine gewisse Geduld nötig, bis die richtigen Mittel oder die richtige Methode gefunden sind:
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen.
Durch die breit gefächerte Naturheilkunde kann jede Frau eigene Erfahrungen sammeln, um im Laufe ihres Lebens zu wissen, was für sie zu welchem Zeitpunkt passt. Die Bereitschaft, zu beobachten und zu erkennen, wann welche Strategie die Richtige ist, ist dann Wegweisend im wahrsten Sinn des Wortes. Durch die Beschäftigung mit Naturheilkunde erfahren Frauen sehr viel über ihren eigenen Lebensrhythmus.
Sie können Rücksicht darauf nehmen, ihn aber ebenso nutzen! Legen Sie doch öfter einmal wichtige Geschäftsabschlüsse auf die Zeit ihres Eisprungs und lassen Sie sich überraschen! Das sind die wirklichen Waffen einer Frau.
Diese Fähigkeiten betreffen auch seelische Schwankungen, bei denen die Schulmedizin gern zu Psychopharmaka greift. Frauen werden weit häufiger Antidepressiva verordnet als Männern und nur selten wird darauf hingewiesen, dass diese Medikamente dann u.U. lebenslang genommen werden sollten, da das Absetzen zu erneuten depressiven Verstimmungen führt. Eine Abhängigkeit entsteht, die den Umgang mit der Patientin erleichtert und zudem viel Geld bringt.
Spätestens durch diese Unterdrückung der Seelenanteile wird die Chance für Veränderungen und die Offenheit für Neues erschwert. Die Entwicklung der Weisheit des Alters wird blockiert, denn nur die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensthemen macht wirklich reich und es ist ein Gewinn, den Ihnen niemand nehmen kann. Weder ein Mann, der Ihnen das Geld entzieht, noch Kinder, die die einfach zu manipulierende Mutter wiederhaben wollen und zu Erpressung bereit sind.
Das entscheidende Element in dieser Zeit sind Vorbilder! Daher ist es unerlässlich, sich Gleichgesinnte zu suchen, die sich auf den Weg nach innen machen. Wenn Sie in den Wechseljahren umgeben sind von Frauen, bei denen es völlig normal ist, Hormone einzunehmen und sich medikamentös zum „happy ager“ zu machen, dann werden Sie zu der Einstellung kommen, dass Sie sich das Leben schwer machen, wenn Sie in die Tiefen Ihres Wesens hinabsteigen. Die Kehrseite des künstlich manipulierten Lebens ist dann, dass Sie scheinbar „plötzlich“ mit Verfall, (körperlichem) Unvermögen, Funktionsverlust oder dem Alter konfrontiert werden.
Wenn Frauen sich in der Wandelphase weigern, das Älterwerden anzunehmen, verschiebt sich die Aufgabe in eine Lebensphase in der weniger Kraft und Spielraum für Entwicklung zur Verfügung steht. Im Alter ist der Wandel ein anderer als in der Lebensmitte und gilt statt der Verwandlung dem Abschiednehmen. Wenn die persönliche Entwicklung nicht stattgefunden hat, fehlt die Kraft für einen runden Abschluss des Lebens.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Je stärker Sie die verschiedenen Anteile Ihres Selbst geborgen, entwickelt und gelebt haben, desto leichter wird es Ihnen gelingen, Abschied zu nehmen. Ein Mensch, der seinen inneren Monstern begegnet ist, wird sich weder vor dem Tod noch vor dem Sterben fürchten müssen. Eine entspannte Seele ist fähig, gehen zu lassen und zu gehen.
3 dazu: „Ursache für chronische Erkrankungen und Übergewicht“, Karoline Dichtl, BoD 2020
Wie die Seele reift – eine psychologische Betrachtungsweise
Die Diskussion, wo unsere Seele verankert ist, ist eine philosophische Debatte, weil es keinen Beweis dafür gibt. Sicher ist: sie ist ebenso da, wie unsere Körper! Sie alle kennen jemand, die „eine Seele von Mensch“ ist und auch jemand, bei der man sich fragt, ob sie ein seelenloses Monster ist.
Freud hat die drei Ebenen „Ich“ – „Über-Ich“ und „Es“ beschrieben. Mit dem Begriff „Es“ bezeichnete er das Unbewusste, die Seele. Er hatte die Vermutung, dass sich dort manches ungewollt abspeichert und dann „unbewusst“ Auswirkungen auf den Alltag hat. Der sogenannte „Freud’sche Versprecher“ ist ein Sinnbild dafür und bedeutet, dass sich etwas zeigt, was die Person lieber unterdrücken würde.
Das „Über-Ich“ ist unser Gewissen, eine geistige Instanz, die sich aus dem heraus entwickelt, was uns unsere Eltern vorgelebt und beigebracht haben. Das „Ich“ ist bei Freud das Ideal eines reifen, erwachsenen Menschen, der altersentsprechend mit dem Leben umgehen kann. Die Anforderung an eine reife Frau in den Wechseljahren ist in erster Linie das „Abschied nehmen“. Die Trauer, die dabei auftaucht, ist ein wichtiges Gefühl auf dem Weg zu einem neuen „Ich“. Ein Mensch entwickelt sich nur über das Erleben ihrer Gefühle, nicht indem sie sie hinter einer Fassade versteckt. Aus diesem Blickwinkel kommt den Entwicklungsschritten nach Eric Erikson eine große Bedeutung zu.
Erikson beschreibt Phasen, die unsere Seele im Laufe des Erwachsenwerdens erlebt und die mit Konflikten einhergehen. Sie entstehen im Spannungsfeld gegensätzlicher Extreme und jeder Mensch muss einen persönlichen Umgang damit finden. Die erfolgreiche Bewältigung führt dazu, dass wir im Laufe unseres Lebens immer bessere Problemlösestrategien entwickeln, durch die wir persönlich wachsen.
Wenn eine Phase nicht mit einem Lernerfolg abgeschlossen wird, bleibt sie so lange aktiv, bis der Mensch einen Umgang damit findet. Denn bedauerlicherweise geraten im Gehirn alle erledigten Arbeiten biochemisch schnell in Vergessenheit, während offene Aufgaben abgespeichert bleiben. Daher bekommen ungelöste Konflikte vor allem während der Wechseljahre eine enorme Bedeutung, wenn körperliche Umwandlungsprozesse einen seelischen Fehlentwurf verstärken, was wir vor allem bei den homöopathischen Mittelbeschreibungen noch sehen werden. Erikson hat 1959 folgende Stationen beschrieben:
Vertrauen vs. Misstrauen – das 1. Lebensjahr
Die erste Phase erlebt das Kind in völliger Abhängigkeit. Hier fällt die Entscheidung, ob es (Ur-)Vertrauen oder Misstrauen in sich speichert: was erlebt das Kind bei seiner Bezugsperson? Gibt sie ihrem Kind Sicherheit und Geborgenheit? Bekommt es ausreichend Nahrung und Zeit, diese zu sich zu nehmen? Kommt jemand, wenn es um Hilfe ruft? Strahlt der wichtigste Mensch Ruhe und Kraft aus oder deuten ihre Reaktionen auf Stress hin? All das wirkt auf das kleine Kind und beeinflusst die Haltung zur Welt. Es lernt in dieser ersten Phase etwas über Stabilität und entwickelt im Idealfall das Gefühl, sich auf das Leben verlassen zu können. Erikson nennt es: „Ich bin, was man mir gibt“ . Wenn in dieser Phase mehr Misstrauen als Vertrauen entsteht, äußert sich das häufig in sogenannten „oralen Zwängen“, also süchtigem Essverhalten mit großer Gier und einem nie endenden Leeregefühl. Die Erfahrung des Mangels wird abgespeichert.
Autonomie vs. Scham und Zweifel – das 2. bis 3. Lebensjahr
Das Kind bekommt durch seine wachsenden körperlichen Fähigkeiten einen größeren Spielraum, der seinen Entdeckergeist weckt. Es stellt fest, dass es außer der nährenden Person noch etwas anderes gibt, das es erobern will. Die Neugier, die Welt zu entdecken, entwickelt sich und das Kind bekommt dadurch neue Reize, die es weiter stimulieren und anregen.
Die Erweiterung der Welt ist abhängig davon, wie viel Vertrauen das Kind gelernt hat. Ein Kind mit einem tiefen Vertrauen wagt mehr, als ein Kind mit Misstrauen. Dabei bleibt es eng an die Bezugsperson gebunden: „ich gehe weg – aber die Mutter/Bezugsperson ist immer (noch) da!“ Kinder in diesem Alter schauen deshalb oft zur Mutter zurück oder huschen bei ihr vorbei und wollen Kontakt, um dann gleich wieder zu verschwinden. Manchmal stellt sich bei der Mutter dadurch ein negatives Gefühl ein. Wenn sie selbst wenig Liebe erfahren hat, breiten sich an dieser Stelle negative Gefühle des „benutztwerden“ aus. Es ist wichtig, dass die Mutter ihre immense Bedeutung als „ruhenden Pol“ erkennt, damit das Kind überhaupt den Mut entwickelt, seinen Radius zu erweitern. Wenn sie weiß, dass es eine Chance für sie ist, in Ruhe ein Buch zu lesen oder ein Gespräch zu führen, ist allen Beteiligten damit gedient.
Der Hauptkonflikt in dieser Phase entsteht zwischen dem, was das Kind interessiert und dem, was erlaubt ist. Erikson nennt das Ergebnis im Idealfall „ich bin, was ich will“. Kinder in diesem Alter können sich in einen toten Vogel genauso wie in Hundekot versenken. Sie kennen noch keine Grenzen und kein Bewertungssystem über „falsch“ oder „richtig“. Anhand der Reaktionen der Mutter oder des Vaters lernt das Kind, was akzeptiert wird und was nicht.
Ein Lächeln oder eine freundliche Stimme vermittelt ihm, dass es etwas gut oder richtig gemacht hat. An einem harten Ton und grobem Kontakt erkennt es, was es besser lassen sollte. Für die meisten Erwachsenen ist es z.B. nicht in Ordnung, in toten Vögeln herumzustochern.
Im ersten Moment der unangenehmen Reaktion entsteht im Kind ein Zweifel gefolgt von einer kritischen Haltung gegenüber dem Erwachsenen. Es überprüft in ihrem Inneren, ob Neugier über die negative Beurteilung siegen soll. Dadurch entsteht gleichzeitig das Gefühl der „Selbstwirksamkeit“, weil das Kind lernt, mit welchen Aktionen es welche Re-Aktionen in seiner Umwelt und vor allem bei den Eltern auslösen kann.
Wenn es zu oft starke Einschränkungen oder Zurechtweisung erfährt, entsteht das Gefühl von Ohnmacht und Scham: „so darf ich nicht sein“ – „das darf man nicht tun!“. Je krasser die negative Reaktion auf die kindliche Neugier ist, desto stärker das Schamgefühl. Wenn das Kind sehr oft Beschämung erfährt, dann entwickeln sich tiefe Zweifel, die die Neugier auf die Welt und das Leben unterdrücken. Manche erwachsene Frau weiß ein Lied davon zu singen.
Initiative vs. Schuldgefühle – die Phase vom 4 bis zum 6. Lebensjahr
Wenn der erweiterte Radius als sicher erfahren wurde und neue Reize die geistigen und körperlichen Fähigkeiten gestärkt haben, erlebt das Mädchen im sozialen Kontakt mit anderen Macht und Ohnmacht. Sie lernt, was im sozialen Gefüge richtig oder falsch ist, was man mit anderen machen kann und was man besser lassen sollte.
In diesem Alter erlebt sie die Eltern zum ersten Mal bewusst als zwei getrennte Personen, die sich unterschiedlich verhalten. Deren Beziehungsverhalten nimmt es zum Vorbild für eigene Verhaltensweisen, wie z.B. fragen, wenn es etwas haben möchte, schreien, wenn man den eigenen Willen nicht durchsetzen kann, Unruhe als Folge von Anspannung oder auch schlagen, wenn die Anspannung unerträglich wird.
In dieser Phase probiert das Kind das ganze soziale Spektrum von Aggression und Eroberung genauso aus, wie es Aggression und Vereinnahmung erlebt. Es ist gut, wenn das Kind anhand der Reaktion des anderen Kindes fühlt, was gut ankommt und was nicht. Wenn Eltern den Erfahrungsspielraum stark einschränken, indem sie vorschnell Einfluss nehmen, verhindern sie die Entwicklung von Selbstbegrenzung beim einen und die Erfahrung von Initiative beim anderen Kind.
Ungelöste Konflikte aus der Kindheit sind häufig das Motiv, dem eigenen Kind leidvolle Erfahrungen ersparen zu wollen, nicht selten mit dem Effekt, dass genau diese sich wiederholen. Wenn ihr das eigene Erleben abgenommen wird und die Erwachsenen steuern, dann wird es kaum ein natürliches und angemessenes Sozialverhalten entwickeln können. Der Umgang mit Initiative und Aggression im Sinne von Tatkraft und Wagnis wird erschwert, weil die Erfahrung aus der Kindheit fehlt. Das Ergebnis dieser Phase sollte sein: „Ich bin, was ich mir vorstellen kann (zu werden)“. Die Ängste der Bezugsperson führen stattdessen zu Schuldgefühlen. Das „so darf man nicht sein“ hemmt im weiteren Verlauf vor allem die Mädchen und plagt später die erwachsene Frau.
Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl – die Phase des Schulbeginns bis zur Pubertät
Mit den weiter wachsenden Fertigkeiten wollen Heranwachsende immer weniger nur zuschauen, sondern selbst anpacken. So entwickeln sie in der Schule neben handwerklichem Können auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen. Sie erleben im Idealfall, dass sie andere motivieren oder sich „herausnehmen“ können. Das Kind entwickelt die Fähigkeit zur Vorausschau („Antizipation“), kann sein Tun im Kopf durchspielen und dabei frei experimentieren. Bei der Umsetzung in die Tat bemerkt es dann, was funktioniert und was nicht. Das Credo lautet: „Ich bin, was ich lerne“.
Versagensgefühle werden verarbeitet, indem es sich der Aufgabe erneut zuwendet. Das Kind lernt durchzuhalten, bis es erfolgreich war oder aufzugeben, was zum Gefühl der Minderwertigkeit führt: „ich habe es nicht geschafft“. Eltern und Lehrerinnen sollten in dieser Phase nicht so sehr mit Lob und Tadel arbeiten, weil sie sonst die Orientierung in die Außenwelt lenken und weitere Initiative (Handlungsimpulse) verhindern. Im schlimmsten Fall wird das Kind so passiv, dass es nur noch etwas tut, wenn die Aussicht auf Belohnung besteht.
Besser wäre es, den Kindern mehr Ruhe zu geben und Langeweile entstehen zu lassen, in der sie sich immer wieder der noch offenen Aufgabe zuwenden können. Leider haben Mütter oft sehr eigene Vorstellungen, wie ihr erfolgreiches Kind die Aufgabe lösen sollte. Aufgrund fehlender eigener Ziele und einem inneren Leeregefühl besteht die Gefahr, dass die Mutter mit ihrem Kind verschmelzen will: „wir sind eins“. In den folgenden Jahren fragt sie sich dann, warum das Kind nicht selbständig wird, aber sie hat es jeglicher Initiative beraubt und durch das Gefühl der Minderwertigkeit von sich abhängig gemacht.
Selbstfindung vs. Verweigerung – das Jugendalter
Auf dem Weg zum Selbst erfährt die Heranwachsende unterschiedliche Reaktionen auf ihre Rollen, ihr Verhalten und ihre Art, mit anderen umzugehen. Sie entwickelt aufgrund ihrer vielseitigen Fähigkeiten eine eigene Identität (Prägung) als Vorstufe einer reifen Erwachsenen.