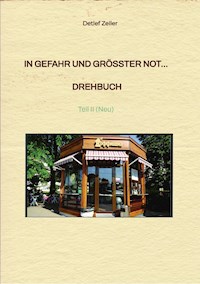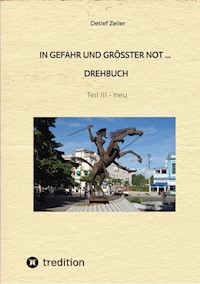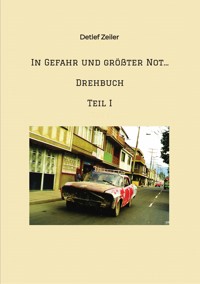3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Weg von hier!" beschreibe ich einen Lebensabschnitt, der von der Jugendbewegung zu Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts geprägt ist. Als Flüchtlingskind in einem katholischen Dorf aufgewachsen, erweitert sich mein Horizont bereits in den 60er Jahren durch den Einfluss von jungen Lehrern am Gymnasium, die sich im Denken und im Habitus deutlich von der Kriegsgeneration unterscheiden. Bereits in der Schule für politische Fragen sensibilisiert, erlebe ich dann an der Universität den Zerfall der von den 68ern bestimmten politischen Bewegung, die sich in haarspalterischer Weise mit der Frage beschäftigte, wer wie die "Arbeiterklasse" anführen darf. Während die 68er Generation dann endlich dabei ist, die Rollenangebo-te der Gesellschaft Schritt für Schritt zu übernehmen, bleiben einige Jugendliche, die deren Integration als Scheitern einer Utopie wahrnehmen, desillusioniert zurück. Eine Jugend, die sich in Musik, Kleidung und Habitus von den Zwängen eines "Systems" absetzen wollte, wird über Familie, Beruf, Arbeit und Konsum Schritt für Schritt wieder eingefangen. "Weg von hier!" zeigt den Versuch, über eine längere Reise den Schritt zurück in die Gesellschaft hinauszuzögern und dabei die Tragfähigkeit der Ideen von Freiheit und Unabhängigkeit zu überprüfen, wie sie in den 70er Jahren verbreitet wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Weg von hier!
Vom langsamen Ende einer Jugendbewegung
Teil I
Im Juli 2020
Detlef Zeiler
Gegenwartsforscher
© 2020 Detlef Zeiler
Weg von hier!
Teil I
ISBN: 978-3-347-11010-6 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-11011-3 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-11012-0 (e-Book)
1. Auflage 2020
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenstraße 40-44, 22359 Hamburg
www.tredition.de
Bildrechte: Bildarchiv (privat) Detlef Zeiler
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für elektronische und sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte biografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Weg von hier! – Teil I
Wie lange reicht eine Erinnerung zurück in die Kindheit? Meine ersten Eindrücke bringen mich in einen evangelischen Kindergarten in Angermünde, einer Stadt, die damals noch in der DDR lag. Ich war vier oder fünf Jahre alt, also in einem Alter, in dem man schon über hohe Zäune klettern konnte. Denn obwohl ich der Liebling von „Schwester Ursula“ war, bin ich ab und zu während der Pausen im Hof abgehauen, über den Zaun geklettert und geflüchtet. Man musste mich dann in der Stadt suchen oder ich war einfach nach Hause gegangen. Mein ein Jahr älterer Bruder war im Kindergarten geblieben.
Ist das eine „echte“ Erinnerung? Oder ist sie durch die Erzählungen der Eltern verfremdet? Auf alle Fälle hatte ich damals noch keine Ahnung von DDR, von deutscher Teilung in Ost und West, von allen Fragen der Politik, die ich heute nicht mehr von den damaligen Eindrücken trennen kann.
Auch bin ich nicht sicher, ob ich ein anderes Ereignis wirklich genauso erlebt habe, wie es später mein Vater immer wiederholt hat: Bei einem Fußballspiel mit vielen Zuschauern habe ich einen aus dem Feld gefallenen Ball genommen und quer über den Platz zu meinem damals schon sehr viel älteren Cousin getragen. Dabei haben mir die Zuschauer aufinuntemd zugeklatscht. Vielleicht war mein Vater stolz über so viel positive Aufmerksamkeit – und hat diese Geschichte so oft erzählt, dass sie mir deswegen im Gedächtnis geblieben ist. Sicher hat er mein Interesse schon früh auf das Ballspiel gelenkt.
Es gibt eine andere Erinnerung, die mit wiederholten Erzählungen meiner beiden Eltern vermischt ist: So hat unser berüchtigter Onkel Franz, ein „Volkspolizist“, ein Vopo, immer wieder Leute verpfiffen, die Westradio gehört haben. Er soll sich an die Fenster fremder Häuser geschlichen und dort gelauscht haben. Hat er jemanden erwischt, so bekam er von seiner Behörde Geld, 50 Mark, so sagte man. Meinem Vater drohte er: „Dich Adenauer Anhänger werde ich auch noch erwischen!“ Er fragte zuweilen meine Oma mütterlicherseits, was mein Vater denn so im Radio höre. Sie wehrte sich mit dem Hinweis, sie höre doch sehr schlecht, was ja auch nicht gelogen war. Onkel Franz war also für uns Kinder so etwas wie ein böser Zauberer, der viel Macht besaß. Von heute aus gesehen eher ein kleiner Mitläufer, wie es ihn zu allen Zeiten gibt. Das Erfreuliche für meinen Vater war dann aber, dass der Onkel einmal ziemlich verbeult und verschrammt rumlief. Keiner glaubte ihm, er sei lediglich die Treppe heruntergefallen. Man hatte ihn wohl ordentlich vermöbelt. So was scheint es in den 50er Jahren in der DDR noch gegeben zu haben. Allerdings auch das gehört zur Realität der DDR: So wurde 1954 der oben erwähnte Cousin verhaftet, als er zusammen mit einem anderen Jugendlichen nach dem Sieg der westdeutschen Fußballmannschaft im Endspiel gegen Ungarn mit über die Schulter aufgelehnten Spaten salutierte, während im Hintergrund die deutsche Nationalhymne lief. Er verschwand auf Nimmerwiedersehen – und so konnte ich ihn nie kennenlemen. Sehr schade!
Mein Bruder Rudi und ich
Bevor mein Bruder und ich ins Schulalter kamen, wollten meine Eltern weg, ab in den Westen, wo wir ja auch eine Menge Verwandte hatten.
Es war im Frühjahr 1957, also noch vor dem Mauerbau und der Grenzschließung, als wir dann „Republikflucht“ begingen. Zunächst mein Vater, mein älterer Bruder und ich, ein halbes Jahr später meine Mutter und meine jüngere Schwester. Uns Kinder wurde eingebläut, wir wollten lediglich meine Großeltern väterlicherseits in Österreich besuchen, was wir an der Grenze auch genauso brav Wiedergaben. Wir glaubten das wirklich, denn wir hatten natürlich gehofft, wieder zu Mutter und Schwester zurückzukommen.
Aber dann fuhren wir zunächst nach Frankfurt, wo wir bei einer katholischen Familie landeten, die uns aber gleich rauswarf, da mein Vater ja evangelisch war. Dieser religiöse Gegensatz hatte sich erst allmählich abgeschwächt, als die deutsche Bevölkerung durch die große Anzahl der Flüchtlinge immer mehr vermischt wurde. Also weiter zu unseren Verwandten mütterlicherseits in das 300-Seelendorf Ebenheid. Dort fanden wir zunächst Unterkunft in einer Art Scheune, wo man uns strohgefullte Matratzen für die Nacht gab. Aber nach zwei Wochen hatten wir eine reguläre Wohnung mit Waschbecken im Flur und einem Klo im Hof, bei dem man, wenn man nach dem Geschäft in die runde Öffnung schaute, unten die dicken Maden sehen konnte. Jedenfalls im Sommer. Im Winter nicht, dafür war es dann von der Kälte her unangenehm, aufs Klo zu gehen. Die Winter waren früher wesentlich härter als heute, die Ortsweiher an beiden Enden des Dorfes waren oft zugefroren – und wir Kinder konnten dort regelmäßig Eishockey spielen. Woher ich die Schlittschuhe hatte, weiß ich nicht mehr, jedenfalls konnte ich ganz gut fahren.
Unsere Wohnung bestand aus zwei Zimmern, einem Wohn- und einem Schlafzimmer. Das war dann zu wenig, als meine Mutter mit der Schwester nachkam. Sie war mit einem Kinderwagen, in dem sie einige Dinge versteckte, nach Westberlin gefahren und von dort nach Westdeutschland geflogen, wo sie und meine Schwester eine Zeitlang in einer Sammelunterkunft leben mussten. Aber schon im Herbst waren wir alle wieder zusammen.
Mein „Weißer Sonntag“ -1959 oder 1960(v.l.n.r.: Detlef, Mutter Rudi, Vater, Ursula.) Festtagskleidung und Krawatten mochte ich nicht – und das ist bis heute so geblieben.
Wir Kinder sprachen einen Dialekt, den unsere Altersgenossen nicht verstanden – und wir verstanden die nicht. Unsere rasche Integration verdanken wir unserer älteren Cousine Hilde. Da unsere Mutter von Anfang an bei den Bauern mitarbeiten musste, um unser Überleben zu sichern, und da mein Vater tagsüber in Miltenberg in einer Kleiderfabrik arbeitete, war Hilde unsere Ersatzmutter. Da Hilde eine resolute Jugendliche war, die sich Respekt verschaffen konnte, waren wir nicht lange als Flüchtlinge verschrien und wir lernten schnell den ortsüblichen Dialekt. Oft konnten wir bei den Bauern, denen meine Mutter bei der Ernte half, zu Mittag essen.
Besonders in Erinnerung ist mir mein gleichaltrigen Freund Emil geblieben, der mich ab und zu einlud, auf einem Ackergaul namens Bella, die Schöne, ums Dorf zu reiten. Wir hatten uns bei unseren Ausritten geschworen, die Welt zu retten. Daran erinnere ich mich noch. Vielleicht hatten wir das aus irgendwelchen Rittergeschichten übernommen und kreativ weiterentwickelt…
Nach einem Jahr konnten wir endlich in eine größere Wohnung etwas weiter unten im Dorf ziehen, wo wir vier Zimmer hatten – und das Klo war endlich innerhalb des Hauses - im Flur. Gekocht wurde auf einem Holz- bzw. Kohleofen. Auf diesem Ofen wurde auch das Badewasser in einem großen Topf erwärmt und dann in eine Blechwanne geschüttet, in der wir am Wochenende alle der Reihe nach badeten. Am besten hatten es immer die, die am ersten baden durften, denn das Wasser wurde zunehmend – sagen wir mal - undurchsichtig.
Da beide Eltern arbeiten gingen, waren wir mehr oder weniger Schlüsselkinder. Die Straße und die Umgebung des Dorfes waren unser Spielplatz. Aufgrund meiner Freundschaft mit Emil durfte ich ab und zu bei ihm zu Mittag essen. Seine Mutter mochte mich offensichtlich und hat mich oft eingeladen. Dafür halfen wir Kinder regelmäßig bei der Ernte. Wenn Heu oder was auch immer aufgeladen wurde, durften – oder mussten – wir den Traktor fahren: Kupplung mit dem linken Fuß, dann den ersten Gang rein, 10 Meter weiter vor gefahren, dann wieder Kupplung rein, Bremse mit dem rechten Fuß und Gang raus. Derweilen luden die Erwachsenen das Heu oder was auch immer auf. Ich glaube, wir waren damals maximal sieben Jahre alt, als wir mit dem Traktorfahren begannen. Kinder lernen schnell. Und es gab nichts Schöneres als nachts oben auf dem Heu zu liegen und in die Sterne zu gucken, wenn die Ernte nach Hause gefahren wird. Im Nachhinein gesehen idyllisch. So frei wird keine Kindheit mehr sein wie unsere damals. Es gab damals noch nicht so viele Regeln.
Selbst bei der Beichte in dem katholischen Dorf gab es für uns Kinder unerwartete Freiheiten, wenn man sich einmal an die äußere Form der kirchlichen Vorgaben gewöhnt hatte. Der im Nachbarort Rauenberg ansässige Pfarrer kam einmal in der Woche in unsere kleine Kirche und hielt in der Sakristei, die links neben dem Altar lag, für alle Kinder, welche die Erstkommunion hinter sich hatten, getrennt von den Erwachsenen die Beichte ab. Wenn man am Sonntag die Hostie wollte, um zu zeigen, dass man OK war, dann musste man zur Beichte. Und irgendwas musste man dort bekennen, sonst wäre man unglaubwürdig. Nicht nur ich dachte so, auch mein Freund Emil, denn schließlich waren ja alle Menschen auf dieser Erde kleine oder große Sünder, wie wir im Religionsunterricht erfahren hatten. Also gestand man irgendwas. Bei mir kamen ab und zu „unkeusche Gedanken“ vor oder im Wechsel irgendwas anderes, von dem ich dachte, dass es schlecht sein musste. Nur so konnte die Beichte schließlich einen Sinn haben.
In der Kirche, so erinnere ich mich vage, saßen Männer und Frauen getrennt. Das war enger beieinander als heute bei einigen muslimischen Gemeinden, aber es war durchaus auch getrennt. Getrennt saßen auch Kinder und angehende Jugendliche. Für uns Jungens erleichterte dies die Begutachtung der Mädels, wenn sie sich für den Sonntag zurecht gemacht hatten. Sie saßen vor ihren Müttern auf der einen Seite – und wir Jungens saßen auf der anderen Seite. Und so konnte man immer gut sehen, wer ein Auge auf wen geworfen hatte…
Bei uns Jungs gab es immer wieder eine Art Bandenbildung. Ich weiß nicht mehr wer gegen wen, aber es ging immer um „die“ gegen „uns“ oder „wir“ gegen „die“. Harmloser als in „Herr der Fliegen“, weil ja die Erwachsenen immer in Reichweite waren. Aber die Gegnerschaft wurde durchaus ernst genommen. Ich erinnere mich an mühsam mit Nägeln und Seilen befestigte Baumhütten in der Nähe des Steinbruchs. Dort wurde eine Alarmanlage eingebaut: Ein Glöckchen – oder eine Blechdose – wurde mit einer stabilen Schnur befestigt, die sehr weit bis zu einem Ausguck reichte. War jemand im Anmarsch, dann zog die Wache zweimal kurz an der Schnur. Das nächste Signal zeigte dann an, wie viele Personen kamen. Ein kurzes Signal hieß nur eine Person, drei kurze Signale zeigten drei Personen an. Wir hatten noch andere Signale, die zeigten, ob es jeweils ernst oder harmlos war, also z.B. ein Spaziergänger vorbeikam, aber welche Signale dafür galten, weiß ich nicht mehr.
Geld spielte bei uns keine so große Rolle. D.h. manchmal doch: So war ich oft, Zufall oder nicht, zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag, in der Nähe von Erwin H. Er wohnte ein Haus weiter den Berg runter – und war aus meiner damaligen Sicht uralt, so um die 40. Für ihn durfte ich oft Zigaretten holen, es war immer dieselbe Marke, also leicht zu merken. Ich brauchte dann bloß runter zum „Kolonialwarenladen“ am unteren „Streckfuß“ rennen und bekam bei meiner Rückkehr die damals für mich enorme Summe vonl 0 Pfennig, d.h. den Gegenwert von zwei Päckchen Brausepulver. Noch heute läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an das bitzelnde Brausepulver denke.
Ähnlich beliebt waren nur die Eisbrocken, die man abstauben konnte, wenn ein LKW große Eisstangen zu einer der beiden Gasthäuser brachte.
Als wir nach einigen Jahren (wir wohnten bereits in einer großen Wohnung) aufgrund der Sparsamkeit meiner Mutter schon etwas wohlhabender waren, konnten wir es uns leisten, ein Schwein im Hof von Onkel Toni schlachten zu lassen, eine Art Schlachtfest zu feiern und danach die haltbaren Teile in einem kühlen Zimmer aufzubewahren, das danach immer stark nach geräuchertem Schinken gerochen hat. Soweit ich mich erinnere, machte es keinem der Kinder im Dorf was aus, beim Schlachten zuzusehen. Es war einfach üblich, dass Tiere geschlachtet wurden, dass bei Schweinen die „Fleischbeschau“ kam und alles für rechtens erklärte, dass manchmal auch der Polizist Weber aus Freudenberg dazukam, der aus irgendeinem Grund immer genau wusste, wer wann und wo geschlachtet hat.
Der Polizist Weber war eine Respektsperson, nicht etwa, weil er so gesetzestreu war. Im Gegenteil, ihm war schon mal der Führerschein abgenommen worden, weil er sturzbetrunken Auto fuhr, nein, er sah einfach irgendwie furchterregend aus mit seinem stierenden Blick. Irgendwas an seinen Augen war ungewöhnlich und machte uns Kindern Angst. Und, das muss man wissen, er war die einzige Vertretung der exekutiven Gewalt weit und breit, die wir zu Gesicht bekamen.