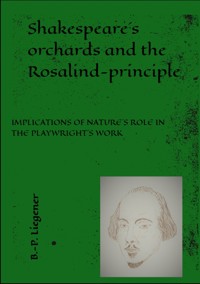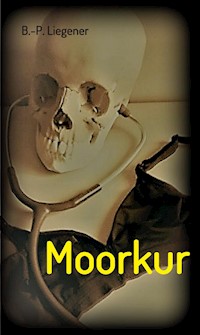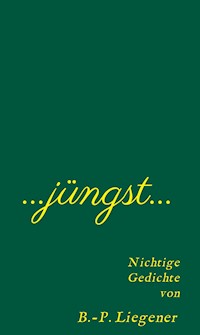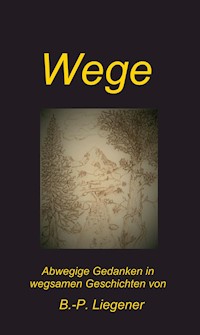
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vielleicht etwas ungewöhnliche, jedenfalls vielfältige Kurzgeschichten über Lebens- und sonstige Wege.
Das E-Book Wege wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Kurzgeschichten, Lebenswege, Skurriles, Anregung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
B.-P. Liegener
Wege
Abwegige Gedanken in wegsamen Geschichten
© 2020 Bernd-Peter Liegener
Umschlagsgestaltung B.-P.Liegener
Verlag und Druck: tredition GmbH,
Halenreihe 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-17933-2
Hardcover:
978-3-347-17934-9
e-Book:
978-3-347-17935-6
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische und sonstige Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Italiener
Biographische Anamnese
Erde
Der Wald
Das Buch
Kehlkopf
Für alle Wegweiser und Wegbegleiter
Vorwort
So unterschiedlich die Geschichtchen und Geschichten dieses kleinen Bandes sind, so haben sie doch ein gemeinsames Thema. Man ahnt es bereits: Es geht um Wege. Wege müssen alle gehen. Wege, die überhaupt erst einmal gefunden werden müssen, Wege, die sich trennen oder treffen, auseinander- und zusammenlaufen. Auch auf die bekanntlich unergründlichen Wege nichtmenschlicher Entitäten wird ein ungewohnter Blick geworfen. Manch Weg ist eher unwegsam. Gefahren und Gefährten machen es schwerer oder leichter einen Weg zuende zu gehen und letztlich sein Ziel zu erreichen. Auch davon, etwas im Leben zu ändern, sich auf einen anderen Weg einzulassen, wird die Rede sein, und schließlich setzen wir uns der Gefahr aus, uns auf bedrohliche Irrwege zu begeben. Liebe Leseraugen, macht euch auf den Weg!
Der Italiener
Mein junges Alter hatte er mir natürlich sofort angesehen, die Unerfahrenheit daraus gefolgert und meine Unsicherheit gespürt. Trotzdem: Er war der Rettungssanitäter und ich der Arzt. Er hatte das Kind mit den unklaren Bauchschmerzen in die Rettungsstelle gebracht, wir hatten eine korrekte Übergabe durchgeführt und ich war nun für alles Weitere verantwortlich. Soweit ich wusste, hatte ich auch alles richtig gemacht: Ausführliche Anamnese, dabei den Vater beruhigt, eingehende körperliche Untersuchung, Fiebermessung oral und rektal, Urinprobe, Blutabnahme. Eigentlich dachte ich, dass der Junge sich nur vor einer Klassenarbeit oder etwas Ähnlichem drücken wollte. Er wirkte einfach zu gesund für seine leidende Miene, irgendwie stimmte etwas nicht. Trotzdem nahm ich ihn ernst. Ein Versuch von Professionalität, obwohl ich mir gar nicht sicher war, ob das Arztsein wirklich meine eigentliche Profession war. „Wir werden jetzt erst einmal die Ergebnisse der Labortests abwarten, dann sehen wir weiter“, erläuterte ich Vater und Sohn mit einem befestigenden Nicken. „Wollen Sie nicht eine Abdomen-Sonografie machen?“, fragte der Krankentransporter. Was tat er überhaupt noch hier? Er hätte längst auf dem Weg zu seinem nächsten Patienten sein können, meinetwegen auch zur Pause. Ich wurde etwas ärgerlich. Wenn ich wirklich Rat bräuchte, könnte ich ja jederzeit den Oberarzt hinzuziehen, da war ich keineswegs auf ihn angewiesen. Andererseits hatte ich mir angewöhnt, auf erfahrene Krankenschwestern und Pfleger zu hören, statt auf mein anstudiertes Wissen hinzuweisen und auf meine Stellung als fachlicher Vorgesetzter zu pochen. Dadurch hatte ich nicht nur viel gelernt, sondern auch das Verhältnis zwischen mir und dem Pflegepersonal war entspannt und vertrauensvoll geworden. Das bescherte mir wiederum manch ruhige Nacht im Stationsdienst, während mein eher besserwisserischer und stets auf Konfrontation bedachter Kollege wegen jeder Kleinigkeit aus dem Bett geklingelt wurde, die eigentlich auch die Nachtschwester hätte entscheiden können. Warum sollte ich also nicht auf diesen Sanitäter hören?
Längst hätte er weg gewesen sein können, aber immer noch stand er da und hielt mit besorgtem Gesicht die Hand des kleinen Patienten. Entgegen meiner ersten Empfindung ging es ihm augenscheinlich nicht darum, mich als inkompetenten Grünspan hinzustellen, sondern darum, den Jungen gut versorgt zu wissen. Um seinen Patienten ging es. Er schien richtig in seinem Beruf aufzugehen und dafür bewunderte, ja beneidete ich ihn beinahe ein bisschen. „Gut“, antwortete ich also nach einem kurzen Schattensprung und, nun wieder zum Vater gewandt: „Ja, ich werde nun noch eine Ultraschalluntersuchung durchführen.“ Und zum Sohn: „Jetzt wird es gleich etwas kalt auf dem Bauch, und dann schauen wir mal, was da drin so los ist, ja?“ Es war nichts los in seinem Bauch. „Alles normal.“ Die Untersuchung war unnötig gewesen wie vermutet. Trotzdem fühlten sich alle besser: Der Sanitäter, der Vater, ich, und sogar der kleine Schmerzpatient. Ich wischte noch die letzten Reste des Ultraschallgels von dem schlanken Bäuchlein, als eine Schwester hereinkam. „Sprechen Sie nicht Italienisch, Herr Doktor? Da draußen auf dem Gang steht jemand, der sich nicht zurechtfindet. Ich kann ihn nicht verstehen, aber ich denke, er ist Italiener.“ Tatsächlich hatte ich vor dem Medizinstudium überlegt Sprachen zu studieren, und vor jedem schweren Examen hatte ich erwogen, doch noch einmal meine Laufbahn in diese andere Richtung zu lenken. Was mir bisher eher wie ein verschrobenes Hobby vorgekommen war, da ich kaum mal ins Ausland verreiste, zeigte sich jetzt als nützliche Fähigkeit. „Ja, ein bisschen“, antwortete ich, und ein wenig fühlte es sich an, als sei meine ins Wackeln geratene ärztliche Souveränität durch diese zusätzliche und unerwartete Kompetenz wieder stabilisiert worden. Ich nickte dem Vater zu, der nun auf die Laborergebnisse warten würde, ich gab dem jetzt zufriedenen Sanitäter mit der Hand ein kurzes Zeichen des Einvernehmens und des Abschieds und folgte der Schwester aus dem Untersuchungszimmer.
Ein wenig deplatziert wirkte er schon, dieser Italiener. Sein unaufdringlich eleganter grauer Nadelstreifenanzug mit der schicken, beinahe ein wenig zu gelben Krawatte bildete einen Kontrast zur nüchternen, funktionalen, ja kahlen Schlichtheit des Krankenhausflurs. Sein eher fortgeschrittenes Alter, die aufrechte Haltung und der konservativ unmodische Schnitt seiner grauen, vollen Haare passten nicht recht in dieses moderne Gebäude, sondern schienen eher in einen alten Backsteinbau zu gehören. Gleichzeitig ließen die funkelnden, beweglichen, wenn auch etwas hilflosen Augen die Leblosigkeit dieses sterilen, langweiligen Ganges deutlicher hervortreten, als ich sie je wahrgenommen hatte. Mit ausgestreckter Hand und einem freundlichen „Buon giorno, Signore“ ging ich auf ihn zu. Er erwiderte meinen Gruß mit einem erleichterten „Dottore!“. Gleichzeitig ergriff er meine Hand und während er sie freudig schüttelte, stammelte er: „No speakeh English very good-eh“. „No problem“, antwortete ich spontan auf Englisch, wie man das eben tut, wenn jemand einen in dieser Sprache anredet. Gleich besann ich mich aber, dass er ja eben nicht gut Englisch sprach und wechselte ins Italienische. Ich erklärte ihm, dass ich ein wenig seine Sprache spräche und fragte, wie ich ihm helfen könne. Seine Augen leuchteten auf und sein ganzes Gesicht wurde zum Spiegel glücklicher Freude. Wie schwierig es sei, sich hier zurecht zu finden, dass er fast schon aufgegeben hätte, jemals seinen Weg zu finden, was für ein Glück er habe, mich getroffen zu haben. Schon, dass er es überhaupt geschafft hätte, hierher in dieses Haus zu gelangen sei ebenso erstaunlich wie erfreulich aber jetzt sei ich ja da. „Che fortuna!“ Es freute mich natürlich sehr, dass er sich so über mich freute, und ebenso sehr, dass ich zumindest fast alles verstanden hatte, was er in einer schier endlosen Flut von wohlklingenden Worten über seine Fährnisse berichtet hatte.
„Schön“, sagte ich, aber wie könne ich ihm denn jetzt helfen? Ich könne ihm helfen, entgegnete er, und dafür wäre er auch sehr dankbar, seinen Weg zu finden. Es sei so schwierig hier in diesem fremden Land, dessen Sprache er ja nicht spreche, und jetzt wisse er nicht, wo er entlang gehen müsse. Diesen Gang entlang, oder jenen, und all die Buchstaben, Zahlen und Pfeile die an den Türen und fast allen Ecken des Ganges, an den Fahrstühlen und Treppenhäusern angebracht waren, seien auch keinerlei Hilfe für ihn, da er sie nicht verstehe. Gerne, meinte ich, würde ich ihm den Weg weisen, aber wo wolle er denn eigentlich hin. Ja, das sei schwierig, sagte er, vielleicht verstehe ich ihn auch nicht so recht, aber all die Abteilungen, die dort angeschrieben standen, die sagten ihm eigentlich gar nichts und so recht wisse er deshalb nicht, wohin er gehen müsse. Er hätte nie etwas für Krankenhäuser übriggehabt, aber nun war alles viel schlimmer, als er sich das von außen vorgestellt habe. Jetzt sei er zwar hier drinnen, aber finde seinen Weg nicht. Glücklicherweise sei ich jetzt da, denn ich sei ja Arzt und kenne mich im Krankenhaus aus. Ich könne ihm sagen, wohin er gehen müsse.
Warum konnte er nur nicht zum Punkt kommen? Tatsächlich war er mir sehr sympathisch in seiner offenen, lebendigen und zugewandten Art. Ob er einen Termin habe und bei wem, ob er einen Namen habe, damit ich ihm weiterhelfen könne. Ja, einen Namen habe er, Salvatore Camino sei sein Name, kein seltener Name in Italien, zumindest nicht in der Gegend, aus der er komme. Er habe seinen Namen immer sehr schön gefunden, auch wenn andere ihn verlacht hätten. Was an seinem Namen denn so lustig gewesen sei, fragte ich ihn, und gerne hätte ich mir auf meine vorschnelle Zunge gebissen, denn das führte uns ja wahrlich nicht weiter. Aber tatsächlich fand ich den Namen seltsam passend, da ich dachte, das Italienische Wort camino bedeute Weg. Ich hatte mich aber geirrt, denn anders als im Spanischen heißt das Italienische camino einfach nur Kamin und folglich hörte ich mir jetzt eine ganze Weile an, wie man ihm früher gesagt habe, er sehe aus wie ein Schornsteinfeger, seine Seele sei ja auch so schwarz, er solle sich verziehen wie eine Rauchwolke, glühe wie die Asche in der Feuerstelle, wenn er mal rot werde und noch viel anderes, was ich nicht alles so recht verstand. Sein Sprachfluss wurde nämlich nicht langsamer, als er sich an diese alten Zeiten erinnerte. Als ich ihm noch mein Missverständnis erklärte, musste er lachen und meinte, dass wir uns dann jetzt aber langsam mal auf den Weg machen sollten. Tatsächlich hatten wir jetzt schon eine geraume Weile in dem trostlosen Flur herumgestanden, und so konnte es wirklich nicht schaden, ein wenig in Bewegung zu kommen. Am besten in Richtung Altbau, denn dort befand sich der Haupteingang mit dem Pförtner. Vielleicht, so dachte ich, könnte der uns ja weiterhelfen, wenn er wenigstens den Namen des vermeintlichen Patienten, vielleicht aber auch Angehörigen oder was auch immer hätte. Vielleicht könnte seine Gegenwart aber auch irgendein erhellendes Schriftstück aus der Tasche meines Wegsuchers zaubern. Falls sich aber mein neuer Bekannter – und dieser Gedanke nahm nach und nach mehr Platz in meinem Bild des alten Italieners ein – in einem irgendwie gearteten Verwirrungszustand befinden sollte, könnte er auch Erkundigungen über eventuelle polizeiliche Personensuchmeldungen einholen, gegebenenfalls sogar einen Transport in eine psychiatrische Klinik organisieren.
Während wir langsam den Gang entlang schlenderten, startete ich einen letzten Versuch. Ob er denn krank sei, wollte ich wissen, denn wenn ich seine Krankheit kennte, könnte ich auch sagen, in welche Abteilung er müsse. Nein, krank sei er nicht. Eigentlich sei er auch noch nie krank gewesen und deshalb auch noch nie in einem Krankenhaus. Da habe er mir ja schon erzählt. Aber jetzt, wo er nun einmal hierhergekommen sei, sei er sehr froh, dass ich ihm helfen werde, sich zurecht zu finden und ihm seinen Weg zu zeigen. „Wohin? Den Weg wohin?“, wollte ich ihn anschreien. Man muss doch wissen, wohin man will, wenn man einen Weg sucht! Aber das hätte sicherlich keinen Sinn gehabt. Wieder hätte er zwar irgendetwas erwidert, eine echte Antwort hätte ich aber wohl nicht bekommen. Also konnte ich unseren gemeinsamen Spaziergang auch nutzen, um mir ein besseres Bild über seinen Geisteszustand zu machen. War er orientiert? Seinen Namen kannte er, dass er im Krankenhaus war, wusste er auch. „Wo wohnen Sie hier in Berlin?“ Im Zweifelsfall konnte man eine vernünftige Antwort nutzen um ihn nachher in ein Taxi mit der richtigen Adresse zu setzen. Nein, er wohne nicht in Berlin. Er sei Italiener und wohne an der Riviera. In dritter Reihe vom Strand. Das Meer könne er von seinem Balkon nur seitlich sehen, aber morgens sei er in fünf Minuten im Wasser, wenn er vor dem Frühstück etwas schwimmen wolle. Ob ich ihn nicht einmal besuchen wolle?