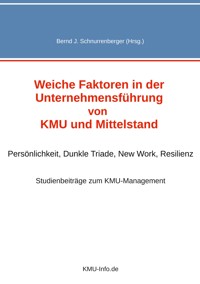
Weiche Faktoren in der Unternehmensführung von KMU und Mittelstand E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein spannendes und in der Betriebswirtschaft eher weniger beleuchtetes Thema sind die sog. "weichen Faktoren" im KMU- und Mittelstandsmanagement. Das mag überraschen, stellen Unternehmer-persönlichkeit, Resilienz, neue Formen der Teamarbeit, New Work etc. doch einen wichtigen - wenn auch teils nur indirekt und "im Verborgenen" wirkenden - Erfolgsfaktor der Unternehmensführung dar. Der vorliegende Sammelband präsentiert daher ausgewählte praxisorientierte Studien- und Forschungsergebnisse zu diesem Themenkreis. Zielgruppe sind Inhaber von mittelständischen Unternehmen (KMU), ambitionierte Führungskräfte und Berufseinsteiger, die sich einen Überblick zu relevanten Themen in der aktuellen Praxis verschaffen wollen. Auch für erfahrene Fachspezialisten mögen die neueren empirischen Ergebnisse von Interesse sein. Als Autoren kommen Professoren sowie wiss. Mitarbeiter und ausgewählte Absolventen des BWL-Master-Studiengangs der TH Brandenburg zu Wort: Prof. Bernd Schnurrenberger und Prof. Michael Stobernack zur "Unternehmerpersönlichkeit". Vanessa Jurkov und Isabell Tückmantel zu (möglichen) "Destruktiven Effekten von Führungspersönlichkeiten" (Dunkle Triade). Franziska Becker zu "Erfolgsfaktoren flexibler Arbeitsmodelle". Ulrike Schellhase zu "Gestaltungsmöglichkeiten gesundheitsorientierter Führung". Elisabeth Herrmann zu "Resiliente Unternehmensführung". www.KMU-Management-Buch.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung (B. Schnurrenberger)
Die Gründer- und Unternehmerpersönlichkeit: Theorie und Praxis (B. Schnurrenberger und M. Stobernack)
2.1 Intro
2.2 Theorie: Modelle der (Unternehmer-) Persönlichkeit
2.2.1 An Diversity-Ansätze angelehntes Modell
2.2.2 Motivbasierte Modelle: Limbic Map und Maslow
2.2.3 Eigenschaftsorientiertes Modell nach Rahn
2.2.4 Modell der Persönlichkeitsdimensionen (des Unternehmers)
2.2.5 Integriertes Modell der (Unternehmer-) Persönlichkeits/-identität
2.3 Praxis: Empirische Analyse zur Gründer- und Unternehmerpersönlickeit.
2.3.1 Zum Selbsttest der Website gruender-umfrage.de
2.3.2 Deskriptive Analyse einzelner Faktoren
2.3.3 Deskriptive Analyse der Gesamtergebnisse
2.3.4 Regressionsanalytische Analyse zu ausgewählten Thesen
2.4 Outro
2.5 Literatur
Destruktive Effekte von Führungspersönlichkeiten - Die dunkle Triade (I. Tückmantel, V. Jurkov)
3.1 Die Einordnung von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie
3.2 Definitionen und Begrifflichkeiten
3.2.1 Führung
3.2.2 Persönlichkeit
3.2.3 Destruktive Führung
3.2.4 Dunkle Triade
3.3 Konstrukte der dunklen Triade
3.3.1 Narzissmus
3.3.1.1 Theoretische Grundlagen
3.3.1.2 Im Kontext von Beruf und Führung
3.3.2 Machiavellismus
3.3.2.1 Theoretische Grundlagen
3.3.2.2 Im Kontext von Beruf und Führung
3.3.3. Psychopathie
3.3.3.1 Theoretische Grundlagen
3.3.3.2 Im Kontext von Beruf und Führung
3.3.4 Vergleich der Konstrukte
3.3.4.1 Gemeinsamkeiten
3.3.4.2 Unterschiede
3.4 Diagnostik der dunklen Triade
3.4.1 Allgemeine Ansätze zur Diagnostik
3.4.2 Start-up Zortify
3.4.3 Praktische Anwendung
3.5 Die helle versus die dunkle Führung
3.5.1 Die helle Führung
3.5.2 Einordnung der hellen und dunklen Führung
3.6 Schlussbetrachtungen
3.7 Anhang
3.8 Literatur zum Beitrag
Flexible Arbeitsmodelle in Deutschland während und nach der Corona Krise - Status quo der Umsetzung und Ableitung von Erfolgsfaktoren (F. Becker)
4.1 Muss die Arbeit zukünftig neu gestaltet werden?
4.2 Theoretische Untersuchung flexibler Arbeitsmodelle in der Corona-Krise
4.3 Analyse der Corona-Krise-Auswirkungen auf die Umsetzung flexibler Arbeitsmodelle
4.4 Empirische Untersuchung des Status quo der Umsetzung flexibler Arbeitsmodelle in der Corona-Krise
4.4.1 Vorstellung und Auswertung der empirischen Umfrageergebnisse
4.4.2 Vorstellung und Auswertung der empirischen Interviewergebnisse
4.4.3 Kurze Zusammenfassung der empirischen Erkenntnisse
4.4.4 Analyse von Erfolgsfaktoren der Umsetzung als Handlungsempfehlungen
4.5 Prognostische Entwicklung flexibler Arbeitsmodelle nach der Corona-Krise
4.6 Fazit
4.7 Literatur und Quellen zum Beitrag
Gestaltungsmöglichkeiten gesundheitsorientierter Führung - unter Berücksichtigung psychischer Belastungsfaktoren in der virtuellen Teamarbeit (U. Schellhase)
5.1 Gesundheitsorientierte Führung als Erfolgsfaktor der Zusammenarbeit auf Distanz
5.2 Theoretischer Hintergrund
5.2.1 Gesundheit als Unternehmensressource
5.2.2 Virtuelle Teamarbeit
5.2.3 Führung als Gesundheitsfaktor
5.3 Gesundheitsorientierte Führung virtueller Teamarbeit
5.3.1 Gefährungdsbeurteilung psychischer Belastungen
5.3.2 Psychische Belastungsfaktoren
5.3.3 Gesundheitliche Konsequenzen
5.3.4 Präventionsförderliche Maßnahmen
5.4 Schlussbetrachtung
5.5 Quellen zum Beitrag
Residente Unternehmensführung - Modebegriff oder zukunftsweisendes Konzept? (E. Herrmann)
6.1 Hohe Anforderungen und Resilienz im Unternehmen
6.2 Begriff der Resilienz
6.3 Resilienz des Individuums
6.3.1 Individuelle Resilienz
6.3.2 Resilienzförderung für Mitarbeiter
6.3.3 Resilienzförderung für Führungspersonen
6.4 Resilienz des Teams
6.5 Resilienz des Unternehmens
6.5.1 Merkmale resilienter Unternehmen
6.5.2 Höhe der Resilienz messen
6.6 Beispiele für Anwendungsformen zur Steigerung der Resilienz
6.6.1 Online Kurse
6.6.1.1 Online Kurse nach Pauls et al
6.6.1.2 Anbieter von Onlinekursen
6.6.2 Präsenzschulung
6.7 Resilienz in der Coronapandemie
6.8 Grenzen des Resilienzkonzeptes
6.9 Fazit
6.10 Quellen
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
a.d.H.
an der Havel
App
Applikationen
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV
Arbeitsstättenverordnung
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
ASiG
Arbeitssicherheitsgesetz
BAuA
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGF
Betriebliche Gesundheitsförderung
BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement
BildscharbV
Bildschirmarbeitsverordnung
BMAS
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
CEO
Chief Executive Officer
CO2
Kohlenstoffdioxid
COVID-19
Corona-Virus-Disease 2019
CV
Curriculum Vitae
DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
EK
Eigenkapital
GDA
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
GG
Grundgesetz
ggf.
gegebenenfalls
HGB
Handelsgesetzbuch
HoL
Health-oriented Leadership
HR
Human Ressource
HRM
Human Ressource Management
IAG
Institut für Arbeit und Gesundheit
IAO
Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
ID
Identifikationsnummer
IDR
Individual Differences Research
IfSG
Infektionsschutzgesetz
iga
Initiative Arbeit und Gesundheit
IKT
Informations- und Kommunikationstechnologie
IT
Informationstechnologie/Informationstechnik
kfm.
kaufmännisch
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
LR-Test
Likelihood-Quotienten-Test
MEgA
Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von morgen SARS-CoV-2 - Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2
MW
Mittelwert
NCS
Nurse Competence Scale
OTRS
Open Ticket Request System
PC
Personal Computer
PCL-R
Psychopathy Checklist - Revised
PESTEL
Politische, wirtschaftliche, sozio-kulturelle, technologische, ökologisch-geografische und rechtliche Einflussfaktoren
ROC
Receiver-Operating-Characteristic-Kurve
SARS-COV-2.
Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus-Typ 2
SD3
Short Dark Triad
SGB
Sozialgesetzbuch
SJT
Situational Judgement Test
SME
Subject Matter Experts
SPSS
Statistik Softwareplattform
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPSS
sammeln, prüfen, sortieren, subsumieren
SWOT
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
Tab.
Tabelle
THB
Technische Hochschule Brandenburg
Tn
Teilnehmer
TVöD
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
vgb
Verwaltungs- Berufsgenossenschaft
VPN
Virtual Private Network
WHO
World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
ZfAM
Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Diversity-Persönlichkeitsmodell (Gardenswartz & Rowe 2003)
Abbildung 2: Limbic Map (nach Häusel, H.G. 2016)
Abbildung 3: Integriertes Modell der (Unternehmer-) Persönlichkeits/-identität (Schnurrenberger 2019, S. 41)
Abbildung 4: Grafik zu 1: Aufstiegs-/Entfaltungsmotiv
Abbildung 5: Grafik zu 2: Risiko-Resilienz
Abbildung 6: Grafik zu 3: Support Privatpartner
Abbildung 7: Grafik zu 4: Einsatz-/Verzichtsbereitschaft
Abbildung 8: Grafik zu 5:Durchsetzungsbereitschaft
Abbildung 9: Grafik 6: Problem instabiles Einkommen
Abbildung 10: Grafik zu 7: Fitness/Gesundheit
Abbildung 11: Grafik zu 8: Stressresistenz/Lösungsorientierung
Abbildung 12: Grafik zu 9: Instrins.Motivation/Zielorientierung
Abbildung 13: Grafik zu 10: Fach-/Branchenkompetenz
Abbildung 14: Grafik zu 11: Orga/Management-/Führungskompetenz
Abbildung 15: Grafik zu 12: Kfm. Kompetenz/Ergebnisverantwortung
Abbildung 16: Grafik zu 13: Vertriebs-/Verhandlungskompetenz
Abbildung 17: Grafik zu14: EK/Investitionsbereitschaft
Abbildung 18: Grafik zu 15: Fokus bei Kollaboration
Abbildung 19: Verteilung der Gesamtpunkte aller Teilnehmer / Gesamtbewertung
Abbildung 20: Stand Gründung
Abbildung 21: Gründung erfolgt
Abbildung 22: ROC-Kurve
Abbildung 23: Unternehmensgründungen je Bundesland
Abbildung 24: Gemeinsame und distinktive Merkmale von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie (Schiemann; Jonas 2020, S. 252)
Abbildung 25: Auswertung helle Berufsgruppen (eigene Darstellung)
Abbildung 26: Auswertung dunkle Berufsgruppen (eigene Darstellung)
Abbildung 27: Zufriedenheit und Leistung (Ehrlich; Lange 2006, S. 25)
Abbildung 28: Frage der Alterszugehörigkeit
Abbildung 29: Frage zur Berufstätigkeit
Abbildung 30: Frage zur Branchenzugehörigkeit
Abbildung 31 : Frage zur Unternehmenswahl
Abbildung 32: Frage zur Ursache bisheriger Meidung flexibler Arbeitsmodelle
Abbildung 33: Frage zur zukünftigen Verbesserung flexibler Arbeitsmodelle
Abbildung 34: Frage zur bisherigen Tätigkeit in flexiblen Arbeitsmodellen
Abbildung 35: Frage zur Vorteilseinschätzung flexibler Arbeitsmodelle
Abbildung 36: Frage zur Herausforderungseinschätzung flexibler Arbeitsmodelle....
Abbildung 37: Frage zum Zeitpunkt flexiblen Arbeitens
Abbildung 38: Frage zur pandemiebedingten Änderung der Arbeitssituation
Abbildung 39: Frage zur pandemiebedingten Einführung flexibler Arbeitsmodelle....
Abbildung 40: Frage zur Bestimmung der pandemiebedingt eingeführten, flexiblen Arbeitsmodelle
Abbildung 41: Frage zur Mitarbeiterpartizipation
Abbildung 42: Frage zur Nutzung von Kommunikationssystemen vor Corona
Abbildung 43: Frage zur Nutzung von Kommunikationssystemen während (nach) Corona
Abbildung 44: Frage zur Organisation/ Kultur vor Corona
Abbildung 45: Frage zur Organisation/ Kultur während (nach) Corona
Abbildung 46: Frage zur zukünftigen Umsetzungsverbesserung flexibler Arbeitsmodelle
Abbildung 47: Frage zur zukünftigen Integrierung flexibler Arbeitsmodelle in den eigenen Unternehmen
Abbildung 48: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung flexibler Arbeitsmodelle
Abbildung 49: Health-oriented Leadership Modell
Abbildung 50: H-l-L-F-E Konzept
Abbildung 51: Gegenüberstellung der Modelle von Soucek et al. (2016) und Reivich und Shatté (2015)
Abbildung 52: Beiträge der internen Unternehmenskultur zur Resilienz
Abbildung 53: Wirkebenen von Resilienz im Arbeitskontext
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Persönlichkeitseigenschaften und Formen ihrer Ausprägung (Rahn 2008, S. 213ff.)
Tabelle 2: Ergebnis zu 1: Aufstiegs-/Entfaltungsmotiv
Tabelle 3: Ergebnis zu 2: Risiko-Resilienz
Tabelle 4: Ergebnis zu 3: Support Privatpartner
Tabelle 5: Ergebnis zu 4: Einsatz-/Verzichtsbereitschaft
Tabelle 6: Ergebnis zu 5:Durchsetzungsbereitschaft
Tabelle 7: Ergebnis 6: Problem instabiles Einkommen
Tabelle 8: Ergebnis zu 7: Fitness/Gesundheit
Tabelle 9: Ergebnis zu 8: Stressresistenz/Lösungsorientierung
Tabelle 10: Ergebnis zu 9: Instrins.Motivation/Zielorientierung
Tabelle 11: Ergebnis zu 10: Fach-/Branchenkompetenz
Tabelle 12: Ergebnis zu 11: Orga/Management-/Führungskompetenz
Tabelle 13: Ergebnis zu 12: Kfm.Kompetenz/Ergebnisverantwortung
Tabelle 14: Ergebnis zu 13: Vertriebs-/Verhandlungskompetenz
Tabelle 15: Ergebnis zu 14: EK/Investitionsbereitschaft
Tabelle 16: Ergebnis zu 15: Fokus bei Kollaboration
Tabelle 17: Mittelwerte / Std.-Abweichungen der Einzel-Items
Tabelle 18: Mittelwert Gesamtpunkte
Tabelle 19: Vergleich MW (m) und MW (w) je Einzel-Item
Tabelle 20: MW Gesamtpunkte nach Branchen
Tabelle 21: MW Gesamtpunkte nach Gründungs-/Unternehmensentwicklungs-Status
Tabelle 22: Logit-Schätzergebnisse der Gründung
Tabelle 23: Logit-Schätzergebnisse der Gründung - modifiziert
Tabelle 24: Klassifizierungstabelle mit cutoff=0,3
Tabelle 25: Klassifizierungstabelle mit cutoff=0,21
Tabelle 26: Logit-Schätzergebnisse der Gründung - halber Datensatz
Tabelle 27: Klassifizierungstabelle für zweite Hälfte des Datensatzes mit n=552 und cutoff=0,3
Tabelle 28: Regionale Unterschiede im Gründungsverhalten
Tabelle 29: Varianten der Telearbeit
Tabelle 30: Frage der Geschlechtszugehörigkeit
Tabelle 31: Frage zur Vollzeit- oder Teilzeitarbeit
Tabelle 32: Frage zur Unternehmensgröße
Tabelle 33: Frage zur bisherigen Tätigkeitsausübung in flexiblen Arbeitsmodellen...
Tabelle 34: Frage zur zukünftigen Tätigkeit in einem flexiblen Arbeitsmodell
Tabelle 35: Frage zur Kostenbernahme der Arbeitsausstattung
Tabelle 36: Frage zur pandemiebedingten Veränderung der Arbeitsausstattung/ Technik
Tabelle 37: Frage zur Produktivität in einem flexiblen Arbeitsmodell
Tabelle 38: Frage zur Führung hinsichtlich der Umsetzung flexibler Arbeitsmodelle.
Tabelle 39: Frage zum zukünftigen Wunsch flexibler Arbeitsmodelle
Tabelle 40: Übersicht der interviewten Unternehmen
1 Einführung (B. Schnurrenberger)
Ein spannendes und in der Betriebswirtschaft eher weniger beleuchtetes Thema sind die sog. "weichen Faktoren" im KMU- und Mittelstandsmanagement. Das mag überraschen, stellen Unternehmerpersönlichkeit, Resilienz, neue Formen der Teamarbeit, New Work etc. doch einen wichtigen - wenn auch teils nur indirekt und „im Verborgenen" wirkenden - Erfolgsfaktor der Unternehmensführung dar. Der vorliegende Sammelband präsentiert daher ausgewählte praxisorientierte Studien- und Forschungsergebnisse zu diesem Themenkreis.
Zielgruppe sind einmal Inhaber von kleineren bis zu mittelständischen Unternehmen (KMU), die alle Funktionen ihres Unternehmens im Blick behalten müssen und letztlich verantworten. Ebenso natürlich aber auch ambitionierte Führungskräfte und Berufseinsteiger, die sich einen Überblick zu relevanten Themen in der aktuellen Praxis verschaffen wollen. Auch für erfahrene Fachspezialisten mögen die neueren empirischen Ergebnisse von Interesse sein.
Dank geht an dieser Stelle insbesondere an das Redaktionsteam, Johanna Hulverscheidt (M.Sc. BWL) und Vanessa Jurkov (M.Sc. BWL), die für die praktische Realisation dieser - bis auf den Einstiegsbeitrag - aus modifzierten ausgewählten Projekt- und Abschlussarbeiten im Master-of-Science Studiengang der BWL am Fachbereich Wirtschaft der TH Brandenburg bestehende Kompilation verantwortlich zeichneten. Zu den Autoren und Beiträgen:
Persönlichkeit ist nicht alles, aber ohne unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeiten geht in der Praxis nur zu oft nicht viel voran. Daher zeigen Bernd Schnurrenberger und Michael Stobernack, beide Professoren an der TH Brandenburg, wie dieses Kontrukt operationalisiert werden kann und welche Ausprägungen unternehmerisch Tätige und Interessierte in der empirischen Realität aufweisen. Grundlage ist ein Datensatz mit ca. 1.300 Teilnehmenden.
Mit den möglicherweise "destruktiven Effekten von Führungspersönlichkeiten" - der sog. dunklen Triade - greifen Vanessa Jurkov und Isabell Tückmantel ein spannendes neueres Thema auf und zeigen in einer explorativen empirischen Studie verblüffende Unterschiede nach Berufsbildern auf.
Mit "Erfolgsfaktoren flexibler Arbeitsmodelle" in Deutschland während und nach der Corona Krise befasst sich im Anschluss Franziska Becker - ebenfalls gestützt auf umfangreiche empirische Daten aus der Unternehmenspraxis. Unter dem Label bzw. als sog. Megatrend "New Work" wird über diese Themen schon länger diskutiert; im neueren Kontext der Coronazeit und der (hier überwiegend befragten) Generation Z allerdings noch intensiver als zuvor.
"Gestaltungsmöglichkeiten gesundheitsorientierter Führung" behandelt dann Ulrike Schellhase. Diese ebenfalls wieder empirisch gestützte Untersuchung fokussiert nicht zuletzt auf psychische Belastungsfaktoren in der virtuellen Teamarbeit, welche in jüngerer Zeit bekannterweise deutlich an Bedeutung gewann. Nicht zuletzt liefert der Beitrag zahlreiche praxisrelevante Hinweise dazu, wie das Management damit konstruktiv umgehen kann.
"Resiliente Unternehmensführung - Modebegriff oder zukunftsweisendes Konzept?" Diese Frage analysiert Elisabeth Herrmann abschließend. Sie zeigt die Spezifika der Resilienz auf Individual-, Team- und Unternehmensebene und bewertet konkrete einschlägige Lern- und Trainingsmöglichkeiten, welche in Online- oder Präsenzschulungen angeboten werden.
Ich danke abschließend nochmals allen Autoren und Mitwirkenden und wünsche unseren Lesern eine angenehme Lektüre und viele gute persönliche Anregungen für die praktische Umsetzung.
B. Schnurrenberger im März 2023
Autoren
Bernd Schnurrenberger & Michael Stobernack
2 Die Gründer- und Unternehmerpersönlichkeit: Theorie und Praxis (B. Schnurrenberger und M. Stobernack)
2.1 Intro
Menschen teilen viele Eigenschaften und Motive miteinander. Im direkten Vergleich einzelner Persönlichkeiten findet sich jedoch auch sehr viel Heterogenität. Dies gilt auch bzgl. der Potentiale und Voraussetzungen für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Dabei gilt die "Unternehmerpersönlichkeit" als zentrale Ressource bzw. Erfolgsfaktor1. In Gründerratgebern steht der "Selbsttest" direkt gleichrangig neben dem "Konzepttest" und jeder Businessplan muss zwingend eine Vorstellung des Gründers bzw. des Gründerteams und ihrer Kompetenzen enthalten2.
Jeder, der sich für eine eigene Gründung oder eine unternehmerische Tätigkeit interessiert, sollte sich daher mit der eigenen Persönlichkeit und Identität auseinander setzen. Unter Identität versteht man "das gefestigte Selbstverständnis eines Individuums, wie es seine Charakteristika, Erfahrungen und Erwartungen sieht, erklärt und zueinander in Beziehung setzt"3. Bzgl. der Identität kann zwischen der Persönlichkeit an sich sowie den Gruppen denen diese angehört unterschieden werden. Dazu zählen Familie, Freundeskreis(e), Milieus, Kulturen bzw. Subkulturen. Auch wenn in unserem Kulturraum die individuelle Persönlicheit oft stark in den Mittelpunkt gerückt wird4, sollte man die Bedeutung dieser "Umfeldfaktoren" nicht vergessen oder unterschätzen.
Auch unsere Erwartungen und Vorstellungen (bzgl. der Zukunft) stellen einen Teil unserer Identität dar. Es ist wichtig, dabei einerseits ruhig einen gewissen Ehrgeiz bzgl. eigener Erwartungen zu kultivieren, aber andererseits auch zu berücksichtigen, was - mehr oder weniger realistisch - möglich ist. Das nach Ansicht vieler Philosophen höchste erreichbare Lebensziel ist, im Rückblick sagen zu können, dass man mit seinem Leben und dessen "Resultaten" zufrieden, evtl. gar glücklich, gewesen ist!5 Zufriedenheit wird dann entstehen können, wenn unsere vorangehende Erwartung (das "Soll") vom Resultat (dem "Ist") mindestens gedeckt, evtl. übertroffen wird6. Im Fall von Gründern etwa gibt es selbstverständlich manche, die gründen um "reich" zu werden. Viele jedoch wollen in erster Linie "einfach nur ihr Ding machen" und Geld spielt eine Art Nebenrolle. Jeder sollte bei der Wahl seiner Ziele auch seine individuelle Ausgangsposition bedenken.
Es steht einem prinzipiell immer offen als Selbständiger oder Gründer zu starten, wie erfolgreiche Beispiele sehr junger wie auch rel. "lebenserfahrener" Gründer zeigen7. In der Fachliteratur wird für die Gründung ein Alter von Ende 20 bis Ende 30 empfohlen, da vorher noch Erfahrungslücken vorliegen und nachher "die Puste während der mühseligen Aufbaujahre" ausgehen könnte bzw. später oft einfach andere Prioriäten gesetzt werden8. Dies mag zwar plausibel klingen - eine zwingende Barriere gibt es aber nicht: Kein "hart Entschlossener" wird sich davon beirren lassen, wenn er nicht in jeder Hinsicht einem (von wem auch immer definierten) "Idealprofil" entspricht.
Ebensowenig muss ein biographisch vorangehendes Scheitern mit früherer Selbständigkeit ein Grund für allzu große Selbstzweifel sein. In den USA etwa wird Scheitern heute mitunter als eine Art "idealer Weg, um zu Lernen" interpretiert9. So weit muss man nicht gehen, aber: Es geht auch immer mal noch anders, wenn man wirklich will (oder muss).
Um zu wissen, was zu einem passt, muss man sich selber kennen. Zum Einstieg und als Anregung zur Reflexion befassen wir uns daher in einem ersten Schritt mit verschiedenen theoretischen Modellen, welche den Versuch darstellen, etwas so Vielschichtiges wie die "Persönlichkeit" strukturell abzubilden (Kap. 2.2). Im Anschluss analysieren wir die Ergebnisse einer empirischen Erhebung im Rahmen eines langjährig laufenden Selbsttests "Bin ich ein Gründertyp / eine Unternehmerpersönlichkeit?" (Kap. 2.3).
2.2 Theorie: Modelle der (Unternehmer-) Persönlichkeit
Es gibt viele verschiedene Antworten auf die Frage, was eine "Persönlichkeit" ausmacht. Entsprechend viele Definitions- und Interpretationsversuche kursieren. Sehen wir uns einige ausgewählte - und durchaus unterschiedliche - Modelle etwas näher an10:
a) ein Modell angelehnt an Diversity-Variablen
b) die Limbic-Map nach Häusel sowie Maslow's Bedürfnisspyramide
c) Persönlichkeitsfaktoren nach Rahn
d) Psychologisches Modell der 5 Dimensionen der Gründer-/Unternehmerpersönlichkeit.
e) Integriertes Modelle der (Unternehmer-) Persönlichkeit/Identität
1 North 2009. Die folgenden theoretischen Abschnitte (Kap. 2.2) sind mit freundlicher Genehmigung an Schnurrenberger 2019 angelehnt.
2 Vgl. etwa beim Businesplan Wettbewerb Berlin-Brandenburg, www.b-p-w.de
3 Schlenker 1985 nach Steinmann, Schreyögg, Koch 2013, S. 635.
4 Man beachte etwa, dass nach dem weitverbreiteten Maslow'schen Persönlichkeitsmodell die "höchstplazierte" Motivgruppe die sog. "Selbstverwirklichung" (des Individuums) darstellt - was immer das im Einzelfall genau heißen mag.
5 Frey, D.; Schmalzried, L.:Philosophie der Führung, 2013, S. 158.
6 Vgl. C/D Paradigma der Zufriedenheit, Balderjahn/Scholderer 2007, S. 132f.
7 Vgl. das einstige "Wunderkind" Windhorst www.manager-magazin.de/magazin/artikel/larswindhorst-das-comeback-eines-hasardeurs-a-1087466.html vs. Senioren-Gründer. (http://gruender.wiwo.de/senioren-start-ups-alt-aber-oho/ (beide abger. 29.3.2019). Ob man sich zu jung oder zu alt fühlt, liegt wohl nicht zuletzt an einem selbst.
8 Vergleiche entsprechende Überlegungen bei Klandt 2006, S. 24.
9 Ries: Lean Startup 2014; vgl. auch die Berliner Veranstaltung "Fuckup Night" - Bühne frei für Loser, http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/fuckup-night-unternehmer-erzaehlen-vom-scheitern-a-1034303.html (abger. 29.3.2019).
10 Vgl. dazu auch: Schnurrenberger, 2019, S. 33 ff.
2.2.1 An Diversity-Ansätze angelehntes Modell
Die Entstehung dieses Modells ist im Kontext des "Trends" Diversity Management zu verorten11. Nach Ansicht seiner Autoren ist es insbesondere zur Abbildung von Diversität bzw. Vielfalt der individuellen Persönlichkeit geeignet (s.u.)12. Das Zentrum wird dabei als "individueller Kern" der Persönlichkeit, It. Beschreibung im Sinne von Emotionen, Einstellungen und Verhaltensmustern definiert. Dieses wird geprägt von einer sog. inneren Dimension "stabiler" physisch-körperlicher Merkmale sowie einer äußeren Dimension, die Persönlichkeitsmerkmale umfasst, welche sich im Lauf des Lebens häufiger ändern können (worunter dann allerdings auch wieder Verhaltensmuster auftauchen). Der organisationale Rahmen des Modells beinhaltet schließlich Eigenschaften des Arbeitsumfelds der Person.
Abbildung 1: Diversity-Persönlichkeitsmodell (Gardenswartz & Rowe 2003)
Betrachtet man das Modell im Gesamten, so fällt die beinahe ausschließliche Fokussierung auf rein äußerlich erkenn- und messbare Variablen auf. Eine Art Persönlichkeitskern aus Einstellungen etc. wird zwar "zugebilligt"; aber nicht näher differenziert. Ganz im Gegensatz zu den "phänotypischen" Variablen der drei "Dimensionen" auf denen der Fokus des Modells liegt und denen letztlich immanent eine prägende Funktion für die Persönlichkeit zugeschrieben wird.
Die in diesem Modell betrachteten Persönlichkeitseigenschaften decken sich ungefähr mit den üblicherweise in einer Bewerbung enthaltenen Eckdaten eines Lebenslaufs bzw. CV (Curriculum Vitae) bzw. mit den sozio-demographischen Angaben eines an Konsumenten gerichteten Marktforschungs-Fragebogens13. Es fehlen aber - um beim Beispiel der Bewerbungsmappe zu bleiben - Angaben über die inneren Motive, Werte, Beweggründe etc. (die man im Bewerbungsanschreiben ergänzend zum CV erwarten würde).
2.2.2 Motivbasierte Modelle: Limbic Map und Maslow
Den entgegengesetzten Schwerpunkt setzt wiederum - die v.a bei Praktikern gerade populäre - sog. Limbische Landkarte, welche Dimensionen des Motiv-/Emotions- und Werteraums beschreiben will. Bereits die Namenswahl lässt hier den eher "genotypischen" Fokus erkennen. Eingeordnet in drei motivationale Dimensionen mit ihren jeweiligen Extrempolen finden sich typische Werte und Motive, die für den einzelnen jeweils eine größere oder geringere Rolle spielen mögen. Nun kann man auf dieser limbischen Landkarte einen Standort oder einen Bereich identifizieren zu dem man sich besonders hingezogen fühlt. Es heißt, Unternehmertypen würden dies oftmals im oberen rechten Bereich der Karte tun. Auf der Suche nach dem (unternehmerischen) Selbst jedenfalls kann eine Positionsbestimmung auf der sog. Limbic Map hilfreich sein, da hier der Fokus darauf gerichtet ist, was uns "im Innersten und grundlegend antreibt".
Abbildung 2: Limbic Map (nach Häusel, H.G. 2016)
Ebenfalls motivbasiert, aber älter und gewissermaßen Standardmodell in der BWL ist die Bedürfnspyramide nach Maslow, welche 5 Ebenen unterscheidet:
1) Physiologische Bedürfnisse,
2) Sicherheit und Geborgenheit,
3) Zuwendung und Liebe,
4) Anerkennung und Selbstwertschätzung,
5) Selbstverwirklichung.
Anders als die limbische Karte ist dies ein hierarchisch aufgebautes Modell, d.h. die Stufen 1-5 bilden eine Hierarchie, wobei die "niedrigere" Bedürfnisstufe immer erst befriedigt sein soll, ehe die nächsthöhere Motivebene virulent würde.
In der Spezialliteratur zum Konsumentenverhalten wird das Modell teils auch kritisch betrachtet, insbesondere was die vorgenannte "strenge" Abfolge der Motive betrifft. Ebenso gilt dies bzgl. der - womöglich v.a. ideologisch begründeten - Platzierung der Selbstverwirklichung an oberster Stelle14.
2.2.3 Eigenschaftsorientiertes Modell nach Rahn
Nach Rahn umfasst die Persönlichkeit die "individuelle Struktur der Eigenschaften eines Individiuums", welche in ihrem eigenständigen Verhalten resultiert. Folgt man Rahn, so kann nicht bei jeder (menschlichen) Person von einer "Persönlichkeit" gesprochen werden, da dies einen ausgeprägten Charakter auf einem gewissen Niveau voraussetze. Persönlichkeitsfaktoren und mögliche Ausprägungen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.
Ausdrucksfähigkeit
z.B. Redegewandtheit, verbale Fähigkeiten
Ausstrahlungskraft
z.B. Charisma, Frohsinn, Heiterkeit
Begabung
z.B. Anlagen, Leistungsfähigkeit, Talente
Belastbarkeit
z.B. körperliche und geistige Beanspruchbarkeit
Intelligenz
z.B. Abstraktionsfähigkeit, logisches Denken
Niveau
z.B. Charakterstabilität, Anstand, Taktgefühl
Reife
z.B. Erfahrung, Leistungsfähigkeit/-bereitschaft
Selbstwertgefühl
z.B. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein
Überzeugungskraft
z.B. Sachlichkeit, Durchsetzungskraft
Vitalität
z.B. Antriebsstärke, Intensität des Wollens
Temperament
z.B. Impulsivität, Munterkeit
Triebfedern
z.B. Strebungen, Antriebe, Engagement
Charakterstärke
z.B. Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft
Tabelle 1: Persönlichkeitseigenschaften und Formen ihrer Ausprägung (Rahn 2008, S. 213ff.)
Man kann sich gut vorstellen, wie dieses Schema im Rahmen eines Tests oder zur Personalbewertung und -entwicklung mit Rating-Skalen (starke bis schwache Ausprägung) eingesetzt werden kann.
2.2.4 Modell der Persönlichkeitsdimensionen (des Unternehmers)
Es gibt eine Vielzahl eher aus der Praxis kommender "populär-wissenschaftlicher" Unternehmer-Selbsttests mit denen man seine "Eignung" für solche Tätigkeiten testen kann15. Einige arbeiten mit Fragen, welche für den Probanden recht gut zu durchschauen sind, etwa: "Macht es Ihnen etwas aus, 60 Stunden die Woche zu arbeiten"?
Man ahnt schon, wie die "ideale Antwort" darauf lautet, nämlich ein freudiges: "Nein, es macht mir überhaupt nichts aus, 60 Stunden zu arbeiten"16. Daneben basieren viele dieser Tests jedoch auf Grundlagen der allgemeinen Persönlichkeitspsychologie. Diese arbeitet gerne faktorenanalytisch, wobei eine Vielzahl von Statements zu wenigen Persönlichkeitsdimensionen verdichtet wird. Klassisch ist eine Kategorisierung in fünf Dimensionen ("big five")17.
Die Persönlichkeitspsychologie liefert auch Erkenntnisse zur "idealen" Persönlichkeit eines Gründers, Unternehmers (bzw.: einer guten Führungskraft). Analog zur allgemeinen differenziellen Persönlichkeitstheorie geht man hier von 5 einschlägigen Dimensionen der "Unternehmer-Persönlichkeit" aus18:
Leistungsmotivstärke: Wie wichtig ist es jemandem, etwas zu leisten - und zwar intrinsisch motiviert, d.h. um seiner selbst willen, nicht (nur) wegen der Belohnung oder des Gewinns.
Internale Kontrollüberzeugung: Wie stark ist unsere Selbstdisziplin, unsere Fähigkeit und unser Wille zur Selbstorganisation ausgeprägt? Treiben wir uns selber an - oder brauchen wir dafür immer andere? Wie steht es mit unserer Überzeugung, etwas bewirken zu können?
Risikioneigung: Gehen wir auch einmal Risiken ein, oder setzen wir immer auf maximale Absicherung? Mit einem gewissen Ausmaß an Risiko sollte man leben und (ruhig) schlafen können19.
Problemorientierung: Tendieren wir dazu, bestehende Probleme pragmatisch und effizient lösen zu wollen und dabei aus jeder Situation das Beste zu machen? Egal ob es mal etwas schwieriger als erwartet ist oder nicht?
Durchsetzungsbereitschaft: Können wir unsere Interessen und Vorhaben - auch gegen Widerstände - konsequent und zielstrebig durchsetzen? Beziehungsweise: Versuchen wir es zumindest beharrlich?20
Aus solchen und ähnlichen Tests können wir etwas über uns selbst lernen (wenn ehrlich geantwortet und nicht "Ergebnis-Optimierungsversuche" betrieben werden). Allerdings sollte man die Ergebnisse von Tests auch nicht überbewerten: Erfahrungsgemäß erreicht hier kaum jemand maximale Gesamtpunktzahlen und ist "rundum perfekt"21. Man sollte auch nie vergessen, dass sich unsere Einstellungen im Laufe unserer Lebens- und Persönlichkeitsentwicklung verändern (können). Zumindest graduell.
11 Vgl. dazu Schnurrenberger 2020, S. 96 ff.
12 l.d.R. wird es auf die Diversity-Beratungsfirma Gardenswartz & Rowe (2003) zurückgeführt vgl. http://www.gleichstellung.uni-freiburg.de/GDManagement; ähnlich: http://www.charta-der-vielfalt.de/diversity/diversity-dimensionen.html (abger. 29.3.2019).
13 Evtl. einmal abgesehen von der Erfassung einer "sexuellen Orientierung".
14 Vgl. Balderjahn/Scholderer 2007, S. 55ff. bzw. Trommsdorff 2002, S. 118f.
15 Vgl. z.B. den kostenlosen Online-Test unter www.gruender-umfrage.de, dessen Ergebnisse in Kap. 2.3 untersucht werden.
16 Auch wenn diese Antwort im Test die Pluspunkte einbringt - die 60-Stunden-Woche entspricht beileibe nicht überall der Realität: Die Geschäftsmodelle bspw. von Buchführungs-Services oder Trainern/Coaches oder niedergelassenen Therapeuten sind extrem skalierbar und eignen sich erfahrungsgemäß gut für eine Art "Teilzeittätigkeit". Natürlich gibt es auch andere Geschäfts-Modelle bei denen täglich mehr oder weniger zwingend 12-15h Arbeit anstehen.
17 Zur Faktorenanayse vgl. Backhaus et al. 2016, S. 385ff. Zu den Big Five vgl. Weibler 2016. S. 101ff.
18 Klandt 2006, S. 19ff., s.a. Fueglistaller 2015 bzw. Kollmann's E-Entepreneurship 2016.
19 Achtung: Jemand der keinerlei Risiko scheut, ist ein "Va-Banque-Spieler" und kein guter Unternehmer - die Risikoneigung sollte also Grenzen haben!
20 Achtung: Zuviel "Ellenbogen" und offener Egoismus bringt auch Nachteile in Form von Widerstand, "Retourkutschen" und Ärger - Vorsicht also vor zu "extremer bzw. ungebremster" Durchsetzungsbereitschaft.
21 Was in einer vom Autor betreuten Hausarbeit bei einer Stichprobe nachweislich erfolgreicher Unternehmer getestet und belegt (aber leider nicht veröffentlicht) wurde. Vergleiche auch die Auswertung in Kap.2.3.
2.2.5 Integriertes Modell der (Unternehmer-) Persönlichkeits/-identität
Die vorangehend Modelle betonen jeweils unterschiedliche Partikularbereiche, die mit dem Thema Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden können: Dies sind beim Diversity-Modell im wesentlichen leicht mess- und kategorisierbare deskriptive Variablen, bei der Limbischen Karte und Maslow teils unterschwellig bzw. unterbewusst wirksame Motive bzw. Bedürfnisse, bei Rahn eher praktisch beobachtbare (Charakter-) Eigenschaften und im psychologischen Modell Ausprägungen tieferliegender "Persönlichkeitsdimensionen" (Einstellungen).
Wenig Beachtung finden bei allen o.g. Modellen jedoch soziale und Umfeldaspekte, wie familiäre und kulturelle Prägungen und Bindungen22. Folgend skizzierter Ansatz soll die genannten Aspekte sinnvoll zu einem Integrierten Modell der (Unternehmer-) Persönlichkeit bzw. -identität vereinen und somit eine ganzheitliche Sicht ermöglichen (Abb. 3).
Das Modell unterscheidet einen prägenden Rahmen, den man auch Verwurzelung nennen könnte. Dieser besteht aus der kulturellen Prägung des Umfelds, welche sich z.B. im Arbeitsethos oder der Mentalität manifestieren kann. Dazu gehört ebenso das familiäre Umfeld, Freunde und sonstige Bezugsgruppen oder -personen.
Weiter lassen sich rel. grundlegende und stabile Charakter- und Wesenseigenschaften unterscheiden23, die von individuellen Werten und Motiven ergänzt werden24. Während sich erstere erfahrungsgemäß als rel. stabil erweisen, können sich die dominierenden Motive - etwa in verschiedenen Lebensphasen - deutlicher verändern (z.B. Abenteuer - Karriere - Familie).
Abbildung 3: Integriertes Modell der (Unternehmer-) Persönlichkeits/-identität (Schnurrenberger 2019, S. 41)
Eng damit verbunden ist der Begriff der praktischen "Kompetenzen". Dies können beim Unternehmer oder Gründer etwa Management-, Fach-, Persönlichkeits- oder auch Sozialkompetenzen sein25. Man geht davon aus, dass eine ausgeprägte Kompetenz auf einem jeweiligen Feld durch das Zusammenwirken der drei Faktoren "Talent", "Wissen" und "Fertigkeit durch Übung" entsteht26.
Schließlich ist noch die Ebene - relativ konkreter - persönlicher Visionen und Ziele zu nennen. Diese werden oft Ausfluss grundlegenderer Prägungen, Einflüsse und Dispositionen sein. Der individuelle Spielraum bei der Auswahl ist jedoch vorhanden - man kann sich für ganz verschiedene Lebensentwürfe oder auch kleinere, zeitlich begrenzte Ziele entscheiden - und somit eher voluntaristischer Natur.
Diese nun abzuschließende Zusammenstellung theoretischer Modelle ist alles andere als vollständig27. Wenden wir uns nun jedoch der Praxis in Form konkreter empirischer Ergebnisse zu.
2.3 Praxis: Empirische Analyse zur Gründer- und Unternehmerpersönlickeit
2.3.1 Zum Selbsttest der Website gruender-umfrage.de
Der Selbsttest zur Ausprägung einer Unternehmer- oder Gründer-Persönlichkeit wurde im Januar 2008 auf der Website www.gruender-umfrage.de allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Selbsttest basiert auf Fragen zu 15 Einzelfaktoren, welche je nach Antwort jeweils mit 0 bis 2 Punkten bewertet werden. Insgesamt können daher maximal 30 Punkte erzielt werden.
Ziel des Projektes war seinerzeit nicht die Gewinnung von Daten zur wissenschaftlichen Untersuchung, sondern die Bereitstellung eines interessanten Services für die Zielgruppen des damals in Vollzeit als freiberuflicher Berater für KMU und Gründer tätigen Autors Schnurrenberger. Dementsprechend wurde nur ein Minimum an Fragen zur soziodemographischen Struktur der Teilnehmer gestellt (Geschlecht, Bundesland, Branche und Stand des Vorhabens).
Ende 2021 entstand im Zuge der Konzeption der vorliegenden Veröffentlichung die Idee, im Zusammenhang mit der Thematik "Persönlichkeit" auch die bis dahin vorliegende Datenbasis auszuwerten. Insgesamt konnten 1.330 Fragebögen dazu herangezogen werden28. Bzgl. der Repräsentativität der Ergebnisse gilt angesichts des oben beschriebenen Hintergrunds einerseits der Vorbehalt der Selbstselektion der Teilnehmer29. Andererseits erscheint die Datenbasis umfangreich genug, um interessante und fundierte Erkenntnisse liefern zu können.
Im folgenden stellen wir zunächst die einzelnen Faktoren und die dabei von den Teilnehmern erzielten Ergebnisse vor. Wir zeigen jeweils die Originalfrage mit den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, eine kurze Einordnung der Fragenthematik und des Ergebnisses, die quantitative Verteilung der Antworten nach Häufigkeiten/Prozenten (direkt aus SPSS) sowie eine grafische Histogramm-Darstellung incl. Normalverteilungskurve ("eine Grafik sagt mehr als Tausend Worte")30. Im Anschluss werden die Gesamtergebnisse unter diversen Blickwinkeln analysiert (Kap. 2.3.3). Dem schließt sich eine vertiefende regressionsanalytische Untersuchung zu ausgewählten Thesen und Zusammenhängen an (Kap. 2.3.4).
2.3.2 Deskriptive Analyse einzelner Faktoren
Da einige wenige Teilnehmer einzelne Fragen ausließen, schwankt N bei den einzelnen Items zwischen 1.309 und 1.328 Teilnehmern.
Hintergrund der Frage 1 ist, dass Unzufriedenheit mit den eigenen Aufstiegsund Entfaltungsspotentialen ein wiederum gutes Motiv ist, sich selbständig zu machen (bzw. es zu bleiben). Immerhin 22,8 % der Teilnehmer fanden sich "Sehr gut" in ihr Los als Arbeitnehmer und bekamen entsprechend 0 Punkte. Ungefähr ein Drittel bzw. 32,8 % fanden dies weniger gut bzw. wenig befriedigend und erzielten 2 Punkte. 44,3% bewerteten mit "Ausreichend" und erzielten 1 Punkt. Grafisch aufbereitet erschließt sich die annähernd symmetrisch normale Verteilung der Antworten.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
299
22,5
22,8
22,8
1
580
43,6
44,3
67,2
2
430
32,3
32,8
100,0
Gesamt
1309
98,4
100,0
Fehlend
System
21
1,6
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 2: Ergebnis zu 1: Aufstiegs-/Entfaltungsmotiv
Abbildung 4: Grafik zu 1: Aufstiegs-/Entfaltungsmotiv
Frage 2 behandelt das Thema Umgang mit Unsicherheit bzw. Risiken. Wer hier findet, dass diese "Kein Grund zur Beunruhigung und begrenzbar" sind, erhält 2 Punkte. Einen Punkt erzielt, wer "damit leben kann" (ca. 30%).
Ebenso diejenigen, die "keinerlei Risko scheuen", denn eine zu hohe Risikoneigung ist für Unternehmer nicht sinnvoll (ca. 10% der Teilnehmer gaben dies an). Wer allerdings "unsicher" bzgl. der Frage ist, erhält keinen Punkt.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
162
12,2
12,2
12,2
1
540
40,6
40,7
52,9
2
626
47,1
47,1
100,0
Gesamt
1328
99,8
100,0
Fehlend
System
2
0,2
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 3: Ergebnis zu 2: Risiko-Resilienz
Abbildung 5: Grafik zu 2: Risiko-Resilienz
Wer positiv von seinem (privaten) Partner unterstützt wird, erzielt 2 Punkte. Dies gilt für erfreuliche 37,5% der Teilnehmer. Teilweise Unterstützte (15%) und Singles (45%) erhalten je einen Punkt. Wer einen Partner hat, aber von diesem nicht wohlwollend unterstützt wird, muss sich mit 0 Punkten begnügen. Hintergrund ist hier, dass keine Unterstützung besser ist, als ein negativ zum Vorhaben eingestellter Partner.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
34
2,6
2,6
2,6
1
794
59,7
60,0
62,5
2
496
37,3
37,5
100,0
Gesamt
1324
99,5
100,0
Fehlend
System
6
0,5
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 4: Ergebnis zu 3: Support Privatpartner
Abbildung 6: Grafik zu 3: Support Privatpartner
Frage 4 zielt auf die Einsatz- und Verzichtsbereitschaft der Teilnehmer und - wenig überraschend - werden 2 Punkte für ein klares "Ja", 1 Punkt für ein "Ja, mit Einschränkungen und 0 Punkte für ein "Nein" vergeben. Letzteres betrifft erwartungsgemäß nur magere 7,2%. Interessant ist eher, dass knappe 50% ihren Einsatz unter einen gewissen "einschränkenden Vorbehalt" stellen. Da kein Alter erhoben wurde, muss dahingestellt bleiben, ob es sich hier um generationenbedingte Phänomene handelt.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
95
7,1
7,2
7,2
1
642
48,3
48,4
55,5
2
590
44,4
44,5
100,0
Gesamt
1327
99,8
100,0
Fehlend
System
3
0,2
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 5: Ergebnis zu 4: Einsatz-ZVerzichtsbereitschaft
Abbildung 7: Grafik zu 4: Einsatz-/Verzichtsbereitschaft
Frage 5 zielt auf die Durchsetzungsbereitschaft und -kraft und - ähnlich wie bei der Risikoneigung - ist hier eine allzu ausgeprägte Konfliktbereitschaft nicht optimal (1 Punkt, den 19% der Teilnehmer erzielten). Ebenfalls 1 Punkt bringt ein bedingtes "Ja, in der Regel schon" (30,7% der Teilnehmer). Ein "Ja, wenn es sein muss, dann immer" erzielt 2 Punkte. Erwartungsgemäß schätzt sich mit 46,2% die größte Gruppe so ein. Nur 4,1% verbleiben mit "Nein, öfter nicht" bei 0 Punkten.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
55
4,1
4,1
4,1
1
659
49,5
49,7
53,8
2
613
46,1
46,2
100,0
Gesamt
1327
99,8
100,0
Fehlend
System
3
0,2
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 6: Ergebnis zu 5:Durchsetzungsbereitschaft
Abbildung 8: Grafik zu 5:Durchsetzungsbereitschaft
Die Tatsache, dass ein Unternehmer kaum je über ein pünktliches und stabiles Gesamteinkommen verfügen wird, stellt einen der wesentlichen Unterschiede zu anderen Beschäftigungsbereichen dar. Wird dies als Problem wahrgenommen? Eine klare Mehrheit von 56,6% sieht dies realistisch und nüchtern als "Normalfall" und erzielt 2 Punkte. Immerhin 38,9% "könnten" damit ein Problem haben. Leider bleibt hier unbeantwortet, ob dies eher aus Mangel an finanziellen Polstern oder aufgrund mangelnder Ausgabendisziplin so gesehen wird.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
60
4,5
4,5
4,5
1
514
38,6
38,9
43,4
2
749
56,3
56,6
100,0
Gesamt
1323
99,5
100,0
Fehlend
System
7
0,5
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 7: Ergebnis 6: Problem instabiles Einkommen
Abbildung 9: Grafik 6: Problem instabiles Einkommen
Frage 7 zum Gesundheitszustand zielt v.a. darauf ab, dass Selbständige sich krankheitsbedingte Absenz "schlechter leisten" können als Angestellte oder Beamte. Denn nur selten kann eine "vollwertige" Vertretung sichergestellt werden, wie die Praxis zeigt. Statistisch gehen Selbständige im Vergleich nur halb so oft zum Arzt wie andere31. Die Teilnehmer der Umfrage geben sich selber hier "erfreuliche Noten": Nur 3,8% sind häufiger krank. Volle 52% "Praktisch nie", was 2 Punkte bringt. 44,2% erzielen mit "Nur gelegentlich" 1 Punkt.
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
51
3,8
3,8
3,8
1
587
44,1
44,2
48,0
2
691
52,0
52,0
100,0
Gesamt
1329
99,9
100,0
Fehlend
System
1
0,1
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 8: Ergebnis zu 7: Fitness/Gesundheit
Abbildung 10: Grafik zu 7: Fitness/Gesundheit
https://www.vgsd.de/sind-selbststaendige-seltener-krank-als-angestellte-beamte-co-seltsam-dass-sich-damit-bisher-kaum-jemand-beschaeftigt-hat/ (abger. 8.2.22)
Frage 8 zielt auf Stressresistenz bzw. auf einen konstruktiven lösungsorientierten Umgang mit auftauchenden Herausforderungen. Hintergund ist, dass stets damit zu rechnen ist, dass Dinge nicht immer glatt laufen und Unternehmer sozusagen "dazu da sind, Probleme zu lösen". 10,3% sehen dies bei sich "nur sehr bedingt" gegeben (0 Punkte). "Eher ja" (1 Punkt) und "Überwiegend ja" (2 Punkte) verteilen sich auf ungefähr gleich große Teilnehmergruppen (44,4% zu 45,3%).
Häufigkeit
Prozent
Gültige Prozente
Kumulierte Prozente
Gültig
0
137
10,3
10,3
10,3
1
589
44,3
44,4
54,7
2
602
45,3
45,3
100,0
Gesamt
1328
99,8
100,0
Fehlend
System
2
0,2
Gesamt
1330
100,0
Tabelle 9: Ergebnis zu 8: Stressresistenz/Lösungsorientierung
Abbildung 11: Grafik zu 8: Stressresistenz/Lösungsorientierung





























