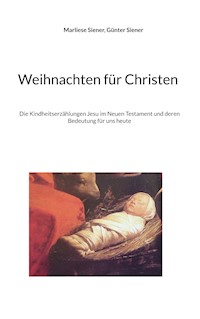
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die legendären Kindheitserzählungen des Neuen Testaments werden heute immer noch als Berichte und Beschreibungen von historischen Ereignissen vorgestellt. Dadurch erscheinen sie für den aufgeklärten Zeitgenossen unglaubwürdig und ihre tiefe geistliche Bedeutung kommt erst gar nicht in den Blick. In diesem Buch wird dieser neutestamentlicheText von den Voraussetzungen seines Entstehens her untersucht und die bleibende spirituelle Bedeutung seiner Bilder für uns heute erschlossen. Menschen, die nach dem biblischen Sinn des Weihnachtsfestes fragen, werden hier begründete Antworten finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht in ihrem Lauf bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel in das Land des Verderbens.“
Weisheit 18, 14f.
INHALT
Vorwort
A.
Hinführung zur Art der Texte
1.
Geschichte oder Geschichten?
2.
Die Kindheitserzählungen als Geburtslegenden
>
Die Inschrift von Priene
3.
Die Aussagen der Kindheitslegenden
> Exkurs: Historie oder Bilder unserer Sehnsucht?
B.
Die Kindheitserzählungen
I.
Nach Matthäus
1.
Der Stammbaum Jesu (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38)
2.
Jesu Geburt (Mt 1, 18-25)
>
Exkurs: Jungfrauengeburt
3.
Die Huldigung der Sterndeuter (Mt 2, 1-12)
4.
Die Flucht nach Ägypten (Mt 2, 13-15)
5.
Der Kindermord in Betlehem (Mt 2, 16-18)
6.
Die Rückkehr aus Ägypten (Mt 2, 19-23)
7.
Zusammenfassung der Kindheitserzählungen nach Matthäus
II.
Nach Lukas
1.
Die Ankündigung der Geburt Jesu (Lk 1, 26-38)
> Exkurs: Davidssohn – Gottessohn
2.
Die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth (Lk 1, 39-56)
3.
Die Geburt des Täufers (Lk 1, 57-80)
4.
Die Geburt Jesu (Lk 2, 1-21)
5.
Simeon und Hanna (Lk 2, 22-40)
6.
Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lk 2, 41-52)
7.
Zusammenfassung der Kindheitserzählungen nach Lukas
C.
Fazit
Literatur, Dank, Bildnachweis
Weihnachten für Christen
Die Kindheitserzählungen Jesu im Neuen Testament und deren Bedeutung für uns heute.
Vorwort
Die biblischen Erzählungen, die sich um die Geburt Jesu ranken, sind den meisten von uns vertraut. Sie begleiten uns seit unserer Kindheit, sei es als Brauchtum wie die Weihnachtskrippe oder die Sternsinger, sei es als Lied wie „Stille Nacht“, oder als liturgische Feier wie die Christmette bzw. die Kinderkrippenfeier. Alle Jahre wieder tauchen wir ein in dieses weihnachtliche Fluidum.
In diesem Büchlein laden wir Sie nun ein, die entsprechenden Texte der Bibel im Zusammenhang zu lesen und sich zu fragen, was deren Autoren dazu bewogen hat, ihre Erfahrungen in diese Worte zu fassen. Sie wollten nämlich mit ihren Erzählungen einen Menschen vorstellen, der ihr Leben völlig verändert hatte: Jesus, der Messias (= Christus). Sie hielten sich an ihn als den erhofften Retter der Menschheit, den „Gott mit uns“. Das Bekenntnis zu ihm war für sie damals gar nicht so beschaulich, eher mit Nachteilen verbunden oder sogar lebensgefährlich. Doch die Botschaft von Jesus Christus war ihnen wichtiger als der Schutz ihres Lebens. So griffen sie Erzählungen auf, die sie vorfanden und die den Kindheitsgeschichten großer Gestalten wie Mose, Samuel, Romulus und Remus, Augustus, Kyros, u. a. m. nachempfunden waren. Daraus formten die Evangelisten Matthäus und Lukas in je eigener Version die Kindheitserzählungen Jesu und setzten sie als „Ouvertüre“ vor ihr jeweiliges Evangelium.
Für uns Christen wird der Inhalt von Weihnachten wesentlich von diesen Texten umschrieben. Es lohnt sich, sie genauer zu betrachten, denn dann offenbaren sie ihre tiefe Spiritualität und können uns helfen, das Leben aus dem Glauben lebendiger zu gestalten und sinnvoller zu feiern.
A. Hinführung zur Art der Texte
1. Geschichte oder Geschichten?
Wenn wir heute diese Texte lesen, haben wir zunächst den Eindruck, historische Beschreibungen vor uns zu haben, die nacheinander berichten, was vor sich gegangen ist. Die Art solcher sachlich beschreibender Berichte sind wir aus unseren heutigen Medien gewohnt und halten sie deshalb für eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die wir hätten filmen können. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass dem nicht so sein kann. Was sind die Gründe für diese Behauptung?
Die Erzählungen enthalten Aussagen, die in einem historischen Bericht fehl am Platz sind und - so aufgefasst - recht fragwürdig erscheinen:
Bei Matthäus:
1, 18-25: Maria erwartet ein Kind, ohne mit einem Mann zusammen gewesen zu sein. Sie erzählt davon nichts Josef, ihrem in die Ehe versprochenen Mann. Dieser wiederum scheint nicht mit Maria über seine Träume geredet zu haben. Ein eigenartiges Verhalten unter „Verlobten“! Die Verlobung war damals eine rechtsgültige Verbindung zwischen Mann und Frau, ohne dass diese bereits zusammenlebten.
2, 1: Die Geburt Jesu wird nur in einem Nebensatz kurz erwähnt. In einem Tatsachenbericht müsste doch dieses Ereignis im Mittelpunkt stehen und ausführlich beschrieben werden.
2, 2: Ein spezieller Stern geht auf, um auf die Geburt eines Menschen in fernen Landen hinzuweisen. Ihm folgen dann die Sterndeuter, bis er über einem ganz konkreten Haus stehen bleibt. Heutigen Astrologen ist ein solches Verhalten eines Sterns und dessen Beobachtern objektiv nicht vorstellbar.
Dazu kommt noch: Warum eigentlich fragen die Sterndeuter nach dem Aufenthaltsort des neugeborenen Königs der Juden, wenn sie doch der Stern genau dahin führt?
2, 8: Der gerissene König Herodes verlässt sich auf die ausländischen Sterndeuter bei der Suche nach dem neugeborenen König. Warum hat er nicht seinen Geheimdienst eingeschaltet, der ihm nach Aussagen der Historiker durchaus zur Verfügung stand?
2, 11: Was ist mit dem Gold geschehen und den beiden anderen kostbaren Geschenken, die Maria und Josef von den Sterndeutern bekamen?
Bei Lukas:
2, 1: Unter Augustus gab es zwar das System der Steuerveranlagung mit Eintragung in die Steuerlisten. In Judäa geschah dies nach Aussage des Historikers Flavius Josephus aber erst im Jahre 6 n. Chr. Da war Jesus bereits etwa 12 Jahre alt, denn heutige Historiker haben seine Geburt für die Jahre 4-6 vor unserer Zeitrechnung ermittelt.
2, 4f: Eine Reise von Josef und Maria von Nazareth nach Betlehem wäre gegen das Gesetz gewesen, da sie ja noch nicht verheiratet, lediglich „verlobt“ waren.
Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Josef die hochschwangere Maria mit auf diese beschwerliche Reise nach Betlehem nimmt, obwohl sie offensichtlich nicht von dort stammt.
2, 8-14: Da ist ständig von Engeln, Träumen und wunderbaren Vorgängen die Rede. In einem historischen Bericht erscheinen aber solch subjektive Aussagen fehl am Platz. Es muss sich also um eine andere Art von Text handeln.
2, 12.15: Woher wussten die Hirten so genau, wo sie den Neugeborenen zu suchen hatten? Futterkrippen waren in und um Betlehem sicher sehr zahlreich.
2, 18: Wieso konnten Maria und Josef über die Worte der Hirten staunen? Sie wussten doch – nach 1, 26-38 – schon längst Bescheid.
Die Erzählungen der beiden Evangelisten sind sehr unterschiedlich. Sie widersprechen sich in vielen Einzelheiten, z. B. im Wohnort von Josef und Maria. Bei Lukas ist es durchweg Nazareth in Galiläa (Lk 1, 26; 2, 4), bei Matthäus ist es zunächst Betlehem in Judäa (Mt 2, 1) und erst nach der Rückkehr aus Ägypten Nazareth (Mt 2, 23). Auch nach dem Johannesevangelium ist es Nazareth. Manche meinen – heißt es da –, dass Jesus nicht der Messias sein kann, weil er nicht aus Betlehem, sondern aus Galiläa kommt (Joh 7, 41f.).
Als Berichte von äußerlich feststellbaren Tatsachen sind unsere Texte wegen der aufgezählten Feststellungen also nicht möglich. Was sind sie dann?
2. Die Kindheitserzählungen als Geburtslegenden
Nach übereinstimmender Aussage der heutigen theologischen Wissenschaft handelt es sich bei unseren Texten um legendäre Erzählungen. Was heißt das, und wie ist es zu begründen?
Die Evangelisten waren keine Reporter oder Historiker. Sie waren gläubige Menschen, die für Christengemeinden schrieben. Diesen wollten sie helfen, Jesus Christus tiefer kennenzulernen. Die Sprache des Glaubens ist jedoch eine andere als die Sprache der Historiker. Wer Glaubensüberzeugungen ausdrücken will, muss sich mehr dem inneren Geschehen widmen als dem äußeren. Der Glaube deutet das vor Augen liegende Ereignis und nimmt es gleichsam mit inneren Augen wahr. „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, hat Antoine de Saint Exupéry formuliert. Die „Augen des Herzens“ aber benützen eigene Sprachformen, so wie auch Liebende sich nicht in naturwissenschaftlichen oder historischen Begriffen beschreiben oder ansprechen. Es handelt sich dabei um bildhafte, zeichenhafte Ausdrucksformen, die innere Ergriffenheit und gläubige Überzeugung auszudrücken versuchen. Eine solche literarische Sprachform ist die Legende. Da steht eine herausragende historische Persönlichkeit im Mittelpunkt, deren Bedeutung für die Leser und Leserinnen stilisierend und schematisierend erzählt wird. Für Matthäus und Lukas ist dies die Person Jesus von Nazareth, der „Messias“ (hebräisch) / „Christus“ (griechisch), der Retter der Menschheit.
In der damaligen Zeit war es üblich, aus der Kindheit einflussreicher Menschen legendäre Geschichten zu erzählen, um deren Bedeutung hervorzuheben. Dabei ging es nicht um historisch zuverlässige Nachrichten, sondern um bildhafte Umschreibungen wesentlicher Merkmale der jeweiligen Persönlichkeit.
Ein Beispiel dafür ist die in Stein gehauene „Inschrift von Priene“ (Text s. u.). Sie wurde am Geburtstag des Kaisers Augustus jedes Jahr feierlich vorgetragen und pries den Tag seiner Geburt in überschwänglicher Weise. Wenn wir diesen Text lesen, der einige Jahre vor der Geburt Jesu entstanden ist, wird uns klar, dass Lukas wohl diesen und ähnliche Texte vor Augen gehabt haben muss, als er die Kindheitserzählungen Jesu aufschrieb. Die Ähnlichkeit der lukanischen Geburtslegende mit dieser steinernen Inschrift reicht bis in identische Begriffe und Bilder hinein, z. B. „Retter“ und „Evangelium“. Diese Tatsache belegt, dass es Lukas bei seiner Kindheitserzählung weniger um Historie in unserem Sinn ging als um die Hervorhebung der Bedeutung des von ihm verkündigten Retters der Menschheit, Jesus Christus, in der Form von Kindheitslegenden.
Da diese Form der Erzählung plastisch und konkret formuliert, klingt sie in unseren Ohren wie ein historischer Bericht. Wir dürfen aber ihre Aussageabsicht, ihre tiefe Wahrheit nicht im äußeren Ablauf suchen, sondern in den erzählten Bildern und Szenen, deren Quellen meist in Texten der Hebräischen Bibel oder in anderer zeitgenössischer Literatur zu verorten sind.
Wenn wir hier von „Legende“ sprechen, verstehen wir also diesen Begriff im Sinn der oben skizzierten Form von Literatur und nicht im Sinn der Alltagssprache, die damit eine „Lügengeschichte“ meint. Bei einer solch oberflächlichen Betrachtungsweise dieser literarischen Form wird deren tiefe Wahrheit nicht beachtet, da man nur dem historischen Bericht eine gültige Aussage zutraut. Der wahre Wert der biblischen Kindheitslegenden liegt also nicht an deren Oberfläche, nicht an den bildhaft ausgeschmückten Einzelheiten, sondern an der Bedeutung die Jesus von Nazaret durch sie für uns erhält.
Kalenderinschrift von Priene, 9. Jh. v. Chr. 1899 ausgegraben
Die Inschrift von Priene
(1899 in der heutigen Türkei ausgegraben, stammt aus dem Jahr 9 v. Chr.)
„Der Tag hat der ganzen Welt ein anderes Aussehen gegeben; sie wäre dem Untergang verfallen, wenn nicht in dem nun Geborenen für alle Menschen ein gemeinsames Glück aufgestrahlt wäre…
Richtig urteilt, wer in diesem Geburtstag den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt; nun endlich ist die Zeit vorbei, da man es bereuen musste, geboren zu sein…
Von keinem anderen Tag empfängt der Einzelne und die Gesamtheit so viel Gutes als von diesem allen gleich glücklichen Geburtstage…
Unmöglich ist es, in gebührender Weise Dank zu sagen für die großen Wohltaten, welche dieser Tag gebracht hat…
Die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, hat diesen Mann zum Heil der Menschen mit solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Retter gesandt hat; alle Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten…
In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt; er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit sämtlich übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass je ein Größerer käme…
Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Evangelien (= Freudenbotschaften) heraufgeführt.“
(Gekürzt und übersetzt von Adolf von Harnack)
3. Die Aussagen der Kindheitslegenden
Was wollten Matthäus und Lukas in ihren Kindheitserzählungen über Jesus sagen? Um welche zentralen Verkündigungsinhalte ging es ihnen dabei? Können sie uns auch heute noch helfen, unser Leben aus dem Glauben zu gestalten und das Weihnachtsfest sinnvoll zu begehen?
Im Folgenden werden jeweils sechs Szenen der beiden Evangelien von Matthäus und Lukas betrachtet. Zunächst finden Sie unter a. die Aussagen zum Text, die deutlich machen wollen, was sich wohl der biblische Verfasser dabei gedacht hat und welche Zusammenhänge und Anklänge zu diesem Text im jeweiligen Evangelium und in der gesamten Bibel entdeckt werden können. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass Sie, verehrte Leserinnen und Leser, diese Texte aus dem Neuen Testament sich stets neu vor Augen führen, sie immer und immer wieder durchgehen und eingehend betrachten.
Danach ist unter b. zu lesen, welche Gedanken uns, den Verfassern dieses Büchleins, bei der Meditation der jeweiligen Szene durch den Kopf gegangen sind, enthalten diese Bilder doch eine enorme spirituelle Kraft. Diese aktuelle und existentielle Wirkung des biblischen Textes ist subjektiv und von persönlichen Erfahrungen geprägt. Diese Gedanken wollen eine Anregung sein für Sie, sich ebenfalls in die jeweilige Szene hineinzuversetzen und im lebendigen Austausch mit deren Personen und Geschehnissen auf sich wirken zu lassen. So wie der heilige Franz von Assisi im Jahre 1223 in den Bergen Umbriens, in dem kleinen Ort Greccio, zusammen mit den dortigen Bewohnern den „Stall von Betlehem“ lebendig werden ließ, um den Menschen das Geheimnis der Geburt Jesu nahe zu bringen. Denn:
„Wir feiern Weihnachten, auf dass diese Geburt auch in uns Menschen geschieht. Wenn sie aber nicht in mir geschieht, was hilft sie mir dann? Gerade, dass sie auch in mir geschehe, darin liegt alles.“ (Meister Eckhart)
Die Kindheitslegenden erzählen also nicht einfach von vergangenen Ereignissen, sie legen vielmehr dar, was auch in unseren Tagen geschieht, denn „heute ist euch der Retter geboren…“ (Lk 2, 11).
Der Messias/Christus will zu jeder Zeit in jedem von uns Gestalt annehmen. Er berührt die Existenz von uns allen. Was in Jesus von Nazaret beispielhaft geschehen ist, war historisch einmalig. Er hat auf einzigartige Weise Gottes Gegenwart unter uns repräsentiert, seine Liebe zu uns bis in seinen Tod hinein lebendig werden lassen. Nun sind wir alle eingeladen, in ihm, dem bei Gott Lebendigen, zu Töchtern und Söhnen Gottes zu werden, indem er stets neu in uns geboren wird und heranwächst. Der Apostel Paulus schreibt: „Meine Kinder, ich erleide für euch von Neuem Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt annimmt“ (Gal 4, 19; vgl. 2 Kor 3, 18).
„Diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sei.“ (Röm 8, 29)
Exkurs: Historie oder Bilder unserer Sehnsucht?
Die meisten Menschen sind heute von der Überzeugung geprägt, dass die Wirklichkeit nur in historischen oder naturwissenschaftlichen Ausdrücken beschrieben werden kann. Alles Poetische ist ihnen deswegen unter dem Aspekt einer wahren Aussage aus dem Blick geraten. Doch wenn wir unser Leben genau beobachten, stellen wir fest, dass es echte Erfahrungen gibt, die ausschließlich in Bildern und Vergleichen ausgedrückt werden können. Dazu gehören z. B. unsere Gefühlswelt, die tiefen Empfindungen der Liebe, die Schönheit der Natur und der Kunst und eben auch der religiöse Glaube. Die Bibel ist deswegen voll von poetischen Ausdrucksformen wie Ursprungserzählungen (Mythen), Sagen (z. B. die Vätersagen des Alten Testamentes), Gleichnissen, Bildworten, Wundererzählungen und Legenden.





























