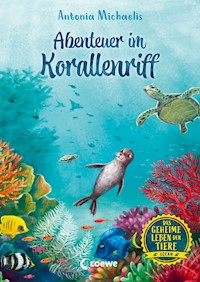15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender Jugendroman von einer hochkarätigen Autorin, der die Leser*innen nach Madagaskar entführt. Madagaskar mit seinen Traumstränden, exotischen Tieren und Blütenmeeren – das reinste Paradies für Emma! Hier kann sie endlich all die Einschränkungen vergessen, die ihre Herzkrankheit mit sich bringt. Doch als Emma die Madegassin Fy kennenlernt, erfährt sie von Armut, Gewalt und einem schrecklichen Geheimnis, den Schattenseiten des Paradieses. Eine berührende Geschichte über eine besondere Freundschaft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Madagaskar mit seinen Traumstränden, exotischen Tieren und Blütenmeeren – das reinste Paradies für Emma! Hier kann sie endlich all die Einschränkungen vergessen, die ihre Herzkrankheit mit sich bringt. Doch als Emma die Madegassin Fy kennenlernt, erfährt sie von Armut, Gewalt und einem schrecklichen Geheimnis, den Schattenseiten des Paradieses.
Ein bewegender Roman über eine besondere Freundschaft
Die Autorin
© ralphbrugger.de
Die studierte Medizinerin, Weltenbummlerin und vierfache Mutter Antonia Michaelis lebt heute als engagierte Autorin mit ihrer Familie an der Ostseeküste. Ihre zahlreichen Bücher sind durchweg ungewöhnlich und bewegend. Sie wurde mit ihrem Jugendroman »Der Märchenerzähler« für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für ihre Romane hat sie zahlreiche Ehrungen erhalten. Antonia Michaelis schreibt für Erwachsene, für Jugendliche und für Kinder. Im Herbst 2019 baute sie auf Madagaskar mit ihrer Familie eine Schule und ein Kinderhaus auf – für Kinder, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Das Projekt wächst und sucht immerzu Paten: www.les-pigeons.net.
Mehr über Antonia Michaelis: www.antonia-michaelis.de
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer*in erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen:www.thienemann-verlag.de
Thienemann auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Thienemann auf Instagram:www.instagram.com/thienemann_esslinger_verlag/
Viel Spaß beim Lesen!
Es ist so schön hier!
Alles ist schön.
Die Boote da draußen, im letzten Licht, Einbäume, in denen die Fischer der Nacht entgegenpaddeln. Die Palme, auf deren fast waagrechtem Stamm ich sitze und die sich so malerisch über das Wasser reckt. Die Kinder, die den Strand entlanglaufen: kleine, übermütige Silhouetten vor dem Sonnenuntergang. Sie haben Muscheln oder Krabben in alten Flaschen gesammelt, balancieren über Felsen, hüpfen hinunter in den Sand, lachen: jeder Schritt ein Abenteuer.
Sie werden nach Hause gehen zu ihren Müttern, in die palmstrohgedeckten Hütten der Insel zwischen den Palmen, sie werden den Fisch essen, den die Väter gefangen haben, sie werden von einem Tag voller Schätze und Entdeckungen träumen.
So wollte ich sein, als Kind. So frei. So wild. Und ich stelle es mir vor: ein Kind auf der Île aux Nattes zu sein, ein Kind in Madagaskar, ein kleines Mädchen mit einem Dutzend geflochtener Zöpfe.
Ich war nie ein wildes und freies Kind.
Vor den Hütten unserer Lodge, vor dem grünen Garten voller blühender Bäume, sitzt auf einer schadhaften Bank die einzige Person, die mir je zugetraut hat, wild und frei zu sein: Elise. Achtzig Jahre alt, etwas eigen, kerngesund. Sie war auch die Einzige, die sich bereit erklärt hat, mit mir hierher zu kommen. Sie war es, die die anderen davon überzeugt hat, dass es eine ganz normale und ungefährliche Reise ist.
Mama war nicht der Meinung. Madagaskar! Allein schon der Flug!
Denn ich bin nicht normal, und nichts ist für mich ungefährlich.
Ich bin Emma. Sechzehn Jahre alt. Zu klein und zu dünn für mein Alter, zu blass, geboren mit einer Fallot-Tetralogie, im ersten Lebensjahr dreimal operiert, seit zwei Jahren Besitzerin einer neuen künstlichen Pulmonalklappe. Und ich bin auf Droge. Immer. Die anderen nennen es Blutverdünner.
Emma Andermann, sechzehn Jahre alt, Herzpatientin. Als wäre es das, was mich ausmacht.
Manchmal werde ich wütend. Mama sagt, ich soll versuchen, gleichmäßig zu atmen und zu zählen, es ist nicht gut für mein Herz, wenn ich mich aufrege. Elise lächelt nur. Wütend sein ist gesund, sagt sie. Lass es raus.
Aber ich will nicht wütend sein, nicht jetzt. Nicht hier, wo alles so schön ist.
Ich habe dieses Reisetagebuch begonnen, um nur die schönen Dinge aufzuschreiben.
Auf der Mole vor der Lodge leuchtet ein Dutzend Laternen in die Dunkelheit, eine Perlenkette aus Lichtern in der Nacht. Irgendwo da draußen, hinter der weiß leuchtenden Gischt der Wellen, schwimmen ruhig und riesig die Wale durch den unendlichen Ozean. Sie kommen hierher, um in den stillen Wassern vor der Insel ihre Kinder zu gebären.
Und ich spüre, wie mein Herz ganz ruhig wird, während es all dies in sich aufnimmt.
Sie haben nicht verstanden, warum ich ausgerechnet hierher wollte.
Sie hätten mich lieber an einen italienischen Strand geschickt oder am besten in ein deutsches Freibad, nach all dem Stress der letzten Monate, der Schule und … allem anderen.
Madagaskar? Warum Madagaskar?
Und dann all die Diskussionen hinter geschlossenen Türen, von denen sie dachten, ich würde sie nicht mithören: Ob ich das kann. Ob das geht. Ob das nicht zu viel ist.
Andere Leute reisen mit sechzehn mit dem Zug durch Europa, machen ein Austauschjahr in Neuseeland, gehen in den Bergen klettern. Aber nicht Emma Andermann, Emma Andermann zählt jeden Morgen ihre Tabletten ab und braucht eine Begleitung, für jede Art von Reise.
»Ich kann sowieso nicht mit«, hat Mama sofort gesagt. »Drei Wochen Urlaub? Jetzt? Unmöglich. Die Arbeit …«
Papa hat ungefähr dasselbe gesagt, am Telefon. »Kannst du nicht irgendwo in der Nähe Strandurlaub machen, Emma? Kürzer? Ein paar Tage am Bodensee …«
»Am Bodensee sind keine Wale.«
»Im Sea Life in München gibt es Wale.«
»Nein. Nur Seepferdchen. Und keinen Urwald.«
»Geht es um den Urwald? Im botanischen Garten gibt es Urwald.«
»Aber keine fast ausgestorbenen Halbaffen.«
Ich hatte die Augen geschlossen und tief durchgeatmet und ihn nicht angeschrien. »Es geht um das Leben. Die Mitte des Lebens. Den Ursprung. Ja, ich weiß, es ist nicht auf dieser verflixten Insel entstanden, aber diese verflixte Insel ist nahe dran. Ich habe so viel gelesen. Sie ist … alles in klein. Der Urwald. Die Tiere. Das Leben im Meer. Ich möchte einmal die Mitte des Lebens sehen.«
Elise und Mama hatten neben mir gesessen, als ich mit Papa telefoniert hatte. Und als ich die Augen wieder geöffnet hatte, hatte Mama mich angesehen, auf diese Art, die ich hasse. Mitleidig. Und Elise hatte gesagt: »Dann lass uns fliegen. Zur Mitte des Lebens.«
Und alle, die davon erfuhren, erklärten sie für verrückt, doch am Ende konnte niemand wirklich etwas sagen, denn sie mag zwar achtzig sein und meine Urgroßmutter, aber sie ist vermutlich die gesündeste Person der ganzen Familie. Und außerdem ist sie nach Mama die Person, die mein Herz und meine Medikamente am besten kennt. Die Person, mit der ich in meinem Leben am meisten Zeit verbracht habe.
»Halbaffen und Sandstrand und Kokosnüsse«, hat sie gesagt und gelächelt. »Das ist genau das, was ich brauche nach den letzten Schulprüfungen.«
»Moment«, habe ich gesagt, »ich habe die zehnte Klasse hinter mich gebracht, nicht du.«
Wir flogen an einem Sonntag. Ich hatte genügend Medikamente im Gepäck, um ein ganzes Krankenhaus über mehrere Wochen zu versorgen.
Die Kontrollen waren eine Zerreißprobe, ich kam mir vor, als täte ich etwas Illegales, als würde irgendwer mich aus der Schlange ziehen und sagen: »Das ist doch Emma Andermann, zuletzt Zimmer dreizehn, wir kennen die Patientenakte! Versucht sie zu fliehen?«
Ich zitterte wie eine Verbrecherin, während sie sich meinen Pass ansahen.
Ich – biometrisch: Sommersprossen, glattes rötliches Haar, eine Brille, die immer zu groß wirkt für das schmale Gesicht. Manche schätzen mich auf dreizehn. Ein Meter 53 steht im Pass.
Ich war ein Frühchen, ein hässliches Ding in einem Inkubator, es gibt Fotos davon. Papa sagt, ich wäre niedlich gewesen. Ich hatte Segelohren von den CPAP-Beatmungsschläuchen und eine nach oben gerichtete Nase, alle beatmeten Frühchen haben das. Die Nase hat sich normalisiert. Die leicht abstehenden Ohren habe ich noch immer. Ich trage das Haar halblang und offen, das verbirgt sie. Aber auf dem Passbild müssen die Ohren frei sein.
Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre jemand anders. Ich habe im Kindergarten damit begonnen, wo alle Kinder größer und stärker waren als ich. Sie durften mich nicht schubsen oder ärgern, das hatten die Erwachsenen ihnen verboten, auf mich musste man aufpassen. Wenn die Erzieher es nicht sahen, streckten die anderen mir die Zunge raus. Und ich träumte davon, groß und dick zu sein und drahtige Locken zu haben …
Dann der panische Anruf von Mama: »Seid ihr schon durch die Kontrollen? Emma, ich weiß nicht, darf denn eine künstliche Pulmonalklappe überhaupt durch den Metalldetektor?«
»Mama. Das Ding ist aus Kunststoff. Nicht aus Eisen.« Und ich versuchte zu lachen. »Ich bin nicht Frankenstein. Nur deine Tochter.«
»Ja. Natürlich. Ich liebe dich. Gott, Emma, ich wünschte, du würdest nicht fliegen. Sag Elise, sie soll auf dich aufpassen. Sag …«
Ich hatte den Ton laut gestellt, und Elise beugte sich zu mir und sagte ins Telefon: »Irmie? Sei ein Schatz und lass deine Tochter jetzt das Telefon aufs Röntgenband legen. Sie ist sechzehn Jahre alt. Wenn überhaupt, passt sie auf mich auf.«
In der Nacht, im Flugzeug, sah ich draußen die Sterne zwischen den Wolken. Elise schlief. Und ich dachte: Jede Minute trägt mich weiter von meinem alten Leben weg, von den Menschen, die wissen, dass sie mich beschützen müssen, dass ich anders bin. Jede Minute trägt mich zu einem Ort, an dem niemand es weiß. An dem ich ein ganz normaler Mensch sein kann.
Zwanzig Stunden später, nach einem zweiten Flug, landeten wir auf der Île Sainte-Marie: Pirateninsel früherer Zeiten. Wir mussten ein Stück fahren, in einem klapprigen Dreiradtaxi, und danach in einem Boot übersetzen. Man hätte zu Fuß durchs warme Wasser hinüberwaten können. Aber das Boot war praktisch, denn es fuhr nicht nur hinüber, sondern weiter, an der Insel entlang bis zu unserem Ziel, und trug geduldig unser Gepäck.
Das Boot bestand aus zwei Einbäumen mit einer Verbindungsplattform und einem Außenborder, und Andry, unserer Bootsführer, hatte alles daraufgestapelt, was sie in der nächsten Woche im Hotel brauchen würden. Einmal in der Woche, erklärte er in seinem gebrochenen Französisch, fuhren sie zum Einkaufen nach Sainte-Marie, dort war alles billiger, und so stapelten sich Eier, Puddingpulver, Reissäcke, Milchpackungen im Boot, gemeinsam mit unserem Gepäck.
Ich machte ein Foto von all dem. Und von Andry. Er lächelt auf dem Bild. Ich hatte gelesen, dass Madagaskar von zwei Seiten besiedelt worden war, von Asien und vom afrikanischen Festland aus. Die Gesichter der Madagassen gehören zu den interessantesten, die ich kenne, und das Strahlen auf diesem Gesicht machte es noch schöner.
Hinter ihm breitet sich auf dem Foto das tiefblaue Meer bis in die Unendlichkeit.
Die Inselküste war ein grünes Band voll bunter Blütentupfen. Irgendwo an einem einsamen Stück Strand stand ein Tisch im Sand, und zwei Leute saßen daran und hoben ihre Weingläser, um uns zuzuprosten.
»Das möchte ich auch machen«, sagte Elise. »Ein Picknick an einem Tisch im Sand, samt Weinkühler. Das hat Klasse.«
Ich lachte. Und ich spürte den warmen Wind auf meiner Haut, roch den Diesel und die frische Ananas, die neben mir im Karton lag. Da draußen, irgendwo, verborgen unter dem Wasser, gebar vielleicht in diesem Moment ein Wal sein Kind.
Und dann waren wir da.
Eine halbkreisförmige Mole aus Felsen rahmte den Ankerplatz für das Boot ein, und darauf wuchsen weiß-blaugeringelte Holzpfähle mit Laternen wie riesige Lollis. Auf einem kleinen Betonsteg saß eine steinerne Frau. Sie hatte langes Haar und einen perfekt geformten Körper, aber der Künstler hatte ihr keine Augen gegeben.
Sie sah nichts von der Schönheit ringsum. Weder das hohe, weiß gestrichene Gerüst im Sand mit der weit schwingenden Schaukel noch die blühenden Büsche, zwischen denen die Palmstrohhütten der Lodge sich erhoben. Weder die Restauranttische noch den alten Herrn, der jetzt über den Strand kam: Ein Pirat mit einer Augenklappe und grauem Haar, der sich galant verneigte, ehe er Elise aus dem Boot half.
»Sehr erfreut«, sagte er. »Jean-Pierre. Dies ist meine Lodge. Und Sie sind … Elise und Emma, nicht wahr? Willkommen im Paradies.«
»Vielen Dank«, antwortete Elise huldvoll, und zwinkerte mir zu. Ich sprang ohne Hilfe ins flache Wasser, die Sandalen in der Hand. Zwei junge Männer hatten unser Gepäck geschnappt und trugen es auf den Schultern zwischen duftenden Bäumen hindurch: junge Männer in ziemlich fadenscheinigen Unterhemden, die Muskeln ihrer Oberarme und Schultern deutlich wie auf einem Gemälde. Ich fragte mich, wie alt sie waren. Nicht so viel älter als ich.
»Guck dir das an«, meinte Elise. »Da wohnen wir. Hütte ist etwas untertrieben, was? Oh, Emma, es ist ein kleines Schloss!« Sie streichelte das tief nach unten gezogene Palmstrohdach, aufgeregt wie ein Kind, und ich musste lächeln. Sie war ein Kind. Ein achtzigjähriges Kind. »Hier draußen auf diesen beiden Liegen werden wir Champagner trinken«, sagte sie und lachte. »Und wir werden Zigaretten in Spitzen aus Elfenbein rauchen …«
»Elise«, sagte ich. »Elfenbein? Rauchen?«
»Ja, ja, deine Mutter hätte etwas dagegen.« Elise seufzte. »Und überhaupt habe ich vor dreißig Jahren aufgehört, aber lass mich doch träumen.«
Sie hatte recht, die »Hütte« war wunderschön, zweistöckig, die dicken, offenen Balken verziert mit geschnitzten Delfinen, Meerjungfrauen, Schildkröten, und auf dem Tisch in der Mitte des runden Raumes schwammen in einer Schale duftende weiße Frangipani-Blüten. Ein Moskitonetz verwandelte das große Bett in ein wahres Himmelbett, und eine schmale Leiter führte zu einem zweiten Stockwerk.
»Die junge Dame vielleicht oben …«, begann der französische Pirat.
Elise und ich sahen uns an. Meine Mutter hätte mir strikt verboten, nachts diese Hühnerleiter hinauf- oder hinunterzuklettern. Wenn sie fällt, Elise, denk daran, sie nimmt Blutverdünner …
»Wir können das Doppelbett unten gut teilen«, sagte Elise vorsichtig.
»Ich schlafe oben«, erklärte ich. »Ich habe eine Taschenlampe.«
Da waren Blüten auf den Betten, zur Dekoration, rote Hibiskusblüten. Die geschnitzten Delfine und Meerjungfrauen, die aus den Balken ragten, schienen seltsam lebendig im Halbdunkel der Hütte, ich betrachtete sie, während der Pirat Dinge erklärte und ich nicht zuhörte, und dann schob er die Tür zu dem winzigen Badezimmer auf, und dort kniete ein Schatten. Ich erschrak.
Der Schatten platzierte eine letzte rote Blüte auf einem Handtuch und schlüpfte an uns vorbei hinaus.
»Ach«, sagte der Pirat, ein wenig verärgert. »Sie brauchen immer zu lange.«
Ich sah dem Schatten nach: eine junge Frau, gebückt, barfuß, eine junge Frau mit einem Buckel. In einem abgewetzten T-Shirt, ein rot-gelb gemustertes Tuch umgeschlungen als Rock. Ich sah sie im Garten der Lodge verschwinden, in all der Schönheit.
»Darf ich Ihnen einen Begrüßungs-Drink anbieten?«, fragte der Pirat.
Also saßen wir an jenem Tag an einem Tisch im Sand, genau wie Elise es sich gewünscht hatte. Wir tranken selbst gemachten Eistee aus hohen Gläsern, und der Pirat brachte ein Tablett mit Rumflaschen voll eingelegter Früchte. »Wir setzen ihn selbst an«, sagte er. »Orange, Zitrone, Vanille, es gibt eine Vanillefarm auf der Insel, weiter südlich, Sie können sie dort auch kaufen. Jaja, das schwarze Gold …«
Er lachte und goss eine Handbreit Rum in zwei Gläser, aber ich schüttelte den Kopf. »Danke.«
Er hob eine Augenbraue. Merkwürdigerweise die auf der Seite mit der Augenklappe. Dann schob er ein Glas zu Elise hinüber und nahm das andere selbst. »Chin-chin! Darauf, dass Sie einen wundervollen Urlaub bei uns verbringen.«
Hinter uns fegte jemand die Terrasse des Restaurants, und ich sah mich um, doch es war nicht die junge Frau mit dem Buckel, es war eine andere Frau, eine pummelige, fröhliche Frau mit lauter dünnen Zöpfchen. Leise französische Musik wehte aus dem Restaurant zu uns herüber.
Doch in meinem Kopf hockte ein Schatten mit einer roten Hibiskusblüte in der Hand.
Der Pirat stand auf, um mit anderen Gästen zu sprechen.
»Schwarzes Gold«, sagte ich leise. »Elise? Das ist keine Vanille. Es sind Sklaven.«
Elise lächelte. »Ja. Madagaskar hat eine abenteuerliche Geschichte. Piraten, Sklaven, mordende Königinnen. Im Moment sieht es allerdings ganz friedlich aus.« Sie legte mir eine Hand auf den Arm und sah mich an. »Lass uns eine Million Muscheln finden und ins Meer springen«, flüsterte sie verschwörerisch.
»Dasselbe hast du jeden Sommer an der Nordsee gesagt. Als ich klein war.«
»Ja«, sagte Elise. »Es war schön, als du klein warst. Kinder werden groß.« Sie stand auf. »Wir können trotzdem Muscheln finden.«
Und wir wateten hinaus ins flache, laue Wasser, und die Sonne fing sich in den Tropfen in Elises weißem Haar und machte sie zu Edelsteinen.
Dann ging ich nur für mich spazieren, ich sagte Elise, ich müsste allein sein mit meinen Gedanken und all der Schönheit ringsum, nur eine Weile. Ich fand Muscheln in allen Formen und Farben, glatte und gerillte, gelbe und rosafarbene und silberne.
Und Korallen: winzige Ästchen, feine verkalkte Kunstwerke. Ich fand auch einen Seeigel und schubste ihn mit einem Stock zurück ins Meer.
»Warum machst du das?«, fragte jemand hinter mir. Auf Französisch mit starkem Akzent.
Ich fuhr herum. Und da stand sie. Die junge Frau mit dem Buckel.
»Weil … weil er noch lebt«, sagte ich verblüfft. »Die Mitte des Lebens … er gehört dazu.«
Sie trug jetzt einen geflochtenen Korb auf dem Kopf, einen Korb voll gefalteter weißer Wäschestücke. Sie stand ganz aufrecht, und da begriff ich, dass der Buckel auf ihrem Rücken gar kein Buckel war.
Es war ein Kind. Ein Kind, mit einem alten blauen Tuch um ihren Körper gebunden, ein winziges Kind, das an einer winzigen Faust lutschte. Es sah mich mit großen dunklen Augen an.
»Ich gehe nach da«, sagte sie und zeigte zur Lodge. »Ich bringe Wäsche zurück.«
»Warte!«, sagte ich. »Ich gehe auch nach da. Ich bringe mich selbst zurück.«
Sie runzelte die Stirn. »Ach so. Du bist keine Französin.«
»Wie bitte?«
»Franzosen machen keine Witze. Komm.«
Ihr Französisch war gut, aber sie sprach es wie eine ganz andere Sprache, es war rund in ihrem Mund wie Murmeln oder Bonbons.
Wir wanderten schweigend nebeneinanderher durch den Sand, und ich sah unsere bloßen Füße an, ihre und meine, schwarz und weiß. Dann sah ich hinauf zu ihrem Gesicht, nur flüchtig, ich wollte sie nicht anstarren. Sie war jünger, als ich zuerst gedacht hatte. Ein Mädchen, keine Frau. Ihr Gesicht war rund wie ihr Bonbon-Französisch, ein schönes Gesicht, ihre Augen mandelfömig und groß, ihre Nase flach, ihre Lippen voll.
Sie trug ihr Haar in vielen kleinen Zöpfen, wie die Frau, die gefegt hatte, aber bei ihr war es zu fünf Knoten zusammengenommen, komplizierte runde Kunstwerke. Über ihre linke Wange und die Stirn lief eine lange Narbe.
Sie fing meinen Blick auf, und ich sah zur Seite, spürte, wie sie jetzt mich musterte. Wir waren stehen geblieben.
Und dann fragten wir. Gleichzeitig. »Wie heißt du?«
Und sahen uns wieder an und grinsten vorsichtig.
»Emma.«
»Fy.«
»Nur Fy? Wie in So-phie?«
Sie lachte. »Wie in Françoise Sophie Soa Ranavolana Rakotomanalalafy. Und … woher kommst du?«
»Deutschland«, sagte ich. »Und du?«
Es war nicht ernst gemeint, natürlich, aber sie kniff die Augen ein wenig zusammen, als gäbe es eine Antwort, und als würde sie sie mir nicht sagen. »Ich muss weiter«, sagte sie stattdessen. »Die Wäsche. Wenn ich zu spät bin, schimpfen sie.«
»Soll ich dir tragen helfen?«
Sie lachte schon wieder. »Du?«
Da stand ich, klein, dünn, sommersprossig, schon jetzt außer Atem, und kam mir dumm vor.
»Es gibt Leute, die denken, ich wäre erst dreizehn«, sagte ich. »Nur, falls du das auch denkst … Ich bin sechzehn.«
»Sechzehn. Ich auch.« Sie lächelte. »Aber du bist eine Vazaha. Eine Weiße. Vazahas tragen keine Wäsche.«
Ich hasste das Wort »Vazaha« sofort.
»Du würdest lachen«, sagte ich. »Ich trage Wäsche. Unterhosen und BHs. Okay, vergiss es, war nur wieder ein blöder Witz.«
In diesem Moment nahm das Baby die Faust aus dem Mund und griff in die Luft, als suchte es etwas. Ich gab ihm meinen kleinen Finger, und es begann, daran zu saugen.
»Es hat Hunger«, flüsterte ich.
Sie nickte. »Auch ein Grund, sich zu beeilen. Der Chef hat es nicht gerne, wenn er sie brüllen hört. Bei der Lodge. Ich stille sie, sobald ich die Wäsche zurückgebracht habe.«
Und so setzten wir uns wieder in Bewegung, das Baby mit meinem Finger im Mund, Fy mit dem Wäschekorb. Neben uns schlug das Meer seine stetigen Wellen an den Strand, während die Dämmerung über das Wasser herankroch.
»Wie heißt sie?«, fragte ich, als wir das hohe weiße Schaukelgerüst vor der Lodge erreichten, und deutete auf das Baby.
»Onja«, antwortete Fy. »Es bedeutet Welle.«
»Schön«, sagte ich. »Und sie ist … deine Tochter?«
»Gestohlen hab ich sie nicht«, sagte Fy. Sie lachte wieder, und dann entzog sie dem winzigen Wellenkind meinen Finger und ging eilig über den Strand hinauf, zur Restauranthütte, wo andere Frauen dabei waren, Gemüse zu putzen. In ihrer Mitte würde sie sich auf den Boden setzen und ihr Kind stillen, mit ihnen ihre Geschichten teilen und ihr Lachen, während der Reis über dem Holzfeuer kochte.
Wie wunderbar musste es sein, dieses kleine Wesen im Schoß zu fühlen, das einem so ganz vertraute. Fys Leben, dachte ich, hatte einen Sinn. Meins hatte keinen. Vielleicht würde ich hier, auf dieser Insel, einen finden.
Auf den Tischen, die ihre Füße im Sand haben, flackern jetzt Kerzen. Ich kann kaum mehr sehen, was ich schreibe, hier auf meinem Palmenstamm. Es duftet nach Curry. Elise sitzt nicht mehr auf der Bank. Ich glaube, sie wartet an einem der Restauranttische auf mich. Ich werde zu ihr gehen. Leise, leise schlagen die Wellen an den dunklen Strand, und in der Nacht schlafen die Wale.
In mir jedoch schläft noch das Bild jenes Gesichts mit der Narbe auf der Wange, das Bild der ebenmäßigen Haut und der vielen Zöpfe. Fy. Gott, sie ist so schön. Ich, im Spiegel, bin nichts als blass und rothaarig, meine Augen haben die Farben von altem Moos, aber sie ist schön.
Gott, sie ist so schön.
Alles an ihr ist schön.
Ihr rotgoldenes Haar, das ihr Gesicht umgibt wie ein Heiligenschein. Ihre helle Haut und die kleinen braunen Tupfen darauf, Tupfen wie Sterne. Und ihre leuchtenden Augen. Sie sind grün, grün wie das Grün des Waldes unterhalb des Leuchtturms, dort, wo er am grünsten ist.
Ja, kleine Onja, du weißt, von wem ich spreche.
Emma. Sie heißt Emma. Selbst der Klang ihres Namens ist schön. Sie ist so alt wie ich. Die anderen Vazahas, die herkommen, sind älter. Oder es sind ganz kleine Kinder mit ihren Eltern.
Wie war sie, als kleines Kind? Sie musste nicht den ganzen Tag nach Muscheln und Krebsen suchen wie die Kinder hier. Ich stelle mir vor, dass sie auf einem Berg von bunten Kissen saß und durch ihre Brille Bücher angesehen hat. Die sie lesen gelernt hat, in einer Schule. Ich wünschte, ich könnte dich eines Tages zur Schule schicken. Aber ich fürchte, wir haben wenig Chancen.
Im Moment reicht das Geld gerade für den Reis und ein paar Tomaten. Siehst du, kleine Onja, ich gebe mir Mühe, Vitamine zu essen, damit die Milch gut ist, die ich dir gebe.
Faly würde das wollen. Dass du nur das Beste bekommst. Er hat dich geliebt, obwohl er dich nicht kannte; obwohl du noch nicht geboren warst, als er uns hierhergeschickt hat.
Ich wollte weinen, als ich sah, wie sie ihn mitnahmen. Ich habe nicht geweint, ich habe dich in mir gespürt und wusste, ich muss mit allem weitermachen. Ich muss den Bus finden, von dem er erzählt hatte. Ich muss tapfer sein.
Weißt du noch, wie wir ankamen?
Wir sind hinübergewatet, nachts, und ich dachte, wir ertrinken, doch wir haben es geschafft. Und wir sind weitergewandert unter den Sternen und haben das Dorf gefunden und den Großonkel, und dann bist du geboren worden, Onja. Da drinnen, in der Hütte, zwischen den Bretterwänden. Es ist eine wundervolle Hütte. Auch wenn sie immer nach dem Fisch riechen wird, den sie früher darin getrocknet haben, auch wenn das Dach nicht dicht ist, was macht das schon, es ist unsere Hütte, das ist es, was zählt.
Schau, die Sterne sind weitergewandert.
Die Sterne in der Stadt waren anders. Kälter. Weiter weg.
Die Stadt ist grausam und riesengroß, sie war nie freundlich zu mir. Nur diese Insel, Onja, diese kleine Insel ist freundlich. Sie wird euch beschützen, hat Faly gesagt. Auf der Insel werden sie euch niemals finden.
Du bist eingeschlafen, kleine Onja, du hörst mich nicht mehr.
Auch die Berge schlafen, um das Dorf herum, und irgendwo unten, in ihrer Hütte beim Strand, schläft Emma. Ich wünschte, ich könnte sein wie sie. Ich wünschte, ich könnte einschlafen, ohne Angst zu haben.
Was für ein Tag! Wieder sitze ich und schreibe, es dämmert, und die Kerzen flackern auf den Tischen im Wind, golden, immer bedroht von der Gefahr, zu verlöschen – so wie die Nachtfalter, wunderschön und groß, ständig in Gefahr, im Feuer zu verglühen.
Wie fragil die Schönheit ist, wie vergänglich das Leben!
Heute sind wir vom Krähen der Hähne geweckt worden und vom Muhen eines Rindes.
Es stand vor der Palmstrohhütte: ein junges Zebu-Rind mit hohem Höcker hinter dem Kopf, weiten, geschwungenen Hörnern und einem Fettlappen vorn an der Brust.
Muuuuuuh!
Ich zog mich an, leise, um Elise nicht zu wecken, öffnete die schweren Holztüren und sah im dunstigen Mondlicht in die sanften Augen des Zebus. Es war schwarz und sehr jung und sah ratlos aus. Und es zog einen Strick hinter sich her, einen blauen Plastikstrick, offenbar hatte es sich irgendwo losgerissen.
»Ich weiß nicht, wo du hingehörst«, sagte ich und streichelte seinen weichen Kopf. »Tut mir leid.«
Dann schlüpfte ich in meine Turnschuhe – und dann zog ich sie wieder aus. Und lief barfuß die kleinen Sandwege entlang, zwischen den gepflegten Hecken zum Strand.
Die große zweistöckige Palmstrohhütte des Restaurants ragte in den Morgenhimmel wie ein schlafender Riese. Drei träumende Hunde lagen zwischen den Stühlen. Auf einem der Tische standen noch Weinflaschen und Kerzenständer vom vergangenen Abend.
Ich grub meine Zehen in den Sand, atmete den salzigen Geruch des Meeres ein.
Die ganze große Freiheit.
Die steinerne Frau saß still vor dem glatten Wasser, selbst die Wellen schienen noch zu schlafen.
Ich holte noch einmal tief Luft und lief los, joggte den Strand entlang, spürte Muschelstückchen unter meinen bloßen Füßen. Ich bin auch in Berlin jeden Morgen vor dem Frühstück joggen gegangen, es gehörte zu meinem Programm, Ausdauersport ist gut, sagen die Ärzte, aber ich hatte immer gekämpft: mit meiner vorgeschädigten Lunge, mit dem harten Asphalt unter meinen Schuhen, mit dem Widerwillen, aufzustehen und einen neuen Tag zwischen all den Menschen und Geräuschen und Erwartungen da draußen zu beginnen.
Hier ging es leicht.
Das Wasser spielte Ebbe, hatte sich zurückgezogen und eine glatte Fläche für mich übrig gelassen; fast war es, als flöge ich, vorbei an angespülten, entrindeten Baumstämmen, an Fischern, die ihre Netze säuberten, an den Sammelkindern.
Aber irgendwann war meine Lunge müde, und ich blieb stehen, bemühte mich, gleichmäßig zu atmen – und da sah ich ihn.
Er stand am Strand, die Arme erhoben, in einem Regen aus bunten Farben. Einem Regen aus Bällen. Ein Jongleur. Ein Zirkuskünstler mitten am Strand der Îles aux Nattes, nur die kleinen Krebse im Sand waren seine Zuschauer. Und ich. Ich ging langsam näher, da bemerkte er mich und ließ die Bälle fallen.
Sah mich an. Grinste.
Er hatte helles Haar, blond, unter seinem gelben T-Shirt war seine Haut sonnenverbrannt, er trug Badeshorts und war barfuß wie ich, und seine Augen waren dunkelgrün wie die Palmen im Hintergrund dieses perfekten Bildes.
»Bonjour«, sagte er. »Es ist noch nicht mal acht. Du … bist früh auf.«
»Du auch.«
»Und du sprichst Französisch.« Sein Grinsen wurde breiter.
»Du auch«, sagte ich.
Jetzt lachte er. »Ja, aber ich bin Franzose.« Er hob die Bälle auf, es waren sieben, und ich sagte, noch etwas außer Atem: »Sieben. Eine Menge.«
»Ach, ich bin noch nicht wirklich gut«, sagte er und zuckte die Schultern. »Ich übe. Hier hat man viel Platz.« Er breitete die Arme aus, drehte sich im Kreis. »Eine wunderbare Insel. Ein wunderbares Land. Bist du gestern gekommen?«
Ich nickte.
»Allein?«
Offenbar hielt er mich nicht für dreizehn. »Fast allein«, sagte ich. »Du?«
»Wir machen eine Tour durchs Land. Ich und mein Rucksack.« Er lächelte. »Vorher war ich auf Mauritius. Paragliding. Du schwebst da oben in der Luft, und unter dir die große Freiheit … hast du das mal gemacht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Solltest du«, sagte er. Dann jonglierte er weiter, schickte den Regen aus Bällen zurück in den Himmel, und ich schaute ihm einen Moment lang zu. Doch er schien mich vergessen zu haben.
»Bis dann«, sagte ich schließlich. Und drehte mich um und lief zurück. Ich flog nicht mehr, ich war müde, aber ich zwang mich, zu joggen, nicht stehen zu bleiben, nicht zu gehen, denn vielleicht sah er mir trotz der Bälle nach.
Wie alt war er? Zwanzig, einundzwanzig? Und er war ganz allein unterwegs. Niemand musste auf ihn aufpassen. Garantiert wartete auf ihn kein Frühstück aus Blutverdünner und Malariaprophylaxe.
Elise saß an einem der Tische im Restaurant, das jetzt erwacht war, vor sich eine Tasse Kaffee.
»Emma«, sagte sie und lächelte mir entgegen. »Du warst laufen.«
»Du hast dir … keine Sorgen gemacht?« Ich ließ mich auf den Stuhl neben ihr fallen, keuchend.
»Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht«, sagte Elise und legte ihre alte faltige Hand auf meine junge. Auf meiner war ein wunderschöner Bluterguss von der Flexüle der letzten Kontrolle im Krankenhaus. »Seit du ganz klein bist, mache ich mir Sorgen«, sagte Elise. »Aber das ist in Ordnung. Du kannst trotzdem morgens joggen gehen.« Sie sah in ihre Kaffeetasse. »Der Kaffee ist scheußlich. Und die Milch ist aus. Aber es gibt Baguette und Marmelade und ein klein wenig Butter.«
Ich lachte. »Wir sind eben auf einer einsamen Insel. Vielleicht werden wir von Piraten entführt.«
»Dann hoffe ich, sie haben besseren Kaffee an Bord«, sagte Elise und lachte.
Ich nahm meine Tabletten mit einem Schluck aus der Wasserflasche, die Elise auf den Tisch gestellt hatte. Eine blaue Plastikflasche. »Immerhin gibt es genug Wasser«, sagte Elise. »Sie kaufen es auch auf Sainte-Marie drüben.«
»Sie … kaufen es?«, fragte ich. »Es kommt doch aus dem Hahn? Wir haben eine Dusche … Trinken die Leute es nicht?«
»Die Leute schon«, sagte Elise. »Aber nicht die Touristen. Piratenentführungen sind in Ordnung, Keime im Wasser nicht. Vor allem für dich nicht. Sonst sind wir schon wieder bei Dauerantibiose zur Endokarditisprophylaxe, da hast du auch keine Lust drauf. Weißt du, warum es keine Teller gibt?«
Ich sah mich um. Das Pärchen am Nachbartisch hatte auch keine Teller. Ein sehr glückliches, verliebtes Pärchen, sie mit einer roten Hibiskusblüte im Haar. An einem anderen Tisch saß der alte Pirat, ein Baguette in der Hand, und nickte uns zu, huldvoll, ein König in seinem Reich.
»Man scheint das Brot in der Luft zu schmieren und in der Hand zu essen«, sagte ich. »Elise? Kannst du jonglieren?«
»Das wüsstest du, oder? Wir haben fast dein ganzes Leben zusammen verbracht. Warum?«
»Ich … hatte darüber nachgedacht, ob ich es lernen könnte«, murmelte ich und merkte, wie mein Gesicht ein wenig heiß wurde.
Und ich biss in mein Marmeladenbaguette und lehnte mich zurück und lauschte der Kaffeehausmusik aus dem Inneren des Restaurants, zu der ein junger fröhlicher Madagasse den Dielenboden scheuerte. Er tat es mit einem Fuß, an dem er eine Art Schrubber aus einer Kokosnusshälfte befestigt hatte, es war wie ein Tanz.
Alles war schön und leicht und froh, und sicher schadete es nicht, auf eine schöne und leichte und frohe Weise verliebt zu sein, nicht ernsthaft, nur ein wenig, wie ganz normale sechzehnjährige Mädchen es sind.
Mitten in den Tanz hinein wanderte am Strand eine Gestalt mit einem Korb voller roter Blüten auf dem Kopf. Sie balancierte auch nicht nur die Blumen. Sie hielt gleichzeitig mit einer Hand das Baby, hielt es an ihre Brust, sie stillte es im Gehen.
Der Chef hört es nicht gern, wenn sie brüllt
Sie machte einen Bogen um die Restauranttische, sah mich nicht oder wollte mich nicht sehen, hatte es offenbar eilig – schaffte es, an der Seite des Restaurants, wo sie kochten, den Korb abzusetzen, ohne das Baby loszulassen und hockte sich zu den anderen Frauen, die miteinander lachten und Töpfe schrubbten und Kaffee kochten über einem Kohleöfchen. Sie half ihnen.
Aber, seltsam, da war eine spürbare Distanz zwischen ihr und den anderen.
Die anderen waren fröhlich. Unbeschwert. Sie hatten es nicht eilig mit dem, was sie taten, sie aßen zwischendurch zum Frühstück Reis aus einer gemeinsamen Schüssel. Nur Fy schien merkwürdig gehetzt, nur Fy aß nicht mit ihnen.
Und schließlich stand sie auf, band ihr Baby auf den Rücken, hob den Korb mit den Blüten auf ihren Kopf, ohne dass jemand half, nahm einen Eimer und einen Besen und verschwand zu den Hütten.
»Emma?«, fragte Elise. »Du hast gleich einen Knoten im Hals, wenn du ihn weiter so verrenkst. Wen beobachtest du?«
»Die … Frauen«, murmelte ich. »Da ist eine … ich habe gestern kurz mit ihr gesprochen. Sie ist so alt wie ich. Sie hat ein Kind. Ein Mädchen. Onja.«
»Das … ist möglicherweise normal für hier«, sagte Elise vorsichtig. »Es ist in vielen Kulturen normal.«
Ich nickte. Aber ich dachte, dass nichts an Fy normal war. Sie trug etwas mit sich herum, zusätzlich zu all den anderen Dingen, die sie ständig trug, etwas Unerklärliches und Dunkles. Ein Geheimnis. Sie schien Angst vor den anderen hier zu haben. Oder vielleicht hatten die anderen Angst vor ihr.
Ich sprach an jenem Morgen nicht mit Fy. Ich sah sie zwischen den Hütten umherhuschen wie einen Schatten. Ich war nicht sicher, ob es ihr gefallen würde, wenn ich sie bei der Arbeit störte, und so spielte ich Schach mit Elise und machte Bilder vom Garten, von der Schaukel am Strand, vom Meer, Bilder zum Nachhauseschicken.
Ich schrieb meinen Eltern, einzeln, denn sie leben nicht zusammen, nicht mehr, seit ich sehr klein bin. Es geht mir gut!!!, schrieb ich. Mit drei Ausrufezeichen. Seht nur, wie schön es hier ist!
Wir wanderten zu zweit los, Elise und ich, in Badeanzügen und leichten, luftigen Röcken: zwei ungleiche Sommerschwestern. Zuerst gingen wir in die Richtung, in die ich am Morgen gejoggt war, aber der Jonglierkünstler war nirgends zu sehen, und wir kehrten um und gingen in die andere Richtung, füllten eine Tasche mit Muscheln. Schließlich sagte Elise, sie würde umkehren, sie bräuchte noch einen scheußlichen Kaffee, und ich sollte ruhig allein weitergehen.
Am Ende der Bucht lag eine Gruppe von großen Felsen. Man konnte darum herumgehen, ein kleiner Pfad führte über eine schattige Wiese voller Cashewnussbäume zur nächsten Bucht – aber gerade als ich meinen Fuß auf diesen Pfad setzen wollte, nahm ich eine Bewegung im Augenwinkel wahr, eine Bewegung auf dem Meer. Und ich fuhr herum.
Mein erster Gedanke war: Ein Wal, da draußen ist ein Wal, ich habe seine Schwanzflosse gesehen – aber es war ein Boot. Ein Kanu, einer der schmalen Einbäume, doch es fuhr nicht gemächlich an der Küste entlang wie die Fischer, die ihre Netze mit sich schleifen.
Es glitt über die Wellen wie ein Surfbrett.
Und die Person, die den Einbaum mit einem langen Paddel antrieb, war kein Madagasse. Es war ein, wie sie hier sagen, Vazaha. Einer, in dessen hellem Haar sich die Sonne verfing. Aufrecht stand er da, jede Welle ausbalancierend –
Mein Jongleur.
Und da nahm ich den Weg über die Felsen, um ihm weiter zuzusehen.
Ich kletterte bis ganz nach oben, von Felsen zu Felsen, manche waren glitschig, und an einer Stelle musste ich über eine Ritze springen. Ich fühlte mich wieder wie ein Kind, ein glückliches Kind, das atemlos von Stein zu Stein sprang, sich an den Bäumen festklammerte, die aus Felsspalten wuchsen: mal auf allen vieren und dann wieder aufrecht, nur nicht abrutschen! Nur nicht fallen! Und dann stand ich oben, auf dem höchsten Felsen, hoch über dem Meer.
Na ja, ehrlich gesagt: vielleicht waren es drei Meter.
Und ich sah den Jungen draußen in seinem Boot vorbeischießen, sah ihn auf den Wellen reiten, hin und her, er nutzte den Einbaum wie ein Surfbrett, stand aufrecht, das Paddel in den Händen wie eine Balancierstange. Ein Zirkuskünstler.
Da streifte ich meinen Rock ab, legte die Brille darauf, stand nur in meinem blauen Badeanzug da.
Und ich hob die Arme über den Kopf und sprang.
Ich war ein Pfeil. Ich war ein fliegender Fisch. Ich, Emma Andermann, Patientin aus Zimmer dreizehn – ich landete in einem flachen Bogen im Wasser. Ich hatte das oft genug im Schwimmbad geübt, Schwimmen ist eine Ausdauersportart, Schwimmen darf auch eine Herzpatientin. Unter Aufsicht. Hier gab es keine Aufsicht.
Ich spürte die plötzliche Kühle um mich, tauchte auf, schnappte nach Luft, schwamm. Kraulte. Mit langen Zügen, auf den Horizont zu, wie der Einbaumsurfer vor mir. Hatte er mich gesehen? Er musste mich gesehen haben. Mich, Emma. Sechzehn Jahre alt, auf dem Weg ins Leben.
Ich tauchte. Tauchen ist verboten. Aber nur tiefes Tauchen. Oder?
Ich tauchte unter der Oberfläche, hielt die Luft so lange an, wie ich irgend konnte, keine gute Idee, Emma, sagte eine Stimme in mir, der Druck in der Lunge steigt, dein Herz muss dagegenpumpen … Schließlich kam ich hoch, schwindelig, strich mir das Haar aus den Augen, das jetzt nicht mehr orange war, sondern dunkel von Wasser.
Etwas schoss auf mich zu, in einer Welle, und ich erschrak, doch dann kam es direkt vor mir zum Stillstand. Der Einbaum.
»Hey«, sagte sein Steuermann.
Ich wollte etwas sagen. Etwas wie: Du hast meinetwegen gewendet. Oder: Ich wusste nicht, dass man das mit einem Einbaum machen kann. Aber mein Atem reichte nicht für einen Satz. »Hey«, sagte ich.
Er hatte sich hingehockt, in seinem Boot, und ich hielt mich daran fest. Es war schön, sich festhalten zu können.
»Du bist eine gute Schwimmerin«, sagte er.
Ich nickte nur.
»Luc«, sagte er. »Ich heiße Luc.«
Noch ein Nicken. Sag was, Emma! Ich konnte nicht.
»Ich versuche es noch mal mit den Wellen weiter draußen«, sagte er. »Schade, dass es keine Bretter hier gibt. Surfbretter. Aber vielleicht ist das hier sogar besser. Ursprünglicher.« Er hielt das Paddel hoch. »Eines Tages möchte ich da draußen die Wale sehen. Mit diesem Ding. Ich hab’s gemietet, quasi. Von einem sehr coolen Typen. Also dann …« Seine Augen suchten die nächste gute Welle. Und ich ließ los, weil es nicht anders ging. Weil er weiter wollte. Ich sah ihn winken, lächeln, davonpaddeln.
Und ich legte mich auf den Rücken und schwamm zurück, langsam.
Ruhig atmen. Ausdauersport. Du kannst das. Du bist sehr weit vom Land entfernt, aber es ist kein Problem. Du bist eine gute Schwimmerin.
Das Dumme war: Die Wellen trieben mich seitwärts ab. Ich würde zwei Kilometer weiter am Strand ankommen … Und ich wusste nicht, ob man dort an Land konnte. Also drehte ich mich wieder auf den Bauch und schwamm gegen die Strömung an.
Zählte meine Atemzüge.
Dann sah ich, dass auf dem höchsten Felsen jemand stand. Genau dort, wo ich gestanden hatte. Und einen verwirrenden Moment lang dachte ich: Das bin ich selbst. Ich stehe dort und sehe mir zu und winke. Unsinn. Die Person am Ufer trug ein verblichenes rot-gelbes Tuch um die Hüften und ein graues T-Shirt und hatte einen Korb neben sich stehen, den sie eben abgestellt hatte.
Es war Fy.
Sie winkte mit beiden Armen, panisch fast, schien etwas zu rufen, was ich nicht hörte. Setzte sich auf den Felsen, ganz vorn, als überlegte sie, zu springen. Mir entgegenzuschwimmen. Aber sie hielt das Baby im Arm! Wie war sie überhaupt mit dem Korb und dem Baby auf diesen Felsen gekommen? Onja, dachte ich. Das Kind, das Welle hieß.
Sie rief noch einmal. Was rief sie? Lauerte etwas in der Dunkelheit unter dem Wasser, das ich nicht kannte?
Nicht panisch werden, Emma. Panik ist gefährlich. Schwimm weiter. Schwimm.
Ich schwamm. Meine Arme schmerzten. Die Strömung war ein Raubtier. Was, wenn ich es nicht schaffte? Es war eine dumme Idee gewesen, so weit zu schwimmen, eine dumme und gefährliche Idee, ich war am Ende meiner Kräfte.
Aber ich schaffte es. Erreichte den Strand, seitlich der Felsen, kroch mehr aus dem Wasser, als zu gehen, saß einen Moment auf dem Sand und rang nur nach Atem. Dann kletterte ich zu Fy auf die Felsen, mühsam, meine Arme zitterten.
»Emma«, sagte Fy. Erleichtert.
»Warum … hast du gewinkt?«, fragte ich und versuchte, meine Erschöpfung zu verbergen.
»Weil es verboten ist«, sagte sie. »Fady. Was du getan hast. Von diesem Felsen zu springen. Wir dürfen hier gar nicht sitzen. Die Felsen zwischen den Buchten … Ränder der Welt. Sie sind alle fady. Der Chef … normalerweise sagt er es den Leuten. Er hat eine Karte. Die Fadys sind rot eingezeichnet.«
»Fady. Das heißt … verflucht?«
»Vielleicht«, sagte sie. »Es ist wie … auf Französisch … heilig. Nur … umgekehrt. Heilig ist das Helle. Fady ist das Dunkle.«
»Aber du bist auch hier raufgeklettert.«
Sie nickte. »Ich hatte Angst. Um dich.« Sie legte die Hände flach auf den Felsen unter sich, und ich tat es ihr gleich.
»Er ist warm«, sagte ich.
Sie nickte. »Als ob er lebt.«
»Sollen wir runterklettern?«
Da hob sie den Kopf und sah mich an, nachdenklich, und plötzlich zuckte sie die Schultern und sagte: »Jetzt ist es auch schon egal. Wenn du ein Fady brichst, ist es gebrochen. Die Geister sind zornig. Dieses Land ist voller Geister. Voller Verbote. Etwas wird passieren.« Sie wisperte jetzt. »Ich dachte … es passiert gleich, aber ich habe mich geirrt. Ich dachte, du ertrinkst.«
Ich sagte nicht: Das dachte ich auch. Ich sagte: »Ich bin eine gute Schwimmerin.«
Und ich nahm meinen Rock, der noch auf dem Felsen lag, und trocknete damit mein Gesicht ab. Onja hielt einen Zipfel des Stoffs fest, zog ihn an sich und begann, daran zu nuckeln.
»Sie ist so niedlich!«, sagte ich. Fy nickte. Und ich wollte tausend Dinge fragen: Wo ist ihr Vater? Warum wirst du ein Schatten, wenn du in der Lodge arbeitest? Wer bist du?
»Ich hoffe nicht, dass die Geister sich an Onja rächen«, sagte Fy leise. »Sie ist so klein. Sie kann nichts dafür, dass ihre Mutter auf einen Felsen geklettert ist.«
»Hast du mal ein Fady gebrochen, und es ist wirklich etwas passiert?«, fragte ich.
Sie nickte. Und sagte lange nichts. Wir saßen nur auf Felsen und spürten seine Wärme, zu zweit.
»Ich wurde geboren«, sagte Fy schließlich. »Ich wurde geboren und nicht ausgesetzt. Das war das Fady, das ich gebrochen habe.«
»Wie?«
Sie streichelte Onjas winzigen Kopf; den weichen schwarzen Haarflaum. »Meine Mutter kommt aus einem Ort weit fort von hier. Mananjary. Jeder Ort hat seine Fadys …« Sie zögerte. »In Mananjary sind Zwillinge fady. Sie müssen getötet oder ausgesetzt werden. Gleich nach der Geburt. Ich war ein Zwilling.«
Ich schluckte. »Aber du lebst.«
Sie nickte. »Sie hat mich nicht weggegeben. Obwohl alle ihr gesagt haben, dass sie es tun muss. Sie hat den Fehler gemacht, uns nach der Geburt anzusehen. Mich und meinen Bruder. Die Frauen versuchen, Zwillinge nicht anzusehen. Meine Mutter hat uns angesehen, und sie hat gesagt, sie hat uns sofort so sehr geliebt, dass sie uns nicht weggeben konnte. Sie ist aus Mananjary weggegangen. In der nächsten Nacht. Sie hat mich auf den Rücken gebunden und meinen Bruder vor ihren Bauch, und so ist sie in einen Bus gestiegen. Sie ist bis in die Hauptstadt gefahren. Nach Tana.«
»Du bist also nicht von hier.«
»Von hier?« Sie lachte kurz auf. »Nein. Wir sind seit drei Monaten hier.«
»Deine Mutter … Ist sie auch hier? Oder noch in Tana?«
Fy sah wieder zum Horizont hinaus. »Sie ist tot«, sagte sie knapp.
»Ich … das tut mir leid. Und … dein Bruder?«
Da legte Fy plötzlich ihre Hand auf meine, auf dem Felsen. »Frag nicht so viel«, flüsterte sie. »Wer weiß, was die Geister hören.« Und dann lachte sie wieder. »Na ja, wahrscheinlich sind sie blind und taub, sie sind so alt! Wir hatten eine schöne Zeit. Mein Bruder, meine Mutter und ich. In der Hauptstadt. Wir hatten viel Glück. Am Anfang. Das Fady erfüllt sich nicht sofort, es lässt dich manchmal warten, es lauert, bis du es vergessen hast … Meine Mutter hat niemandem in Tana gesagt, dass wir Zwillinge sind, Faly und ich. Sie hat sein Haar ganz kurz geschnitten und meines lang wachsen lassen, um die Ähnlichkeit zu verbergen.« Sie grinste ein wenig. »Sie war eine kluge Frau, meine Mutter. Obwohl sie nie Französisch gelernt hat oder lesen oder schreiben. Sie hat hart gearbeitet. In Mananjary hatten wir ein Feld, Reis und Gemüse, und sie hat alle unsere Ersparnisse mitgenommen und hat dafür ein Zimmer gemietet in Tana, bei einer strengen Frau, die ein kleines Haus hatte. Im anderen Raum wohnte sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Das Haus stand neben einem Kanal, an dem die Leute alles Mögliche verkaufen, Ersatzteile für Fahrräder und Flaschen und Plastiktüten, ich weiß noch, wie wunderbar ich diesen Markt als Kind fand, und im Kanal konnte man zwischen dem Müll manchmal noch heile Dinge finden, die jemand weggeworfen hatte. Das Wasser stank, aber als Kind war mir das egal. Das Haus war türkis gestrichen, daran erinnere ich mich noch, türkise Bretter. Wir hatten alle Platz auf dem Boden, zum Schlafen, und das Wellblechdach war gut, es regnete nur an zwei oder drei Stellen durch. Meine Mutter fand Arbeit als Gemüseverkäuferin, wir waren den ganzen Tag mit ihr unterwegs in den Straßen, einen trug sie hinten und einen vorne im Tuch, sie kaufte das Gemüse frühmorgens von einem Händler und verkaufte es über den Tag. Sie war eine gute Verkäuferin. Immer freundlich, immer zuvorkommend. Als wir laufen konnten, halfen wir ihr. Ich habe Wasser vom Kanal geholt, um das Gemüse zu waschen.« Sie lachte. »Der Eimer war fast so groß wie ich … Faly hat mir geholfen. Obwohl es keine Arbeit für Jungen ist. Es war ihm egal, dass die anderen gelacht haben.« Sie schloss die Augen. »Drei oder vier Jahre ging es gut.«
»Warte. Wo war euer Vater?«
Sie zuckte die Schultern. »In Mananjary. Er wollte meine Mutter sowieso nicht wiedersehen, nachdem sie Zwillinge geboren hatte. Wir hatten einander, und das war genug. Faly und ich, wir waren unzertrennlich. Wir haben hart gearbeitet, aber es war alles ein Spiel, das Wassertragen, das Verkaufen … Wir haben die Kohlestückchen gesammelt, die der Kohleverkäufer verloren hat, und abends sind wir auf unser Lager aus Decken gefallen, unsere Mutter hat immer gesagt, wir schlafen wie zwei kleine Hunde, so dicht beieinander. Als wir älter waren, haben wir uns am Morgen unsere Träume erzählt. Es waren dieselben.«
Sie hatte die Augen noch immer geschlossen, und auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln, das glitzerte und glänzte wie das Licht draußen auf den Wellen. Ich sah sie vor mir: zwei kleine Kinder mit kohlschwarzen Händen und einem Lachen im Gesicht. Zwei Träumer, zwei Abenteurer, die frei und ungebunden durch die Straßen streunten, weit entfernt von Krankenhausmauern und Apparaten.
Ich seufzte. »Es muss schön gewesen sein.«
»Ja«, sagte Fy. »Erzähl mir von dir. Von früher.«
Ich dachte an das kleine, blasse, einsame Kind, das in einem weißen Bett lag, in dem es nach Sauberkeit und Sterillium roch. Das Kind, das so sehnsuchtsvoll aus dem Fenster in den blauen Himmel sah. Und das sich nichts mehr wünschte, als seine Hände mit Kohle zu beschmieren und in einem schmutzigen Kanal zu plantschen.
Das Kind, dessen Mutter sich die Hände desinfizierte, ehe sie es anfasste. Das Kind, das die Angst seiner Mutter sah und sich fragte, wovor sie Angst hatte. Davor, dass alles vorbei sein könnte – oder davor, dass es ewig so weiterging?
Erzähl …
»Ein andermal«, sagte ich.
Fy öffnete die Augen, nahm die kleine Onja und stand auf. Der Ast eines Baumes, der in einer Felsspalte wuchs, wippte neben ihr auf und ab, und ich stand ebenfalls auf und griff danach.
»Guck, es ist ein Ruder«, sagte ich. »Wenn wir Kinder wären … wir könnten spielen, dass der Felsen unser Piratenschiff ist …«
Sie lachte. »Wir werden da draußen einen riesigen Fisch fangen. Heute Abend muss niemand hungern.«
»Nein!«, sagte ich. »Es ist ein Zauberfisch! Ein Geisterfisch. Wir werden ihn nicht töten, und dafür haben wir einen Wunsch frei. Wir könnten uns wünschen, dass er uns zu einem versunkenen Schatz führt, den wir dann zusammen rauftauchen …«
»Ich kann nicht schwimmen«, sagte Fy.
»Und ich darf nicht tauchen«, sagte ich. »Was würdest du dir wirklich von dem Fisch wünschen?«
Sie musste nicht nachdenken. »Dass er das Fady löst, das wir gebrochen haben.«
»Was ist denn damals passiert?« Ich merkte, dass ich flüsterte. »Als du das Fady gebrochen hast, in dem du … als Zwilling … geboren wurdest?«
Sie antwortete nicht, schüttelte nur den Kopf.
»Dein Bruder«, wisperte ich, »wo … ist er jetzt?«
»Im Gefängnis«, sagte sie knapp. Dann band sie sich Onja auf den Rücken, nahm den Wäschekorb und kletterte eilig den Felsen hinunter.
Was für ein Tag! Die letzte Glut unserer Kohle leuchtet neben der kleinen Fischerhütte. Du schläfst.
Nachts weckst du mich und schreist, aber jetzt schläfst du. Und die Wäsche liegt auf dem Gras neben den Hütten, ich habe zu spät gewaschen, sie ist noch immer feucht, ich werde sie einsammeln müssen und falten und mit den allerersten Sonnenstrahlen morgen früh wieder ausbreiten, sonst wird der Chef nicht froh sein.
Die anderen fürchten ihn nicht. Sie leben in den Tag hinein. Sie singen und lachen. Wenn etwas zu spät geschieht, geschieht es zu spät, sie beeilen sich selten. Sie sagen nur: Na und?
Natürlich, sie haben ihr Leben auf dieser Insel verbracht, diese Insel ist ein Wunder. Das Grün der Bäume. Der Wald. Der Gesang der wilden Affen. Ich habe auch vor den Affen Angst, es gibt einen, der kommt zum Restaurant, er turnt durch die Bäume wie ein Schattengeist. Die anderen Frauen haben mich ausgelacht.
Dabei gibt es etwas, vor dem auch sie Angst haben, und weißt du, kleine Onja, was das ist? Das bin ich. Ich kann es spüren. Wissen sie, wer ich bin? Was ich getan habe?
Heute habe ich etwas Gutes getan. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jemanden gerettet. Emma.
Sie weiß es nicht. Sie hat keine Ahnung.
Als ich mit dir den Strand entlangging und sie da oben sah, auf dem Felsen, da glaubte ich, mein Herz müsste stehen bleiben. Ihre dunkle Silhouette vor dem blauen Himmel war schön.
Aber ich wusste, dass sie dort nicht stehen durfte.
Ich rannte, mit dir, mit der Wäsche, ich rannte bis dorthin, wo die Felsen beginnen, erst kleine: Kinderfelsen, dann größere, eine ganze Gruppe wie eine Familie, vielleicht waren sie einst unsere Ahnen, versteinert, vielleicht darf man sie deshalb nicht betreten.
Dann hob ich den Kopf, und da sah ich, wie Emma sprang. Ins Meer sprang.
Und ich war mir sicher, sie würde darin sterben. Das war die Rache der Ahnen. Ich wusste, ich durfte nicht weiterklettern, nicht ebenfalls das Fady übertreten, aber ich kletterte, ich musste hinauf, um zu sehen, ob ich ihr nicht doch noch helfen konnte, ich kletterte und weinte zugleich.
Und schließlich stand ich selbst ganz oben, und ich sah Emma in dem unendlichen Blau unter mir schwimmen wie einen Delfin, weiter und weiter hinaus. Und da schwamm noch etwas. Ein Einbaum. Sie schwamm darauf zu. Ein Junge stand aufrecht darin, einer, der nicht fischte und nichts transportierte, einer, der den Einbaum ohne Ziel und Zweck über die Wellen jagte. Ein Vazaha.
Einer wie Emma.
Die Vazahas können alle schwimmen, wie die Fischerkinder. Die Fischerkinder müssen schwimmen, um zu arbeiten. Aber die Vazahas schwimmen nur so, zum Spaß, sie schwimmen an der blauen Oberfläche des tiefen Dunkels und ahnen nicht, welche unerklärlichen Dinge in der Tiefe geschehen, welche Geister dort warten, welche Wahrheiten, welche Tode. Darin sind sie alle wie Kinder: Sie sehen immer nur das Schöne. Niemals hindurch.
Ich sah, wie der Junge den Einbaum querlegte und anhielt und wie Emma sich daran festhielt und mit ihm sprach – und auf einmal war ich mir nicht mehr sicher, dass er ein Vazaha war. Vielleicht war er ein Trugbild. Ein Geist. Einer, der gekommen war, weil Emma das Fady übertreten hatte: um sie weiter und weiter ins Wasser hinauszulocken. Dann drehte er das Boot und paddelte los, Emma konnte sich nicht mehr daran festhalten – und da war ich sicher, er war ein Geist.
Sie würde versuchen, ihm zu folgen. Sie würde ertrinken, da draußen. Sie wäre nicht die erste Vazaha, die auf der Insel ertrank. Immer wieder gibt es Schwimmunfälle: Unvorhersagbare Strömungen, heißt es bei den Behörden. Aber natürlich weiß jeder, woher die Strömungen kommen.
Sie gehören zur Welt der Toten.
Ich nahm all meine Kraft zusammen und bat die Geister, das Leben dort draußen zu verschonen, nur dieses eine, und ich winkte mit beiden Armen – und da drehte sie um, die Schwimmerin in den Wellen. Sie kam zurück. Zum Land. Und zu mir. Sie wusste nicht, dass da draußen ein Tod an ihrer Seite schwamm. Ich kroch bis ganz vorn an die Felskante, konzentrierte mich nur auf Emma und das Wasser und schob mit meinem Willen die Geister fort.
Und da fühlte ich es, Onja, es war, als sprächen die Geister mit mir. Sie wollten ein Leben.
Meines oder ihres.
Ich bat sie, die Entscheidung aufzuschieben.
Emma kam aus dem Wasser und wrang ihr Haar aus, das nicht mehr golden war, sondern dunkel vom Wasser – dunkel wie Blut: Ich dachte an das Blut eines anderen Menschen, und ich schauderte, nur die Geister wissen von diesem Menschen, diesem Blut, nur die Geister wissen, was ich getan habe.
Und dann kletterte Emma zu mir hinauf, das Fischmädchen, das so gut schwimmen konnte, sie war außer Atem, aber sie wusste nicht, wie nahe sie dem Tod gewesen war.
Ich hätte sie am liebsten umarmt. Ich tat es nicht; wir kennen uns nicht. Vielleicht werden wir uns kennenlernen. Vielleicht haben wir eine Chance. Vielleicht geben die Ahnen uns genug Zeit, ehe sie jenes eine Leben einfordern.
An unserem zweiten Tag wanderten wir zum ersten Mal über die Insel.
Es heißt im Reiseführer, man könnte in drei Stunden einmal ganz darum herumgehen.
Wer immer das geschrieben hat, wusste nicht, dass alle Felsspitzen fady sind, und es gibt eine Menge davon: Man kann gar nicht um die Insel herumgehen.
Aber es führt ein kleiner Weg hinter dem Strand am Ufer entlang, ein geheimer Pfad zwischen Hecken und blühenden Büschen, und von dort aus bogen wir irgendwann ins Inselinnere ab.
Da war ein altes Holzschild zu einer »épicerie«: Ein Bretterschuppen, an einem Ende ein Verkaufsfenster, hinter dem sich Kekspackungen und Windeln stapelten.
»Ins Dorf geht es da lang«, sagte der junge Verkäufer und zeigte auf ein kleines Feld.
»Aber da ist kein Weg«, sagte ich.
»Es muss kein Weg da sein, damit man das Ziel erreicht«, sagte er.
Also gingen wir um das Feld herum, und tatsächlich, dahinter gab es wieder einen Pfad. Eine Gruppe Kinder in blauen Schuluniformen kam uns entgegen, sie balancierten auf zwei langen, dünnen Palmenstämmen auf uns zu, die über eine Art Sumpf führten. Von ferne sahen die Kinder sehr adrett aus. Aber als sie näher gekommen waren, sah ich, dass die Kragen der Hemden ausgerissen und die Hosen mit Schnur geflickt waren. Die Kinder sagten alle einzeln »Bonjour«, als sie an uns vorübergingen.
Das letzte drehte sich um und fügte hinzu: »Bonbon?«
Da tat es mir leid, dass ich bei dem kleinen Laden keine Bonbons gekauft hatte.
»Sie haben also eine Schule auf der Insel«, sagte Elise. »Das ist schön.«
Ich stellte mir Fy vor. Als kleines Mädchen, in einer Schuluniform. Wie sie über den Stamm balancierte, zusammen mit ihrem Bruder, der fast genauso aussah wie sie. Und auf einmal war da in meiner Vorstellung noch ein Kind: ein blasses Mädchen mit strähnigem, hellrotem Haar, abstehenden Ohren und Sommersprossen. Es ging hinter Faly, die dünnen Arme ängstlich ausgebreitet, ich sah es straucheln, es würde fallen – da drehte er sich um und hielt das Kind fest. Es sah Faly an und lächelte schüchtern. Und er lächelte zurück.
Ich wollte etwas zu ihm sagen. Etwas darüber, wie sehr sein Name nach »Fady« klang, dem Verbotenen, Verfluchten, was man nicht tun durfte, und dass das doch seltsam war.
»Emma? Träumst du? Wollen wir nicht weitergehen?«
»Doch … doch.« Ich blinzelte, und das Bild war fort, die Palmstämme leer.
Und dann balancierten wir hinüber und wanderten weiter durch all das überschäumende Grün, zwischen Palmen und Papayabäumen, Bananenstauden, blühenden Wandelröschen und winzigen Feldern. Frauen kamen uns entgegen, Körbe oder Taschen auf dem Kopf, manche hatten Babys umgebunden wie Fy.
Aus einem einfachen Bretterschuppen ertönte Gesang, und hinter der offenen Tür wiegten sich die Menschen im Takt und sangen. Der Schuppen war eine Kirche.
»Eigentlich wäre es schön, wenn man an Gott glauben könnte«, sagte ich. »Man könnte einfach darauf vertrauen, dass er sich um alle Probleme kümmert.«
Elise seufzte. »Wir wissen zu viel.«