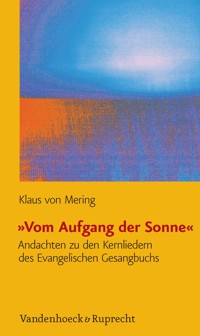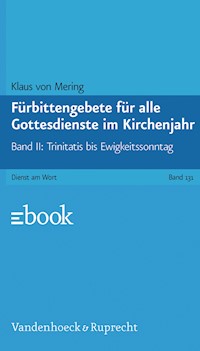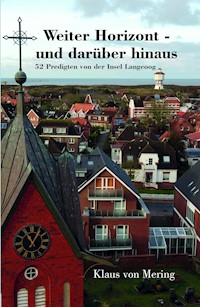
9,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Buch enthält 52 Predigten aus der Langeooger Inselkirche, die jährlich von tausenden von UrlauberInnen aus dem gesamten deutschen Sprachraum ausgesucht wird. Viele davon waren bereits gedruckt oder durch Livesendungen in Funk und Fernsehen veröffentlicht.Von der Möglichkeit, jährlich einige davon zu abonnieren. wurde gern Gebrauch gemacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Klaus von Mering
Weiter Horizont – und darüber hinaus
Unseren Enkelinnen und Enkeln
für einen gesegneten Lebensweg
David
Joni
Caroline
Tobi
Laura
Rebecca
Alex
Julius
Tom
Jimmy
Judith
Joe
Nils
Eddie
Evie
Unserer Tochter Prof. Dr. Sabine von Mering, Boston/USA, unserer Schwiegertochter Dr. Sabine von Mering, Berlin und unserm Schwiegersohn Prof. Dr. Christian von Mering, Zürich danke ich herzlich für ihr fachgerechtes Lektorat und ihre Hilfe bei der Textgestaltung.
Weiter Horizont – und darüber hinaus
52 Predigten von der Insel Langeoog
Klaus von Mering
© 2021 Klaus von Mering
Webseite: https://sites.google.com/site/klaus.vonmering
Umschlaggestaltung: s. Verlag
Illustration: Klaus von Mering
Fotos (Umschlag u. Altarbild): Dr. Klaus Kremer, Langeoog
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg
ISBN (drei verschiedene Ausgaben): 978-3-347-23781-0 (Hardcover), 978-3-347-29119-5 (Paperback), 978-3-347-29120-1 (e-book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1
Verlasst euch, um dran zu bleiben – Jesaja 26, 4
2
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude – Liedpredigt über EG 66
3
Vom Elefanten glauben lernen – Johannes 1, 15–18
4
3000 Jahre alt – und noch brauchbar? – 1. Mose 3, 1–24
5
Ein stammelndes Bekenntnis – Liedpredigt über EG 362 (Ein feste Burg)
6
Schenken, nicht opfern – Markus 10, 35–45
7
Einer für alle… – Johannes 11, 47–53
8
Das riecht nach Verschwendung – Markus 14, 3–9
9
Abendmahl – auf den Zeigefinger achten – Markus 14, 17–26
10
Der Bäckerladen in der Jakobstraße – Markus 14, 17–26
11
Der die Arme ausbreitet – 2. Korinther 5, 14–21
12
Die Engel auf den Grabsteinen sehen lernen! – Matthäus 28, 1–10
13
Ohne Frauen keine Kirche – Markus 16, 1–8
14
Aus Emmaus zurück – Lukas 24, 13–35
15
Mit Zweiflern kann Gott was anfangen – Johannes 20, 19–29
16
Warum machen wir nicht auch Menschen? – 1. Mose 1, 1–2,4
17
Die Gefangenen hörten sie singen – Apostelgeschichte 16, (16–22) 23–34
18
Wes das Herz voll ist… – Ich lobe meinen Gott EG 272 mit neuen Strophen
19
Kann man/muss man beten lernen? – Matthäus 6, 7–13
20
Die Sanduhr verstehen – Kolosser 3, 1–4
21
Der Heilige Geist auf unserer Straße – Apostelgeschichte 2, 1–13
22
Straßensperren gegen den Wind? – Johannes 16, 5–15
23
Der verräterische goldene Finger – Römer 11, 33–36
24
Im Segen kommt Gott an – 4. Mose 6, 22–27
25
Wenn Jesus „Mama“ sagt – Johannes 5, 39–47
26
Mama, wohnt hier der liebe Gott? – Lukas 19, 1–10
27
Tapfer und demütig für das tägliche Brot – 2. Mose 16, 2–3. 11–18
28
Die Wurzeln des Fundamentalismus – Epheser 2, 17–22
29
Getauft oder mit allen Wassern gewaschen? – Epheser 2, 17–22
30
Sein Brot essen, aber sein Lied nicht singen – Johannes 6, 30–35
31
Haben Sie Jesus satt? – Johannes 6, 30–35
32
Ein Geländer für die Freiheit – 1. Korinther 6, 9–14 & 18–20
33
Das Boot ist voll – dank unserer vielen Koffer – Matthäus 7, 24–27
34
Lohnt es sich zu glauben? – Philipper 3, 7–14
35
Das Langeooger Altarbild von Hermann Buß – Matthäus 9, 30
36
Der Judenhass hat tiefe Wurzeln – Römer 9, 1–5.31; 10, 1–4
37
Der falsche Schlüssel – Markus 7, 31–37
38
Mit der Rechten tun, was der Linken einfallt – Matthäus 6, 1–4
39
Gott gibt alles. Mehr nicht – Lukas 18, 28–30
40
Nichts trügerischer als eine offensichtliche Tatsache – 1. Petrus 5, 7
41
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott – Liedpredigt über EG 171
42
Hilfreiche Begleiter in düstere Zukunft – 1. Mose 28, 10–15
43
Der Kürbis und die Fliehkräfte – Matthäus 6, 19–24
44
Wahrheit muss ans Licht – Matthäus 10, 26–33
45
Umkehren – zur Zukunft – Lukas 13, 1–9
46
Wie soll ich dich empfangen – Liedpredigt über EG 11
47
Wo ist der Esel? – eine Fabel – Matthäus 21, 1–9
48
Zwischen Hoffen und Bangen – Jesaja 35, 3–10
49
Weihnachten und das Finanzielle – Lukas 2, 1–15
50
Stille Nacht, heilige Nacht – Liedpredigt über EG 46 in der Originalfassung
51
Die mächtigen Träume der Gewaltlosen – Matthäus 2, 13–23
52
Verlasst euch, um zu bleiben – die zweite – Jesaja 26, 4
Register
Neue geistliche Liedertexte von Klaus von Mering
Biografisches
Vorwort
Die Predigten von der Insel Langeoog sind etwas Besonderes, einfach weil die Menschen besonders sind, für die sie geschrieben wurden.
Sie kommen in großer Zahl in die Inselkirche, nicht weil ein besonderes Datum ist oder sich Ungewöhnliches ereignet hat, sondern weil sie gerade Urlaub haben. Etwa 95 % der Gottesdienstteilnehmer*innen im Jahr kommen vom Festland.
Dass fast jeder Gottesdienst hier aussieht wie anderswo nur am Heiligen Abend, liegt daran, dass Tausenden Urlauber*innen nur etwa 300 Plätze pro Gottesdienst zur Verfügung stehen. Die reichen oft nicht.
Die Menschen kommen mit hohen Erwartungen, weil sie sich noch gern an ihren letzten Besuch hier vor ein oder zwei Jahren erinnern. Manche können sogar einzelne Sätze aus der Predigt damals noch wörtlich zitieren.
Die Erwartungen an den Gottesdienst wurden auf der oft langen Anreise Stück für Stück gesammelt und man sitzt dann meist schon eine Zeitlang vor Gottesdienstbeginn gespannt auf seinem Platz.
Ich weiß beim Predigtschreiben in der Regel nichts über meine Zuhörer*innen am kommenden Sonn- oder Festtag. Eine Woche vorher und nachher sind es ohnehin andere. Außer dem vorgegebenen Bibeltext und dem Termin im Kirchenjahr weiß ich oft nur ungefähr, aus welchem Bundesland die Menschen diesmal kommen.
An einzelne von ihnen erinnere ich mich vielleicht, weil ich mal mit ihnen ein intensives Gespräch hatte, was durch die knappe Zeit der Begegnung sehr schnell „ans Eingemachte ging“.
Mit einer verhältnismäßig großen Zahl hat sich im Laufe der Jahre ein schriftlicher Kontakt entwickelt – anfangs per Brief, später per E-Mail – der aber wegen der vielen Aufgaben im Pfarramt aus Zeitgründen der Tiefe des Geschriebenen nie gerecht werden konnte.
Dieses Buch erscheint auch, um an Erlebtes anzuknüpfen und für Versäumtes um Entschuldigung zu bitten.
Rastede, im Frühjahr 2021
Klaus von Mering
1. Verlasst euch, um dran zu bleiben –
Jesaja 26, 4
Bei mir waren die ersten Assoziationen, die sich bei diesem Bibelwort einstellten, ehrlich gesagt eher negativ. Ich vermisste das Einladende, das mich ermutigt und ermuntert hätte, näher zu treten, meine vagen Aussichten auf die nächste Zukunft hier unterzubringen. Das schien mir alles so klipp und klar – mehr klipp als klar eigentlich – ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen: Da möchte man gern eine Frage stellen, weil man sich nicht so ganz sicher ist; aber der, an den man da gewiesen ist, macht von vornherein den Eindruck, als könne es da überhaupt keine Fragen mehr geben, wenn man richtig aufgepasst hätte. Und diese abweisende Haltung bewirkt, dass einem die Frage im Halse stecken bleibt. Kennen Sie das? Auch im Glauben gibt es ja solche kalte Perfektion. „Verlasst euch stets auf den Herrn, denn Gott der Herr ist ein ewiger Fels!“ – aus! Basta!
Vor Leuten mit felsenfesten Überzeugungen habe ich immer ein bisschen Angst, das kommt mir immer etwas unmenschlich vor. Menschen sind nicht aus Stein, sie sind weich und beweglich. Nur wenn die Totenstarre eintritt, gilt das nicht mehr. Sind felsenfeste Überzeugungen nicht immer mit dem Geruch von Totenstarre behaftet?
Schwindel erschreckt
Überhaupt – das Bild vom Felsen: mich weist es eher zurück. Zum Bergsteigen habe ich nicht das Zeug, in der Höhe wird mir schwindelig. Ist das ein brauchbares Bild für Gott? Ist das nicht gerade das Zerrbild, das ich bekämpfe, gerade weil viele Leute um mich herum so reagieren:
So: „Für die Religion habe ich keine Begabung. Mag ja sein, dass es Menschen gibt, für die das Lebensinhalt ist. Aber ich versteh das nicht. Ich hab dafür keine Antenne!“
Das ist natürlich ein verheerendes Missverständnis. Glauben ist ganz anders: ständig auf der Suche, lebendiges Fragen und Antworten, gemeinsam fröhlich sein. Aber liegt es nicht in der Konsequenz dieses Bildes von Gott als dem ewigen Fels, dieses Missverständnis?
An dieser Stelle meines Nachdenkens stieß ich auf einen Text, von dem ich mich verstanden und angenommen fühlte. Es ist die Meditation eines namhaften Kollegen über eben diese Jahreslosung. Friedrich Karl Barth heißt der Mann. Und er hat seine Meditation überschrieben: „Traurigkeit zu einer Losung“.
Wo überall ich ins Schwimmen gerate:/ weil du nicht mehr weißt, was wirklich ist, / was ist wahr, / was ist gerecht;/ wo unsere Verhältnisse zerbrechen, / sich lügen und betrügen/ und wir so tun, im Ernst, / als ginge nichts anderes / mehr…
Da packt mich/– immer härter – die verlorene Sehnsucht, ich könnte klettern, /den Felsen besteigen. / Ich kann nicht. / Sehend/ die ins Ferne ruhende Aussicht, / von der man sagt, /dass es sie /immer gab und immer geben wird. /Von Ewigkeit zu Ewigkeit. /Ach könnte ich / mich verlassen: / Hebe mich auf.
Friedrich K. Barth In: Der Gemeindebrief 48/14
Am Flutsaum stehen
Für mich ist diese Meditation wie eine Leiter zu dieser steilen, schwer zugänglichen Losung, eine Leiter, deren untere Sprossen da ansetzen, wo ich stehe, hilflos, „traurig“, wie Barth sagt, „ich kann nicht klettern!“ Die nächsten Sprossen führen schon ein Stück darüber hinaus: „wo überall ich ins Schwimmen gerate“, wo scheinbar Verlässliches schwankend wird…
Haben Sie mal unten am Strand gestanden, ganz unten, bei Niedrigwasser, wo der Sand feucht und hart ist, wie ein befestigter Weg, so scheint es jedenfalls. Und dann kommt langsam die Flut, höher, immer höher. Und plötzlich, obwohl mich das Wasser oberflächlich gesehen noch gar nicht erreicht hat, zerrinnt mir die Festigkeit unter der Fußsohle, ich spüre, wie ich den Halt verliere und ahne, dass ich früher oder später hinaus getrieben würde aufs Meer, wenn ich nicht einen Schritt zur Seite mache, landeinwärts. Und dann noch einen.
Ist das nicht ein brauchbares Bild für eine Erfahrung, die wir immer wieder machen? In der Beziehung zu einem Menschen, den wir lieben. Alles scheint fest und stabil – und urplötzlich gerät da etwas ins Rutschen. Oder im Verhältnis der Eltern zu den Kindern: Man meint, alles im Griff zu haben – „meine Kinder sind immun gegen die Verlockungen unserer Konsumgesellschaft, gegen die moralischen Verführer, gegen die Dealer von Glücksersatz und Scheinerfüllungen, mein Kind nicht!“ – und auf einmal stürzt diese Sicherheit wie ein Kartenhaus zusammen. Oder da, wo es um die Grund-Überzeugungen des Lebens geht, um das, was wir glauben, auch da geschieht das doch, seien wir ehrlich, auch da kann einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Gerade die wirklich Großen im Glauben geben davon Zeugnis: Jeremia, der Prophet; Paulus, der Apostel; Augustin, der Kirchenvater; Luther, der Reformator; Bonhoeffer, der Märtyrer. Das Evangelium wäre ja längst zur moralinsauren Sauce verkommen, wenn diese Großen nicht immer wieder ihre Erfahrungen von Anfechtung in die christliche Verkündigung eingebracht hätten.
Aber gewiss: Ebenso richtig ist, dass ich in solchen Erfahrungen ausschaue nach dem Grund, der trägt. „Da packt mich“, sagt Barth, „die verlorene Sehnsucht, ich könnte klettern, den Felsen besteigen.“
Das Wörtchen „verloren“ ist mir in diesem Zusammenhang wichtig, die „verlorene Sehnsucht“. Tatsächlich geht ja auch diese Sehnsucht immer wieder einmal verloren. Dann nämlich, wenn man auch auf dem Sand fest zu stehen meint. Oder wenn das Kitzeln unter den Füßen noch Abenteuer ist, nicht Bedrohung. Ja, es gibt offenbar Zeitgenossen genug, die haben diese Sehnsucht so gründlich verloren, dass sie den Felsen gar nicht mehr vermissen.
Verlorene Sehnsucht
Sind ihnen Anfechtungen bisher erspart geblieben? Möglich. Und wenn ja, bin ich befugt, ihnen welche aufzuschwatzen? Hat nicht die Kirche oft genug den Fehler gemacht, dem Menschen in seinem Glück mit dem Unglück zu drohen und sich damit den schlechten Ruf des Spielverderbers eingehandelt? Soll ich also diese Zeitgenossen einfach in Ruhe lassen und mich lediglich für den Fall zur Verfügung halten, dass sie mich brauchen? Fragen, die gewiss nicht nur einen Pastor bewegen.
Manchmal freilich bin ich mir ziemlich sicher: auch dieser Mensch hat anfechtende Erfahrungen gemacht. Aber er lässt sie nicht an sich heran, er hat sich dagegen ein dickes Fell zugelegt. Die gleichen Ereignisse, die mich zutiefst aufwühlen, quittiert er mit einem Achselzucken.
Dies kann ich dann freilich nicht als unterschiedliche Veranlagung akzeptieren; denn ich sehe voraus, dass er darüber kaputt geht früher oder später! Diese Stumpfheit breitet sich ja aus wie ein Krebsgeschwür. Am Ende nimmt dieser Mensch nichts mehr ernst, nicht einmal mehr sich selbst.
Da fühle ich mich dann schon genötigt, Einspruch einzulegen und nach der „verlorenen Sehnsucht“ zu fragen. „Die verlorene Sehnsucht, ich könnte klettern, den Felsen besteigen. – Ich kann nicht!“
Dies scheint mir der heimliche Schwerpunkt unseres Textes zu sein, der Drehpunkt der Leiter sozusagen: Ich kann nicht! Alles andere wäre Werkgerechtigkeit, liebe Gemeinde, Selbstrechtfertigung, Selbsterlösung, also genau das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Nein, ich kann wirklich nicht vom Sand auf den Felsen hinüberspringen. Wenn ich es könnte, brauchte ich das Evangelium, die gute Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus nicht mehr. Wir könnten das Kruzifix abräumen und einen Fernsehapparat an die Stelle setzen als Symbol für Selbsterlösung.
Ich kann nicht
Verlasst euch stets auf den Herrn – das ist jedenfalls keine Möglichkeit, die in mir eingebaut ist, auf die ich jederzeit zurückgreifen könnte. Denn unabdingbare Voraussetzung für ein solches „Verlassen“, Vertrauen ist, dass ich mich selbst „verlasse“, dass ich aus mir auswandere, aus dem, was ich von Haus aus bin, dass ich aufbreche gerade aus dem, was ich zu meiner Sicherung aufgebaut habe und gerade den Erfahrungen recht gebe, die mich unsicher machen.
Das Wort Aussteiger ist noch jung in unserer Umgangssprache. Und es hat – für die meisten Erwachsenen jedenfalls – einen negativen Klang. Vielleicht weniger, weil wir kein Verständnis aufbrächten für das Aussteigen der Aussteiger, eher wohl darum, weil man das Gefühl hat, die Aussteiger – jedenfalls die meisten – stiegen letztlich gar nicht richtig aus aus unseren angestammten Sicherungen, sie verweigerten nur von einem Tag auf den andern ihre Mitarbeit daran. Wie auch immer, die Mehrheit greift doch lieber auf den bewährten Rhythmus von Lohn und Leistung zurück. Dabei ist nicht zu übersehen, dass dieser Rhythmus wirklich nicht mehr zuverlässig funktioniert. 1,7 Mill. Arbeitslose – bei uns, anderswo sind’s viel mehr – belegen das. Und der Eifer, mit dem allenthalben nach Schrittmachern für das kranke Herz unserer Wirtschaftsordnung gesucht wird, ist ja enorm. Freilich, wer da andererseits einfach von schicksalhafter Krise des kapitalistischen Systems redet, der übersieht doch wohl geflissentlich die grassierenden Pleiten in den sozialistischen Ländern. Nein, dies ist unbestreitbar eine Krise unserer wissenschaftlichtechnischen Lebensauffassung überhaupt. So gesehen würde ich bei den Aussteigern immer noch mehr Ansatzpunkte für die Wahrheit finden als bei den Aufsteigern, auch den religiösen Aufsteigern, von den Trittbrettfahrern nicht zu reden.
Aussteiger und Aufsteiger
Aber: Es bleibt doch, „mich verlassen“ ist keine Möglichkeit die mir zu Gebote steht. Nicht zufällig genügt Israel in Ägypten nicht der Leidensdruck, um aufzubrechen: Gott muss ihnen Mose schicken, der sie im Geist Gottes führt. Und Mose selbst braucht Gottes Führung durch Feuer- und Wolkensäule, um diesen Dienst ausfüllen zu können. Nicht umsonst begnügt sich Jesus in den Evangelien nicht mit dem Ruf des Täufers Johannes: Kehrt um! Sondern er sagt: Folge mir nach. Wir können uns nicht aus eigener Kraft verlassen.
Deshalb schließt Barth seine Meditation mit dem Gebetsruf: „Ach, könnte ich mich verlassen: Hebe mich auf“. Hebe mich auf – das entspricht in seiner Doppelsinnigkeit dem „verlasst euch!“ Gott muss die Energien, die ich zu meiner Selbsterlösung aufwende, aufheben; nur so kann er mich aufheben auf den Felsen. Solange ich in dieser Welt lebe, geht es mir wie dem Ertrinkenden: Je heftiger ich um mich schlage, um nicht unterzugehen, desto zielstrebiger betreibe ich meinen Untergang. Der Retter muss meine Bewegungen zuerst „aufheben“, ehe er mich aufheben kann. Ist das, aufs neue Jahr gesehen, eine Aufforderung zur Passivität, zum Hände in den Schoß legen, weil doch alles die Sache des lieben Gottes ist? Ich denke, genau umgekehrt: Wenn ich meine Rettung nicht mehr besorgen muss, weil der schon bei mir ist, der mich aufheben und auf den sicheren Felsen tragen kann, dann kann ich um so unbefangener aktiv werden, um andere und anderes aus der Brandung zu fischen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt… vielleicht ist auch dieses Bild schon wieder missverständlich, weil wir nur noch in Dimensionen von Supertankern und Luxuslinern denken können – selbst unsere Langeoog-Fähren gleiten ja normalerweise dahin, als lägen sie nicht auf dem Wasser, sondern auf Schienen. Aber nein, ein Schiff schwimmt. Und wehe ihm, es läuft auf einen Felsen! Die schwimmende Gemeinde – das ist das Verlässlichste, was uns Menschen zugänglich ist in dieser Zeit. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Denn tiefer als der Rumpf dieses Schiffes, ja tiefer als das Meer, in dem es schwimmt, reicht der Felsen, der alles trägt. Darum: Verlasst euch stets auf den Herrn; denn Gott der Herr ist ein ewiger Fels. Amen.
gehalten am Neujahrsmorgen, dem 1.1.1982 in der Inselkirche zu Langeoog
Meine müden Hände und mein träges Herz bringe ich vor dich. //: Wandle sie in Liebe, Herr, erbarme dich! : //
Meinen kurzen Atem, meine Ungeduld bringe ich vor dich. //: Wandle sie in Hoffnung, Herr, erbarme dich! ://
Meine tauben Ohren, meine Einsamkeit bringe ich vor dich. //: Wandle sie in Staunen, Herr, erbarme dich! ://
Mein ersticktes Schweigen, meinen stummen Zorn bringe ich vor dich. //: Wandle ihn in Worte, Herr, erbarme dich! : //
Mein besorgtes Kreisen nur um Geld und Gut bringe ich vor dich. //: Wandle es in Glaube, Herr, erbarme dich! ://
Neue Strophen von Klaus von Mering zu dem Lied „Meine engen Grenzen“ von Eugen Eckert, EG HN 584
Hinweis: Wem die Melodie nicht geläufig ist, kann jederzeit ein Notenblatt bei mir anfordern ([email protected] oder Tel. 04402-695958).
Die Originalversion des Liedes gesungen von Eugen Eckert ist auch im Internet verfügbar (siehe https://bit.ly/meineengengrenzen). Die neuen Strophen sind nach dieser Melodie zu singen.
2. „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“ –
Liedpredigt über EG 66
Ein Triumphlied über den gekommenen Heiland der Welt, so wörtlich, wollte Johann Ludwig Konrad Allendorf mit diesem Lied schreiben. Und ich denke, es ist immer noch etwas von dieser triumphierenden Freude, die sich uns beim Singen dieses Liedes mitteilt, weshalb es sich bei alt und jung auch großer Beliebtheit erfreut. Im neuen evangelischen Gesangbuch (EG) ist es deshalb das Eingangslied für diese Kirchenjahreszeit geworden. Das ist ja ein Gliederungsprinzip dieses Gesangbuchs, dass immer an die erste Stelle ein Lied gesetzt wird, was populär ist und was gleichzeitig typisch ist für diese Kirchenjahreszeit, während alle übrigen Lieder dann in dem jeweiligen Kapitel sich nach der Entstehungszeit einreihen.
Die Frage ist natürlich: Wie teilt sich diese triumphierende Freude dieses Liedes mit? Und da gibt es nun nicht wenige, die sagen Ja, das ist nur diese fröhlich hüpfende, um nicht zu sagen trällernde Melodie, die das macht. Tatsächlich gibt es eine lange Tradition der Kritik an diesem Lied, der Kritik im Wesentlichen aus dem Bereich der Orthodoxie, vom 17. Jahrhundert angefangen bis in unsere Zeit. Tenor dieser Kritik ist: Die Melodie dient nicht dem Inhalt, sie ist mehr oder weniger zufällig. Ich will solche Kritik nicht einfach kurzerhand beiseite schieben. Es gibt ja zweifellos Grenzen im Transportieren von Glaubensaussagen in Liedern. Grenzen des guten Geschmacks beispielsweise, oder auch die Gefahr, dass die inhaltlichen Aussagen überlagert werden durch die Melodie, durch ihren Rhythmus oder ihre seichten Harmonien. Manche neue Lieder setzen z. B. auf eingängige Klänge, aber im Text geben sie sich keine Mühe, uns den Glauben verständlich zu machen.
Ich möchte verstehen
Aber umgekehrt kann auch die Wortwahl uns befremden. Wir empfinden das heute vor allem bei Liedern aus der pietistischen Tradition, weil sie z. B. eine schwärmerische Jesusliebe weitertragen, die uns – vielleicht gerade uns Norddeutsche – eher abstößt. So viel Reden von Gefühlen ist uns eher peinlich. Wir müssen also immer wieder kritisch prüfen: Stehen Inhalt und Melodie in einem angemessenen Verhältnis zueinander. Aber wir müssen auch das Wort von Paulus im Ohr haben: Wir haben diesen Schatz nur in irdenen Gefäßen. Das heißt es gibt auch eine sachgemäße Spannung zwischen dem, was transportiert wird und dem wie das geschieht. Ob einer auf einem schlichten Leiterwagen mit Heu sitzt oder aus einem auf Hochglanz polierten teuren Straßenkreuzer aussteigt, sagt noch nichts über seinen Wert als Mitmensch.
Paulus bezieht diese Formulierung ‚Schatz in irdenen Gefäßen‘ zunächst auf seine eigene Person. Er hat offensichtlich keine brillante Art gehabt, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Man weiß nicht genau, was es war. Manche meinen, er habe schwer gestottert, andere, er sei vielleicht Epileptiker gewesen. Wir erfahren jedenfalls aus den Korintherbriefen, dass er in der dortigen Gemeinde von manchen sehr verächtlich behandelt wurde. Und dabei hat man die Äußerlichkeit seiner Person auf den Inhalt seiner Botschaft übertragen. Während er das Kreuz Jesu in den Mittelpunkt des Evangeliums stellte, schwärmten andere Prediger von religiösen Erlebnissen wie dem Zungenreden und redeten ihren Hörern ein, mit der Auferstehung habe sich das Thema Passion erledigt. Die Sehnsucht nach begeisternden Erlebnissen und sicherer Geborgenheit verführt dann dazu, die Brücken zu Kranken und Trauernden abzubrechen.
Das Langeooger Altarbild
Mir wird die Gefahr solcher Missverständnisse immer wieder deutlich, wenn Menschen sich kritisch zu unserem Altarbild äußern. Häufig klingt dabei eine traditionelle Vorstellungs- und Sprachtradition unserer Kirche an. Dann hört man z. B.: „Da vorne im Fluchtpunkt der Kirche, da müsste doch etwas zu sehen sein, was ganz eindeutig Jesus als unsern Erlöser zeigt, zum Beispiel als den guten Hirten, der uns schützt und uns die Angst nimmt.“ Und sie merken gar nicht, dass solche schlichten Bilder und Erwartungen die Wirklichkeit unserer Welt verstellen und verfälschen können. Hermann Buß, der Maler unseres Altarbildes, hat nicht zufällig das alte, tote Schiff und davor das tragende Schiffsdeck in seinem Bild zusammengebracht. Und durch die als Kreuz angedeutete Mastspitze hat er ganz behutsam an den Gekreuzigten, der uns trägt, erinnert. Ich denke, solche Bilder sind uns nötig. Wer in die Kirche hineinkommt, kann nicht sagen: Ach, kenn ich, Jesus. Sondern er sieht das Bild und stutzt. (siehe auch Kapitel 35).
Was transportiert den christlichen Glauben wirklich zu den Menschen, vor allem zu denen, die damit Schwierigkeiten haben oder noch gar nichts davon gehört haben? Ich denke, diese Frage muss uns beschäftigen. Manchmal, das empfinden wir ja, manchmal sind Worte dem Inhalt ganz besonders angemessen. Manchmal können Liedtexte dem, was sie transportieren wollen so angemessen sein, dass dann die Melodie sich auf das Dienen dieses Transportierens beschränken kann. Ich kenne solche Lieder, die mir lieb sind. Oft sind es ganz traditionelle, ganz alte Lieder aus dem Gesangbuch. Aber das geht eben nicht immer. Manchmal ist der Inhalt des Glaubens auch so sperrig, dass die Melodie mithelfen muss, die Sache in Fahrt zu bringen und herüberzutragen in meine welterfahrene Gegenwart. Natürlich bleibt die Einheit von beidem das höchste Ziel, aber ich denke es ist nicht nur ein besonderes Kunststück, sie zu erreichen, sondern sie ist auch immer nur situativ, immer nur in einzelnen Gelegenheiten und Lebenssituationen als Einheit erreichbar.
Die Freude dieses Liedes teilt sich uns, so empfinde ich es jedenfalls, nicht nur durch ihre Melodie mit, sondern auch durch ihren Text. In der ersten Strophe wird das zusammengebracht, was nach unserer alltäglichen Erfahrung eigentlich ein Gegensatz ist: Anfang und Ende, Schöpfer und Menschen, Himmel und Erde. Eigentlich geht das nicht zusammen, sagt unser Verstand. Aber manchmal, im Moment großer Freude, tut es das eben doch. Da passt alles zusammen. Freude lebt von der Harmonie, dass alles seinen richtigen Platz hat. Freude blendet das Dunkle ja nicht aus, wenn sie nicht blasser Optimismus ist. Sie weist nur jedem seinen Platz zu, in dem auch das Dunkle sein Recht hat. Aber das Helle wird davon nicht überschattet und zugedeckt.
Das Dunkle stehen lassen
Wenn uns Schwermut befällt, dann ist die Harmonie gestört, dann sehen wir nur Bruchstücke, Teile der Wirklichkeit sind ausblendet. Dann hat das Helle und das Dunkle seinen ihm zugehörigen Platz verloren. Ähnliches passiert, wenn Menschen von Ideologie besetzt sind. Dann hat sich irgendetwas zu einer scheinbar allmächtigen Wahrheit aufgeschwungen. In der Glaubensfreude findet dagegen alles seinen Platz. Das Traurige wie das Helle. Und dieses Allumgreifende, diese Harmonie von allem, das ist es, was die Freude letztlich trägt.
A und O – das kommt aus dem griechischen Alphabet, da ist das zweite O, das lange, geschlossene O der letzte Buchstabe wie bei uns das Z. A und O heißt es in der Strophe, Gottheit und Menschheit, Himmel und Erde, Schöpfer und Menschen, Christen und Heiden.
Die Erbauer dieser unserer Inselkirche haben am Ende des 19. Jahrhunderts etwas von dieser triumphierenden Freude in diese Kirche einzubauen versucht, indem sie hier vorne diesen Triumphbogen vor den Altar gebaut haben. Das war damals die Zeit der Neugotik. Kurz vor der Jahrhundertwende kam schon der Übergang zum Jugendstil dazu. Das heißt, die Ursachen für unsere Freude sind auf diesem Bogen zu Ornamenten verblasst, zu symbolischen Schmuck. Das einzig Konkrete, was sich die Erbauer nicht haben nehmen lassen, steht ganz oben in der Spitze: das kleine Bild des Engels Michael, der den Drachen tötet. Das war das Siegelzeichen des Klosters Loccum, das Jahrzehnte vorher hier auf der Insel das Hospiz erbaut hatte. Da sollte es auch solchen Menschen möglich sein, hier Urlaub zu machen, die nicht über das dicke Portemonnaie verfügten. Und damit diese Menschen hier auch zum Gottesdienst gehen konnten, hat das Kloster dann diese Kirche erbaut und mehr oder weniger der Gemeinde geschenkt.
Triumphbogen
Unser Lied arbeitet in seinem Triumphbogen nicht nur mit schönen Ornamenten, sondern arbeitet mit einer Fülle von biblischen Anspielungen. Und ich denke, auch dieses hat zu seiner Popularität beigetragen, weil einzelne Strophen an viele biblische Geschichten erinnern: Die zweite: „Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Da springen die Bande“. Immer wieder werden im Evangelium Geschichten erzählt, in denen Jesus Menschen begegnet, die buchstäblich zu springen anfangen nachdem sie ihn getroffen haben und durch ihn frei geworden sind von allen möglichen Zwängen, von Krankheit und Unterdrückung und dämonischer Besetzung. Das wird im dritten Vers nochmal herausgestellt: Die Befreiung von dämonischer Macht. Oder in der vierten Strophe: „Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens“. Die Geschichten, die sich mit der Überwindung des Todes beschäftigen, und letzten Endes die Ostergeschichten des neuen Testaments. Oder die fünfte: „Ein Opfer für Sünden“. Der ganze Komplex der Passionsgeschichte spiegelt sich in dieser Strophe. Oder die sechste: „Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden“. Wir denken zum Beispiel an die schöne, tiefsinnige Geschichte, wie Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet, und mit ihr anhand dieser Begegnung über lebendiges Wasser meditiert (Johannes 4, 1ff.). Etwas, was dann ja hinüberführt in die Praxis der Taufe in der Kirche, dass wir wirklich baden können, wie das die Strophe sagt, baden im Wasser des Heils.
Ursprünglich hatte das Lied von Johann Ludwig Konrad Allendorf dreiundzwanzig Strophen. Allendorf wollte nämlich, und darin war er durchaus ein Kind seiner Zeit, das A und O, was er in der ersten Strophe andeutet, in den Strophen durchdeklinieren. Allendorf war Pastorensohn aus Marburg und hat seine wesentliche theologische Prägung bei August Hermann Francke in Halle erfahren, dem großen lutherischen Pietisten. Und das hat seine Sprache für sein ganzes Leben geprägt.
Künstlerisch gestaltet
Diese Absicht, das Lied auf diese Weise durch das Alphabet zu gliedern mit den 23 Strophen, das können jetzt nur noch Eingeweihte entdecken. Denn eine ganze Reihe von Strophen gingen im Laufe der Zeit verloren. Vollständig ist dagegen die Reihe noch in Paul Gerhards „Befiel du deine Wege“, EG 361, da können Sie das ja noch nachvollziehen. Paul Gerhard hat das Bibelwort Befiehl dem Herren deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen – dieses Wort aus Psalm 37, 5 hat er genommen und hat jede Strophe seines Liedes mit einem Wort aus Psalm 37, 5 beginnen lassen. Da ist das noch nachvollziehbar: Befiehl du deine Wege – dem Herren musst du trauen – dein ew’ge Treu und Gnade – Weg hast du allerwegen usw. Allendorf versuchte schon einige Jahre früher etwas Ähnliches, indem er jeder Strophe einen Christustitel in der Abfolge des Alphabets in den Mittelpunkt stellte. Was bei uns nach der Kürzung noch vorhanden ist, lässt sich finden – wenn man es weiß.
In der jetzt zweiten Strophe ist der Dichter beim D – und spricht von Jesus als „der Durchbrecher“, in der dritten Strophe E – „der Erlöser“, in der vierten das F, der „Fürst des Lebens“. Dann fehlen eine ganze Reihe von Strophen. In der fünften das K, „der König der Ehren“, und so weiter, schauen Sie mal selbst.
Die neunte Strophe ist wahrscheinlich von denen, die das Lied gekürzt haben, zur letzten bestimmt worden, weil sie vom Vollenden redet und das Wort Amen enthält. Vermutlich ist sie mal die G Strophe gewesen – „das Gnadenpanier“ steht dort als Stichwort im Mittelpunkt. Zuflucht war vermutlich das Stichwort für die dreiundzwanzigste Strophe. Aber die ist, wie manche andere, inzwischen verloren gegangen.
Uns erscheint diese Stichwortsammlung vielleicht ein bisschen als Spielerei. Aber genau dieses entsprach damals dem Bildungsideal der bürgerlichen Mittelschicht und Allendorf war jemand, der sich in dem damaligen Bildungsmilieu bewegte und auskannte. Er ist die meiste Zeit seines Lebens Hofprediger gewesen an verschiedenen Grafen- und Fürstenhöfen. Das Lied erschien erstmals 1736, also 17 Jahre vor dem Lied von Paul Gerhard, und die Sammlung hieß „Einige ganz neue Lieder zum Lobe des dreieinigen Gottes und zur gewünschten, reichen Erbauung vieler Menschen“. Deutlich erkennbar ist die Sprache des Pietismus. Aber mit dieser Überschrift seiner Sammlung wirft Allendorf ja auch die immer noch aktuelle Frage auf nach dem rechten Verhältnis von modisch und zeitgemäß.
Sprache ändert sich ständig
Dem will auch diese Gliederung dienen. Unser christliches Bekenntnis, unsere Aussagen des Glaubens müssen ja immer aufs Neue Zeitansage sein und gleichzeitig die Überlieferung nicht vergessen. Um Gottes Willen und um der Menschen Willen. Um Gottes Willen, weil Gott ein Gott ist, der mitgeht, und der nicht irgendwo ganz hinten am Anfang der Weltgeschichte sitzt und Däumchen dreht. Und um der Menschen Willen, weil wir unser Gehör und unsere Sprache an dem erlernen, wie um uns herum gesprochen wird. In diese Sprache muss unser Glaube immer wieder neu übersetzt werden.
Wir kennen diese Diskussion aus vielen Gesprächen, auch Streitgesprächen. Ich denke an Rudolf Bultmanns Programm der Entmythologisierung, das für viele ein rotes Tuch war. Und ich denke an manche Kritik an neuen geistlichen Liedern heute. Wir können solche Streitgespräche nicht vermeiden, wenn wir mit Allendorf darauf aus sind, den Glauben in die Sprache unserer Zeit zu übersetzen. Singen wir also sein Lied und lassen wir uns ermuntern und ermutigen, immer wieder Neues zu wagen. Wir müssen mit der Zeit gehen, hat ein kluger jüdischer Dichter gesagt, oder wir gehen mit der Zeit. Amen.
gehalten am 2.1.2000, dem 1. Sonntag nach Weihnachten, in der Inselkirche zu Langeoog
Hinweis: Inzwischen hat die Evangelische Kirche in Deutschland 33 Lieder aus dem Gesangbuch zu „Kernliedern“ erklärt und die Gemeinden aufgefordert, diese vorrangig zu bedenken, damit ein Mindestbestand von Liedern in der Kirche erhalten bleibt. Zu diesen 33 Chorälen habe ich Liedpredigten verfasst und 2013 in einem Buch veröffentlicht. Titel: „Vom Aufgang der Sonne“, Göttingen 2013, ISBN 978-3-525-62006-9 und als ebook 978-3-647-6006-0
Jesus ist geboren
Refrain:
//: Jesus ist geboren in Bethlehem und überall.
Das Wunder, das uns menschlich macht, beginnt im armen Stall. ://
Nur Kanzelseite:
2. Das Kind wird euch ganz nahe sein in eurer Alltagswelt; / denn Kinder haben, was ihr schätzt, um kargen Lohn erstellt.
Refrain immer alle: Jesus ist geboren…
Nur Lesepultseite:
3. Das Kind wird euch begleiten: ein Freund, der weiß, was trennt, / der alle eure Ängste sieht und sie beim Namen nennt.
Nur Empore:
4. Ein Mann, der Armen helfen wird, der Armut auf sich nimmt, / ein Mann, der Reiche stören wird, der aufdeckt, was nicht stimmt.
Nur Frauen:
5. Die Nacht im Stall ist Not und Angst, kein freundliches Idyll. /
Er kommt zu dir in dunkler Haut und bittet um Asyl.
Nur Männer:
6. Er stirbt am Kreuz und lebt für uns, enttäuscht dein Bild vom Glück. / Bring in den Stall, was dich besitzt, und nimm von dort zurück.
Nur Lesepultseite:
7. Er bricht sich dir und wird durch dich zum Brot für alle Welt. / Als Keim des Friedens hat sich Gott ein Flüchtlingskind erwählt.
Text: Friedr. Karl Barth/Peter Horst (Str. 2, 5–7: Klaus von Mering), Melodie: Fritz Baltruweit
Hinweis: Wem die Melodie nicht geläufig ist, kann jederzeit ein Notenblatt bei mir anfordern ([email protected] Tel. 04402-695958).
3. Vom Elefanten glauben lernen –
Johannes 1, 15–18
In einem Ort, wo nur Blinde wohnten, so erzählt ein Märchen, erschien eines Tages ein Mensch mit einem Elefanten. Da die blinden Einwohner nur immer von Elefanten gehört, sie aber nie betastet, geschweige denn gesehen hatten, baten sie den Fremden, den Elefanten mit ihren Händen berühren zu dürfen. Der Fremde erlaubte es ihnen, und alsbald machten sich die Ortsbewohner mit ihren Händen an den Elefanten, erst vorsichtig tastend, dann immer selbstsicherer zugreifend. Und mit ihren Händen nahmen sie nun auf, was ein Elefant ist. Des Abends beim Feuer vor den Hütten berichteten sie von ihren Erlebnissen, erzählten von dem, was sie „begriffen“ hatten. Der eine, der an den Rüssel des Elefanten geraten war, berichtete von dem Elefanten als einem schlangenähnlichen Tier. Ein anderer sah in dem Elefanten ein großes rundes Lebewesen – er hatte ein Ohr betastet. Ein dritter, der die Stoßzähne ergriffen hatte, meinte, ein Elefant sei ein sehr hartes, längliches Gebilde. Alsbald gerieten die Blinden untereinander in Streit darüber, wer wohl den Elefanten richtig begriffen habe. Den Elefantenführer zu befragen war nicht mehr möglich. Er hatte seinen Weg fortgesetzt. (nach: Pastoralblätter 121, S. 17 Hans-Helmar Auel)
Dies Märchen kann uns helfen, ein Problem unseres Glaubens besser zu verstehen: „Niemand hat Gott jemals gesehen“, sagt unser Text. Da geht es uns wie den blinden Dorfbewohnern mit ihrem Elefanten. Wirklich? Hatten wir, wie sie, Gelegenheit, ihm zu begegnen, ihn zu erfahren, ihn wenigstens ein Stück weit zu begreifen?
Mancher von uns wird hier überzeugt und überzeugend „ja“ sagen können. Er/sie hat keinen Zweifel, dass ihm Gott in seinem Leben begegnet ist, einmal, mehrmals, immer wieder. Wer das von sich sagen kann, der möge aus dem Märchen die Lehre ziehen: Ich habe in jedem Fall nur etwas von Gott erfahren, eine Seite, eine Zuwendung. So wie die Blinden in jenem Dorf den Rüssel begriffen haben. Oder den Stoßzahn. Oder das Ohr. Hören wir also auf, uns unsere Gotteserfahrungen rechthaberisch um die Ohren zu schlagen oder mit selbsterdachten Maßeinheiten zu operieren, die dem einen einen großen und tiefen Glauben bescheinigen, und dem andern nur einen kleinen oberflächlichen.
„Das Gesetz ist durch Mose gegeben“, sagt unser Text! Um Rangunterschiede, Leistungsunterschiede festzustellen, dafür brauchen wir Jesus nicht. Das können andere auch, nein besser. Und wir bekommen es darum prompt von ihnen zurück.
Immer wieder höre ich das, wenn ich Besuche mache: „Wir haben ganz nette Gäste, Herr Pastor. Die gehen auch jeden Sonntag zur Kirche, wenn sie auf Langeoog sind!“ Gemeint ist damit offenbar zweierlei: Zum einen ein Kompliment für uns, die wir „Kirche machen“. So – das muss gut sein, was ihr da macht, wenn ausgerechnet unsere netten Gäste da gerne hingehen. Zum andern ist es wohl auch eine Art Typenbeschreibung:
Unsere Gäste gehören zu der Sorte Menschen, die die Eigenschaft haben, gerne in die Kirche zu gehen. Beneidenswert? Merkwürdig? Versteh ich nicht so ganz! Wer weiß!
Das kommt dabei heraus, wenn wir Rangunterschiede machen. Wenn wir sagen, der Rüssel vom Elefanten ist wichtiger als der Schwanz. Kirche als Verein – wie Jäger, Amateurfunker oder Briefmarkensammler. Nein, hier geht es um die Wahrheit, sagt unser Text. Und Wahrheit ist unteilbar. Richtigkeit kann man teilen, in 1+1 oder 2 mal 2. Wahrheit ist unteilbar. Es gibt nicht eine Wahrheit für Jäger und eine für Amateurfunker und eine dritte für Christen. Dass wir Menschen sind, die dem Sinn ihres Lebens auf der Spur sind oder die der Gleichgültigkeit verfallen, die einander helfen, aufbauen, trösten oder die sich und andere zerstören, quälen, im Stich lassen; die eine zeitlich begrenzte Chance haben, das Leben zu meistern und die es dann lernen müssen, diese Leihgabe wieder zurückzugeben – das alles gilt für jeden von uns, nicht nur für ein paar Fromme.
Die Wahrheit ist unteilbar. Deshalb können wir als Kirche auch auf unsern öffentlichen Anspruch nicht verzichten: auf alle 1300 evangelischen Gemeindeglieder auf Langeoog. Aber auch auf all die, die meinen, sich dem Anspruch der Wahrheit durch den Austritt aus der Kirche entzogen zu haben. Sie mögen etwas anderes für die Wahrheit halten. Darüber können wir reden. Aber wie Pilatus achselzuckend zu sagen: Was ist Wahrheit? – das geht nicht, das ist Selbstmord auf Raten: des einzelnen wie der Gemeinschaft. Weil Gott keinen streicht von seiner Liste, deshalb können wir auch keinen streichen, können wir nicht aufhören zu mahnen und zu werben. Kirche ist missionarische Kirche oder sie ist keine Kirche mehr.
Freilich, das gilt auch umgekehrt, und hier sind jetzt vor allem die gefragt, die vorhin bei dem Märchen vom Elefanten gedacht haben: Ja, wenn mir Gott einmal so begegnen würde, so handgreiflich, so unbestreitbar – dann wäre Glauben für mich kein Problem. Für euch lautet die Lehre aus diesem Märchen: Habt den Mut, das, was ihr begriffen habt, als ein Stück von Gottes Wirklichkeit anzuerkennen! Lasst euch nicht verleiten zu denken: Gott – das müsste etwas viel Gewaltigeres sein als ich bisher erlebt habe, eindrucksvoller, eindeutiger, umwerfender.
Wer in der Bibel liest, kann immer wieder feststellen: Die Menschen, die da Gott so nahe waren, dass sie mit ihm geredet haben wie mit einem Freund, diese Menschen blieben in ihrem weiteren Leben nicht verschont von Zweifeln und ungelösten Fragen und wankender Hoffnung. Denken wir an Abraham oder Mose oder Paulus oder Petrus! Und auch das Umgekehrte liest man in der Bibel: Die dem Glauben begegneten, taten das meist nicht in erschütternden Erlebnissen, die durch nichts Irdisches zu erklären waren. Sondern sie wagten es, eine Erfahrung als Erfahrung Gottes anzuerkennen: dass sie gesund geworden waren wie der dankbare Samariter (Lukas 17, 11–19)! Dass sie ernst genommen wurden, obwohl sie nichts Besonderes geleistet hatten wie der Zöllner Zachäus (Lukas 19, 1ff.), dass es ihnen gut ging, viel besser, als sie verdienten, wie Josef in Ägypten (1. Mose 37ff.), dass sie Mut zum Leben fanden mitten in Trauer und Einsamkeit wie Hiob – diese alltäglichen Dinge wagten sie als Erfahrung Gottes anzuerkennen. Und das half ihnen zum Glauben. So wie die Blinden in jenem Dorf, die ein Stück Rüssel oder Stoßzahn betastet hatten, es wagten zu sagen: Ich habe einen Elefanten betastet. Und sich nicht von den Neunmalklugen irre machen ließen, die behaupten: Das kann gar nicht sein. Ein Elefant – der ist viel größer, den kann man gar nicht in die Hand nehmen. Der hätte euch umgeworfen, vielleicht erdrückt oder hoch in die Luft gehoben. Irgendetwas ganz und gar Unvergessliches jedenfalls! Nein, jedes Stück Lebenserfahrung kann ein Stück Gotteserfahrung werden.
Erfahren, nicht begreifen
Ich bin jetzt allerdings auf den Einwand gefasst: Und warum muss es das? Genügt es nicht, eine menschliche Erfahrung als menschliche Erfahrung ernstzunehmen. Warum muss da von Gott die Rede sein!?
Wir sollten es uns mit diesem Einwand nicht zu leicht machen. So mancher, der ihn vorbringt, lebt ernsthafter als sein Nachbar, der so wortreich fromme Sprüche klopft. Nein, wir müssen in der Welt leben, utsi deus non daretur, wie es die großen Denker des Mittelalters formulierten: „als ob es Gott nicht gäbe“. So entspricht es dem Auftrag Gottes: „Macht euch die Erde untertan und herrschet über sie!“ Eine Gleichung mit zwei Unbekannten hat für den Christen wie für den Nichtchristen zwei Unbekannte. Gottes Hilfe ist in der Mathematik kein Lösungsfaktor. Erst wenn wir das anerkennen, wird der Weg frei, für den Glauben: Mitten in unserm Wirken in dieser Welt – und da gilt: utsi deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe – sind wir von dem Vertrauen getragen, dass es ihn gibt! Und dieses Vertrauen verändert uns. Das spürt auch der Ungläubige. Er mag es nicht mitvollziehen können. Aber wir dürfen ihn einladen, darauf zu hoffen.
Nicht wahr, die Geschichte mit dem Elefanten könnte sich ja auch so abgespielt haben, dass bei seinem Eintreffen im Dorf sich ein gutes Dutzend um ihn drängten und seine Gegenwart genossen. Und die andern, die in der zweiten und dritten Reihe standen, die kamen gar nicht dran. Wehe uns, wenn wir so mit Gott umgingen in unserm Leben.
Denkbar wäre freilich auch das andere, dass sich die Dorfbewohner gesagt hätten: Ein Elefant kommt. Ja, ich erinnere mich, davon haben unsere Alten öfter gesprochen. Aber das waren wohl nur Hirngespinste. Ich sehe ja nichts. Warum soll ich mir die Mühe machen und extra zum Dorfplatz laufen. Regnet es nicht sogar? Da bleiben wir doch lieber zuhause! Da kennen wir uns aus. Viele Menschen scheinen ja heute so zu leben. Und sie scheinen damit offenbar ganz gut zurechtzukommen.
Macht glauben glücklich?
Ja, wir sollten das nicht einfach bestreiten. Es wäre nicht die Wahrheit, wenn wir behaupteten, mit Gott lebe es sich einfach besser. Andere Weltanschauungen mögen solche Götzen anbieten, mit denen es sich besser lebt, weil sie zu allem Ja sagen. Religion ist ja ein weites Feld und kann ein sehr frommes, aber auch ein ganz weltliches Gesicht haben. Manchmal denke ich: Die Jasager-Religion findet sich auch in unseren Kirchen. Trotzdem, ich möchte da nicht tauschen. Solche Götzen werden um den Preis erkauft, dass man Leiden und Armut und Unglück ausblendet und Gott als Hirngespinst in die Ecke stellt. Ein mörderischer Preis in jedem Fall. Der Gott der Bibel dagegen ist selbst auf der Seite der Schwachen, der zu kurz Gekommenen, der Leidenden. Was Wunder, wenn man in seiner Nähe Erfahrungen von Schwachheit, Missachtung und Leid macht?
Ich finde es sehr begreiflich, dass man dem gern aus dem Weg geht. Wer freut sich schon auf einen Termin beim Zahnarzt. Aber welch ein folgenschwerer Irrtum, zu meinen, man wählte das bessere Teil, indem man den Termin schwänzte! Wer den Himmel außer acht lässt, sieht bald auch die Erde nicht mehr richtig, weiß nicht mehr, wo oben und unten, hinten und vorne ist. Man nimmt den Menschen, sich selbst wie den Nächsten, nicht mehr richtig wahr, wenn man aufhört, an Gott zu denken. Und „von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“, sagt unser Text. Die Fülle Gottes erfahren heißt Gnade erfahren. Nicht machtvollen Sieg über das Böse dieser Welt und auch nicht rauschhafte Entrückung in einen Himmel der Glückseligkeit. Das geht mit Suchtmitteln besser. Gott wohnt in der Krippe unter uns und am Kreuz, nicht anders. Aber das heißt nun wirklich: Gnade, offene Tür, ausgebreitete Arme. Alle Wege, dem Leiden dieser Welt zu entkommen, sind uns abgeschnitten. Aber dafür ist die Tür, das Leiden dieser Welt zu überwinden, durch Liebe zu überwinden, weit aufgestoßen. Der entscheidende Durchbruch ist schon geschafft. Stellvertretendes Leiden für die Bosheit dieser Welt – das wird von uns nicht mehr erwartet. Wir würden darum die Wahrheit des Evangeliums verdunkeln, wenn wir ständig mit Leidensmiene herumliefen und den Menschen um uns her den Eindruck vermittelten, es sei schon ein besonderes Opfer, im Dienst des Evangeliums zu stehen. Für den Glücksüchtigen, der seine Fähigkeit zum Mitleiden mit Gott und seinen Menschen verdrängt, sieht das wohl so aus. Jeder Süchtige hat Angst vor dem Entzug. Aber wer frei geworden ist – in aller Vorläufigkeit frei, gewiss, wir bleiben ja in dieser Welt – dennoch, wer frei geworden ist, der muss doch die Gnade der Befreiung zur Schau tragen und nicht den Schmerz des Entzugs.
Ein besserer Schluss
So, als Befreite, sollte es uns auch möglich sein, dem Märchen vom Elefanten einen andern Schluss zu geben als den vorgelesenen. Nicht mehr: „Alsbald gerieten die Blinden untereinander in Streit darüber, wer wohl den Elefanten richtig begriffen habe. Den Elefantenführer zu befragen, war nicht mehr möglich. Er hatte seinen Weg fortgesetzt“. Sondern: „Da fassten sich die Blinden an den Händen und einer zeigte dem andern, was er erfahren hatte. So trugen sie das, was jeder für sich begriffen hatte, zusammen, und daraus erwuchs das Bild eines lebendigen Elefanten, so lebendig, wie ihre Gemeinschaft untereinander.“ Amen.
gehalten am 1. Sonntag nach Epiphanias, dem 11.1.1981 in der Inselkirche zu Langeoog
Aus dem Gästebuch in der Inselkirche:
„Das Altarbild
hat mich auf eine –
bis jetzt noch – unerklärliche Art angerührt.
Das tut gut
und es gefällt mir an dieser Kirche besonders.“
4. 3000 Jahre alt – und noch brauchbar? –
1. Mose 3, 1–24
Wenn im alten Israel ein Kind seine Mutter oder seinen Vater fragte: „Vati, warum scheint die Sonne?“ oder „warum gibt es Krokodile?“, dann erzählten die Eltern eine Geschichte. Sie erzählten, wie Gott Jahwe den Menschen macht und wie er ihm eine bunte und lebendige Erde baut, in der er leben und spielen und arbeiten kann wie im Paradies. Und wenn das Kind dann fragte: „Und warum gibt es dann Krankheit und Schmerzen, warum müssen Menschen sich so quälen und am Ende gar sterben?“, dann erzählten die Eltern die Geschichte von der Schlange und der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies.
Ich frage mich, ob Kindern heute nicht zu wenig erzählt wird. Wer erzählt, gibt ja etwas weiter von den Traditionen, die sein Leben tragen und die auch für die nachfolgende Generation von Bedeutung sind. Und er gibt etwas weiter von sich selbst. Vielleicht ließe sich so manches, was wir heute an Generationsproblemen haben, zwischen Alten und Jungen, vermeiden, wenn wir uns die Zeit nähmen und die Mühe machten, unsern Kindern zu erzählen. Häufig rührt doch die Gleichgültigkeit, ja die Aggressivität der Jungen daher, dass sie uns nicht kennen und unsere Welt nicht verstehen. Da ringen Vertrauen und Zweifel in der kindlichen Seele miteinander, und niemand ist so kompetent wie die eigenen Eltern, hier zu helfen (2. Mose 13, 14).
Vielleicht haben wir recht mit dem Gefühl, wir wüssten nicht genug, um Geschichten zu erzählen. Die aus der Bibel. Oder auch andere. Dann müssen wir uns eben informieren! Bei der vergleichsweise harmlosen Mengenlehre waren und sind ja erstaunlich viele Eltern bereit, ihre Verlegenheit zuzugeben und sich noch einmal auf die Schulbank zu setzen. Müsste das nicht bei den ungleich wichtigeren Fragen nach dem Menschen und seinem Leben vor Gott erst recht so sein? Möglichkeiten gibt es doch genug: Gottesdienste, Seminare, Vorträge, Freizeiten – sogar der Konfirmandenunterricht ist bei uns offen für die Teilnahme von Erwachsenen. Hüten wir uns, die Fragen unserer Kinder weiter vor uns herzuschieben. Auch darüber zu reden, was wir nicht wissen, öffnet ja Türen.
Vielleicht haben die Kinder aber auch Mitschuld, vielleicht fragen sie nicht genug. Überlegt mal, wann ihr euren Eltern das letzte Mal eine wirklich wichtige Frage gestellt habt. Viele junge Menschen meinen heute offenbar, sie wüssten genug. Mengenmäßig mag das ja auch stimmen, allein was man so im Gespräch mit andern Jugendlichen hört – da kommt so einiges zusammen. Nur, wie wichtig ist das? Angesichts einer Welt, die mit immer größerer Geschwindigkeit Dinge in Frage stellt, die gestern noch selbstverständlich schienen, brauchen Jugendliche heute nichts nötiger als Maßstäbe für ein lohnendes Leben. Und nach denen muss man fragen. Und um fragen zu können, muss man sich wehren gegen die Verblödungsstrategie von Floskeln und professionellen Schwätzern.
Erzählen und verstehen
Die Geschichte von Adam und Eva und der Schlange, unser heutiger Predigttext, ist entstanden aus einer jahrhundertelangen Erzähltradition, ausgelöst durch die Frage: Warum ist das Leben so hart? Warum tun die Menschen einander Böses an? Warum gibt es scheinbar unnötiges Leiden wie die Schmerzen der Frau bei der Geburt? Bis hin zu: Warum müssen Menschen sterben? Man kann die vielen Einzelgesichtspunkte, die sich im Laufe dieser jahrhundertelangen Überlieferung angesammelt haben, in einer Predigt gar nicht ausschöpfen; wir können die Geschichte ja nur von ihrer Endfassung her hören, wo manches, was auch einmal wichtig war, ganz in den Hintergrund getreten ist.
Es bringt wohl auch viel mehr, wenn Sie sich/ihr euch diese Fragen gegenseitig stellt. Wer es noch mal nachlesen will, l. Mose 3, 1–24, ganz vorn auf den ersten Seiten in der Bibel. Ich kann und will von hier aus nur einige Orientierungen geben:
Mühe und Last und Schmerzen und Tod, sagt unsere Geschichte – das kommt daher, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Wir sind heute hellhöriger als noch vor wenigen Jahren für die vielfältigen Bedrohungen der Schöpfung. Wir beginnen sogar zu begreifen, dass diese Bedrohungen gerade aus den Dingen kommen, die unser Leben angenehm machen, vom Deodorantspray über Kühlschränke bis zur Atomenergie. Ja, hier und da kann man sogar schon von ersten Erfolgen sprechen, Erkrankungen des natürlichen Organismus zu heilen: das Wasser des Rheins war schon schmutziger, die Bewilligung von Autobahnen machte früher weniger Schwierigkeiten, der Waldbestand in unserm Land nimmt nicht mehr ab, sondern zu. Trotzdem, aus dem Paradies sind wir ein für allemal heraus und es gibt keinen Text in der Bibel, der besagt, dass wir das jemals rückgängig machen könnten.
Langeoog neu entwerfen
Uns ist das in diesen Tagen sehr anschaulich geworden auf der Familienfreizeit in Kimmerheide. Da haben wir uns in vier Gruppen an die Arbeit gemacht, ein Modell von unserm Langeoog zu entwerfen, wie wir es uns wünschten, unter der bewusst phantastischen Voraussetzung, wir könnten noch einmal ganz von vorn anfangen. Die Ergebnisse, die drüben im Gemeindesaal zu besichtigen sind, geben natürlich längst nicht alles wieder, was wir dabei miteinander gesprochen und erlebt haben. Aber sie zeigen doch, jedes auf seine Weise: das Paradies steht uns nicht mehr offen, bestimmte Dinge müssen einfach in Kauf genommen werden, sogar in einem solchen Spiel.
Vielleicht müssen wir sogar noch weitergehen und sagen: Das Paradies steht uns nicht einmal mehr in unserer Fantasie offen. Wir können unsere Welt gar nicht mehr so denken, dass wir Gott darin begegnen wie unserm Nachbarn beim Abendspaziergang; dass die Beziehung von Mann und Frau nicht immer von beidem bestimmt ist: von Lust und Scham; dass uns unsere Arbeit nur erfüllt und befriedigt und ernährt, und nicht auch quält und seufzen lässt, manchmal vielleicht sogar verzweifeln; dass die Kräfte der Natur – hier dargestellt in der Gestalt der giftigen Schlange – uns nicht nur dienen und den Freiraum unseres Handelns vergrößern, sondern uns auch bedrohen – denken wir an die Erdbeben im Mittelmeerraum oder denken wir auch an das Meer, das uns umgibt! „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe“, sagt Gott zur Schlange, „zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“
Das Schwergewicht der Geschichte liegt freilich nicht auf der Beschreibung der Welt nach dem Ausschluss aus dem Paradies. Das hatten und haben die Menschen ja allenthalben vor Augen, damals in mancher Beziehung vielleicht noch unmittelbarer als heute. Dass wir auf einem riesigen Pulverfass von Waffen sitzen, das jeden Augenblick in die Luft gehen kann, davor kann man offenbar eher die Augen verschließen als vor der Möglichkeit, dass der fällige Regen ausbleibt oder der Vulkan wieder einen Ausbruch hat – vor allem, wenn die verantwortlichen Politiker – so sagt man ja wohl – uns erklären, das wäre ganz normal und die Russen hätten noch viel mehr und wir müssten deshalb damit rechnen, dass die eben gesenkten Steuern demnächst wieder angehoben würden, damit unser Land noch größere Pulverfässer kaufen könne.
Dass ein Tankerunfall auf der Jade mit all seinen verheerenden Folgen für unser Gebiet – biologisch wahrscheinlich nicht wieder gutzumachenden Folgen – dass ein solcher Unfall, statistisch gesehen, eigentlich schon überfällig ist, davor kann man offenbar leichter die Augen verschließen – das weiß doch jeder, dass Statistik lügt – als in den alten Zeiten vor der Gefahr, dass der Wolf bei Nacht in die Herde einfiel. Eins müsste uns allerdings angesichts dieser Veränderungen heute leichter fallen — und damit sind wir bei dem, was die Geschichte eigentlich sagen will: Was die Bedrohung unseres Lebens letztlich verursacht, ist die Sünde des Menschen. Das ist ja bei den natürlichen Gefährdungen – also wilde Tiere oder Katastrophen – sehr viel weniger offensichtlich als bei unsern selbstgemachten Bedrohungen. Sicher, auch da kann man sich herauszureden versuchen: Ich hab keine Schuld, die da oben oder da hinten (im Osten) oder da unten (im Süden), die haben das gemacht. „Das Weib“, sagt Adam; „die Schlange“, sagt Eva. Wir kennen das, ob wir nun noch in die Schule gehen oder als Erwachsene eine Debatte unter Politikern miterleben. Aber im Grunde wissen wir alle miteinander, dass wir uns nicht entschuldigen können.
Du bist beteiligt
Wir haben schließlich immer gewusst, dass Waffen zum Schießen da sind, zum totschießen, wohlgemerkt. Wir haben immer gewusst, dass Öl und Kohle nicht in unbegrenzter Menge vorhanden sind; aber wir haben gedacht… – nein, wir haben nicht gedacht! Wir haben immer gewusst, dass Bäume lebensnotwendig sind für die Luft die wir atmen, und reines Wasser Grundbedingung für unsere Nahrung. Aber wir haben trotzdem das Altöl weggegossen – so ein halber Liter, was macht das schon! – und wir haben es trotzdem zugelassen, dass die Bäume an unserer Straße gefällt wurden – wir kommen seitdem tatsächlich 3 Minuten schneller in die Stadt. Und außerdem: der Politiker, der für den Ausbau der Atomenergie ist, haben wir den nicht gewählt? Und den, der für noch mehr Waffen eintritt, den nicht auch? Hätten wir nicht wenigstens sagen können: Nein, ich will das nicht!?
Besondere Sorgfalt verwendet unsere Geschichte darauf anschaulich zu machen, wie es dazu kam, was wir Sünde nennen, diesen wahnwitzigen Entschluss, es ohne Gott zu versuchen, jedenfalls an seinem ausdrücklichen Gebot vorbei. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich sagen; du sollst nicht töten? Unsinn, töten macht Spaß. Sondern wir sagen: Du sollst nicht töten! Richtig! Aber sollte Gott auch gesagt haben, dass ich mich nicht wehren darf, wenn ein anderer droht, mich zu töten? Das kann doch wohl nicht sein. Und wenn das für mich persönlich gilt, muss es doch auch für ein ganzes Volk gelten. Ich kann dann zwar nicht mehr nachprüfen, ob wir wirklich bedroht sind. Das sagen uns die Generäle. Und Generälen muss man gehorchen, das sieht jeder ein. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder im Krieg machen wollte, was er für richtig hält. Also gehorchen wir den Generälen, die sagen, wir seien bedroht. Und wir üben sicherheitshalber das Schießen, nur für den Notfall, versteht sich, aber dann könnte es zum Üben zu spät sein. Und dass wir dann am Ende auf einen schießen, der genauso brav in den Krieg gezogen ist wie ich, weil ihm seine Generäle gesagt haben, wir bedrohten ihn – ja das ist dann leider zwangsläufig und nicht zu ändern.
Sollte das wirklich bedeuten…?
Es ist ja auch nicht so, dass wir plötzlich sagen: Du sollst nicht stehlen? Unsinn, stehlen macht Spaß. Sondern wir sagen: Du sollst nicht stehlen? Richtig! Aber sollte Gott wirklich gesagt haben, es sei verboten, dort zu kaufen, wo es am billigsten ist? Das kann doch wohl nicht sein. Und wenn das für mich persönlich gilt, dann gilt das für die großen Konzerne auch. Ich kann dann zwar nicht mehr nachprüfen, ob die nicht den Lieferanten in der 3.Welt die Daumenschrauben ansetzen und sagen: Also entweder krieg ich deinen Kaffee für den halben Preis oder du bleibst drauf sitzen und verhungerst. Das kommt durch den Konkurrenzdruck, sagen die Konzerne, und Konkurrenz sei nötig, wegen der Inflation und so. Wo kämen wir denn hin, wenn die Leute in der 3. Welt das kriegten, was sie forderten. Das Beispiel Ölscheichs sollte uns doch eine Lehre sein! Und so kaufe ich meinen Kaffee weiter da, wo er am billigsten ist und denke nicht darüber nach, dass jetzt ein Arbeiter in Brasilien seinen Kindern wieder nicht genug zu essen geben kann. Und zwei von den zehn werden nächstes Jahr nicht mehr am Leben sein. – Man sündigt nicht, indem man zu viel isst, sondern weil man zu wenig denkt. Der Kaffee aus dem 3.Welt-Laden ist zwar teurer als im Supermarkt. Aber er garantiert den Erzeugern einen gerechten Preis.
Nun sind wir heraus aus dem Paradies. Durch Gott hinausgetrieben. Und deshalb können wir mit unserer Kraft und unserer Vernunft auch nicht wieder hinein. Trotzdem hat das Leben Zukunft. Das ist ja der heimliche Grundton dieser Geschichte. Gott straft, aber in seinem Strafen bleibt er uns verbunden, begleitet er uns, behält er uns im Auge. „Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an“, heißt es in einer geradezu rührenden Anschaulichkeit. Vom Neuen Testament her könnten wir vielleicht sagen: Gott schlägt die Tür zum Paradies zu, aber er bleibt selbst nicht dahinter, sondern er geht mit seinen Menschen hinaus auf den dornigen Acker und in die Hütte der Schmerzen. Oder sage ich’s so: Der Weg zum Baum des Lebens steht uns von uns aus nicht mehr offen. Aber der Baum ist nicht gefällt. Wenn Gottes Gnade es will, hält uns nicht einmal der Erzengel mit dem flammenden Schwert davon zurück, im Schatten dieses Lebensbaumes Ruhe zu finden. Amen.
gehalten am Sonntag Invocavit, dem 8.3.1981 in der Inselkirche zu Langeoog
Aus dem Gästebuch in der Inselkirche:
„Mir gefällt die Kirche, besonders das Altarbild.
Ich habe schon lange ein Foto auf meinem Schreibtisch
und schaue es immer wieder an.“
5. Ein stammelndes Bekenntnis –
Liedpredigt über EG 362 – „Ein feste Burg“
Was für ein Gefühl ist das, wenn Sie dieses Lied singen? Es werden ja gewiss nur wenige hier sein, für die der Choral Nr. 362 ein Kirchenlied wie jedes andere ist, viele dagegen, die ihr Gesangbuch in Gedanken oder ganz buchstäblich zugeklappt haben: „Ein feste Burg… – das kann ich auswendig!“
Und inwendig? Welche Saiten klingen da mit? Hochgefühl? Ergriffenheit vor der mächtigen Tradition, in der wir stehen? Oder steht mehr das Befremden im Vordergrund, weil dieses Lied zwar ein Stück Inventar unserer Seele ist, aber hier und heute nicht am gewohnten Platz? „Ein feste Burg“ – das gehört doch zum Reformationsfest, nicht wahr, das ist doch ein Trutz- und Kampflied gegen die heuchlerische Scheinheiligkeit papistischer Werkerei und Geldgier.
Die kleine Dorfkirche in Goldenstedt im südlichen Oldenburger Land, mit der mich meine Kinder- und Konfirmandenjahre verbinden, hat in ihrer Geschichte eine Phase von fast 200 Jahren erlebt, da gab es für Katholiken und Protestanten am Ort nur ein Kirchengebäude, aber auch nur einen Gottesdienst. Darin amtierte ein katholischer Pfarrer und – zum Ausgleich – ein evangelischer Kantor. Die Überlieferung will wissen, man sei mit dieser Art von Ökumene in der Regel auch gut zurechtgekommen. Und wenn der Priester wirklich einmal in der Predigt allzu konfessionalistische Töne angeschlagen habe und den Gläubigen zu viel mit dem Papst oder mit Maria gekommen sei, dann habe der Kantor in die Tasten seiner Orgel gegriffen und die evangelischen Gemeindeglieder hätten sich wie ein Mann von ihren Plätzen erhoben und „Ein feste Burg ist unser Gott“ angestimmt. Damit hätte man den Prediger für kurze Zeit mattgesetzt und der sei danach, wenn er die unterbrochene Predigt fortsetzen konnte, deutlich zurückhaltender gewesen.
Ein kurioses Beispiel, zugegeben. Aber vielleicht doch bezeichnend für die Rolle, die dieses Lied unter uns Evangelischen eingenommen hat. „Protestanten–Marseillaise“ hat man es ironisch genannt, also eine Art Nationalhymne der Lutheraner. In der „Evangelischen Zeitung“ konnte man ein Zitat aus einem um 1920 erschienenen Buch über Kirchenlieder lesen – ein „ansonsten seriöses Buch“, wie ausdrücklich vermerkt wird. Da heißt es: „Im letzten Menschenalter (1920!) hat das Lied eine Mission gehabt, wie sie ihm seit den Tagen der Reformation nicht mehr beschieden gewesen war. Weit mehr als in unseren Gottesdiensten wird es bei Feiern, Versammlungen und Weiheakten als Programm und Feldgeschrei angestimmt und während des Krieges von 1914–1918 hat es im Felde wie in der Heimat seine Kraft bewährt“ (EZ Nr. 6/1983, S. 7).
Protestanten-Marseillaise