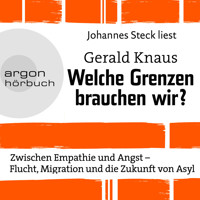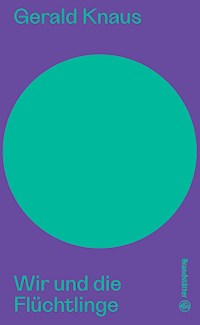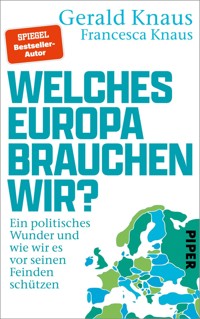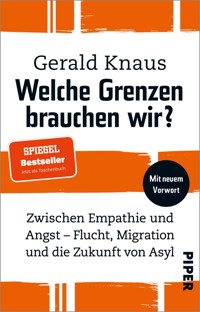
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kein anderes Thema hat die europäische Politik in den letzten Jahren so beeinflusst wie die Debatte um Geflüchtete, Asyl und Migration. Dabei wird die Diskussion dominiert von Schlagworten, falschen Tatsachenbehauptungen und Scheinlösungen. Gerald Knaus erklärt in seinem Buch, worum es tatsächlich geht, und zeigt, dass humane Grenzen möglich sind. Der Migrationsexperte, dessen Analysen Regierungen in ganz Europa beeinflusst haben, erklärt, welche Grundsatzprobleme wir dafür lösen müssten und warum seine Ideen mehrheitsfähig und umsetzbar sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutztSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karten
Flucht und Neuansiedlungen in Südostasien (1975 bis 1996)
Ausnahmejahre in der Ägäis – Grenzen in Südosteuropa
Die Sahara und das Mittelmeer als tödlichste Grenze
Australien und die Bootsflüchtlinge: Von der Weihnachtsinsel bis Nauru
Warum dieses Buch?
Europas Grenzrevolution
Unmenschliche Grenzen
Der Optiker und die Ertrinkenden
Die Schweizer Grenze und Refoulement
Die Mauer und tödliche Gewalt
Die Verdammten von Papua-Neuguinea
Wer ist unser Nächster?
Empathie und der »Stamm am anderen Ufer«
Der General und das volle Boot
Die Retter im Südchinesischen Meer
Die guten Australier
Die Paten aus dem Norden
Der Sinn von Asyl
Die europäische Flüchtlingskonvention
Asyl als Farce
Schnelle Verfahren und sichere Herkunftsstaaten
Nürnberg und Asyl in der Welt
Unser Plan für die Ägäis
»Merkel ist schuld« und andere Illusionen
Sinnloser Tod, ratloses Europa
Die Einigung mit der Türkei
Das europäische Nauru
Afrikanische Lösungen
Apokalyptische Migrationsmythen
Migrationswunsch und Migrationsdruck
Ausnahmejahre im Mittelmeer
Die tödliche Wüste
Der Gambia-Plan
Abschieberealismus
Stacheldraht und Asylverfahren
Marokko als Partner
Europa als Leuchtturm
Erfolg und das Nächstmögliche
Null Tote im Mittelmeer
Acht Wochen für ein faires Asylverfahren – Lehren aus der Ägäis
Abschiebungsdiplomatie – Von der Karibik lernen
Patenschaften und Verteilung in Europa
Von Kanada lernen – Projekt 0,05
Ein Durchbruch mit Afrika
Dublin war nie das Problem
Es fehlte nicht an Grenzschützern
»Flüchtlinge in Not« und die Zukunft des UNHCR
Legenden, die uns schaden, und Geschichten, die wir brauchen
Die Interessen einer humanitären Supermacht
Epilog: Meine Welt von gestern
Wer mehr erfahren will – Bücher
Asyl, Geschichte und Geschichten
Politik und Gegenwart
Seenotretter
Allgemein
Danksagung
Bildnachweis
Anmerkungen
Warum dieses Buch?
2019 kamen insgesamt etwa 100 000 Menschen irregulär über das Mittelmeer in die Europäische Union. Das sind im Durchschnitt 280 Menschen am Tag. Sind das zu viele? Werden es bald sehr viel mehr sein? Soll man sie stoppen, und welche Maßnahmen sind dabei erlaubt? Wer hat das Recht oder die Pflicht, dies zu entscheiden? Es sind diese Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden sollen.
Die Zeit drängt, denn an den Außengrenzen Europas herrscht heute ein Ausnahmezustand. Es gibt Gesetze, die festlegen, was Grenzbeamte an Grenzen tun müssen und dürfen; es gibt Standards, die bestimmen, wie Asylsuchende untergebracht und behandelt werden müssen. Doch diese Gesetze und Standards werden täglich gebrochen. Selbst der Kern des internationalen Flüchtlingsschutzes wird regelmäßig verletzt: das Verbot, Menschen zurückzustoßen, die an Grenzen aufgegriffen werden. Es droht das Ende einer Ära, die vor 70 Jahren mit der Annahme der Europäischen Menschenrechtskonvention im Jahr 1950 und der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 begann.
Die Grundlage der moralischen Neugründung Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ausrichtung staatlicher Politik an der Menschenwürde jedes Einzelnen. Sie findet sich in Artikel 1 des Grundgesetzes: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«, wie auch in Artikel 1 der Charta der Grundrechte der EU: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.« Dazu schrieb der deutsche Rechtsphilosoph Günter Dürig 1956 in einem einflussreichen Aufsatz: »Die Menschenwürde als solche ist getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.« Der Staat hat die Verpflichtung, die »Degradierung des Menschen zum Ding«, das «abgeschossen«, »ersetzt«, »ausgesetzt« (vertrieben) werden kann, zu verhindern.[1]
Doch welchen Wert hat dieser Grundsatz heute in den Gewässern zwischen Libyen und Italien, auf dem Balkan, in der Ägäis? Noch vor wenigen Jahren retteten Schiffe der Marine und Küstenwache von EU-Staaten Hunderttausende Menschen vor dem Ertrinken im zentralen Mittelmeer. Dann wurde die staatliche Seenotrettung fast gänzlich eingestellt und die private Seenotrettung behindert. Das Ergebnis ist dramatisch. Vor Malta treiben wieder Boote mit Migranten, die Hilferufe wie diesen aussenden: »Wir sind so müde, die Situation ist die Hölle. Das Boot hat viel Luft verloren, Wasser kommt rein. Wir sterben. Bitte rettet uns.«[2] Selbst solche Rufe werden tagelang ignoriert und so unzumutbare Risiken für Menschen in Seenot in Kauf genommen. Seit Jahren arbeitet die Europäische Union mit libyschen Institutionen zusammen, die Menschen in Lager des Bürgerkriegslands bringen, in denen sie misshandelt werden. Anfang März 2020 schossen griechische Beamte an der griechisch-türkischen Landgrenze auf Migranten, die den Grenzfluss zur Türkei Richtung Griechenland überqueren wollten. Heute finden sogenannte Push-Backs an vielen Landgrenzen in Europa regelmäßig statt. In Aufnahmelagern an Europas Grenzen, wie auf den griechischen Inseln in der Ägäis, tolerieren europäische Regierungen Zustände, die wir in den ärmsten Staaten der Welt für inakzeptabel halten würden.
Die Gesellschaft gewöhnt sich an den permanenten Gesetzesbruch, und auch die Nichtregierungsorganisationen wirken ratlos. Ihre Instrumente – die Öffentlichkeit durch das Schaffen von Aufmerksamkeit für menschliches Leid zu beschämen, internationale Gerichte einzuschalten – konnten den Trend in den letzten Jahren nicht stoppen. Politiker in der EU erklären offen, Grenzschutz ohne »hässliche Bilder«, ohne die Bereitschaft zur Abschreckung sei Träumerei.
Dieses Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die davon überzeugt sind, dass es möglich sein muss, an Europas Grenzen Kontrolle mit Respekt für Menschenwürde zu verbinden. Es ist für jene, die der Gedanke an fast 18 000 Männer, Frauen und Kinder, die in nur fünf Jahren im Mittelmeer ertrunken sind, und an Kinder, die im Winter in Zelten auf einer Insel in der Ägäis frieren, nicht loslässt. Es ist für Europäerinnen und Europäer, die sich ein Grenzregime wünschen, das Kontrolle mit Menschlichkeit verbindet und dabei den Kern der Genfer Flüchtlingskonvention verteidigt: das Gebot der Nichtzurückweisung von Schutzsuchenden. Und die gleichzeitig ernst nehmen, dass man in Demokratien Mehrheiten erringen und verteidigen sowie in der EU andere Staaten mit Argumenten überzeugen muss, um Politik gestalten zu können. Es ist für jene, die das Feilschen um die Verteilung kleiner Gruppen, die aus Seenot gerettet wurden, für unwürdig halten. Und die doch verstehen wollen, wie es dazu kam, dass noch nie zuvor so viele Menschen im Mittelmeer ertranken wie in jenem Jahr, in dem es so viele Seenotrettungen durch europäische Schiffe gab wie nie zuvor.
Es ist ein Buch für Leser und Leserinnen, die sich auf der Grundlage solider Fakten und Erfahrungen selbst eine Meinung darüber bilden wollen, welche Möglichkeiten wir haben. Und die sich auf die Suche nach Argumenten machen, um zunächst sich selbst und dann andere zu überzeugen.
Die meisten Menschen sind weder Monster noch Engel, weder empathielose Psychopathen noch Märtyrer. Sie sind empathisch, doch ihre Empathie ist nicht grenzenlos. Sie bevorzugen durchlässige Grenzen, solange sie sich sicher fühlen, und geschlossene Grenzen, sobald sie um sich oder ihre Lieben Angst haben. Sie sind durchaus bereit, Menschen in Not zu helfen, wollen dabei aber nicht die Kontrolle verlieren. Doch sie gewöhnen sich auch an Bilder des Leidens in der Ferne, an den Horror in Syrien, im Jemen, im Südsudan, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass bestimmte Dinge nicht zu ändern sind.
Die meisten Menschen wollen Politiker, die versuchen, ihre Werte und Interessen zusammenzubringen, und eine Politik, die Empathie und Kontrolle verspricht. Und wenden sich von jenen ab, die ihnen schwach oder heuchlerisch vorkommen. Erscheinen Regierende rat- und planlos, schlägt die Stunde entschlossener Demagogen. Wer ihnen entgegentreten will, braucht mehr als gute Absichten und moralische Entrüstung. Die erfolgreichsten unter den Demagogen sind wie Judokas, die die ungestüme Energie ihrer Gegner von vornherein für ihren Gegenangriff einplanen. Sie beherrschen das Spiel mit Emotionen und entwickeln packende Geschichten, in denen es um Heerscharen von Einwanderern geht, um Eroberer und Invasionen, um Kontrollverlust und das Verschwinden unserer Welt. Und sie werden nicht müde, diese Geschichten immer wieder aufs Neue zu erzählen.
Beim Suchen nach Lösungen sind aber weder Angst noch Empathie gute Ratgeber. Für erfolgreiche Politik braucht es kritisches Denken, Fakten, Zahlen. Und eine klare Sprache, Konzepte und Begriffe, die uns helfen, Handlungsoptionen zu verstehen. Doch an diesen fehlt es heute. Immer wieder hören wir Behauptungen, die der Suche nach umsetzbaren Vorschlägen im Weg stehen, auch wenn sie zunächst plausibel klingen. Es sind unzutreffende Aussagen wie diese:
Migration ist wie Wasser in kommunizierenden Röhren:
Irreguläre Migration lässt sich nicht stoppen, nur umleiten.
Die demografische Entwicklung Afrikas und die Effekte des Klimawandels erhöhen den Migrationsdruck:
Dies führt zwangsläufig zu mehr irregulärer Migration aus Afrika nach Europa.
Wirtschaftliche Entwicklung führt zu mehr irregulärer Migration:
Wenn Länder wohlhabender werden, können sich mehr Menschen Migration leisten.
Seenotretter verursachen einen Pull-Effekt:
Um das Sterben im Mittelmeer zu beenden, muss man die Seenotretter abziehen.
Mehr Seenotretter bedeuten weniger Tote im Mittelmeer:
Um zu verhindern, dass Tausende sterben, brauchen wir vor allem mehr Seenotretter vor Ort.
Um Migration zu bewältigen, muss Europa gemeinsam vorgehen:
Nationale Alleingänge und kleine Koalitionen williger Mitgliedsstaaten schwächen die Europäische Union.
Das Dublin-System der Europäischen Union ist ungerecht:
Es geht zulasten der Mittelmeerländer. Fair wäre es, eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die gesamte EU vorzunehmen.
Mehr Grenzschützer können Migration reduzieren:
Um irreguläre Migration an den EU-Außengrenzen zurückzufahren, brauchen wir dringend einen Ausbau von Frontex (Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache).
Die deutsche Grenzöffnung war vermeidbar:
Angela Merkel hätte die deutsche Grenze im September 2015 auch wieder schließen können, denn dafür gab es einsatzbereite Pläne.
Den Europäern fehlt es an Empathie:
Europa schottet sich ab, und als Folge daraus werden die meisten Flüchtlinge von armen Ländern aufgenommen.
Ich möchte in diesem Buch jede dieser zehn Behauptungen infrage stellen und auch die Konzepte und Begriffe dahinter – Migrationsdruck, legale Wege, Externalisierung, Grenzöffnung, Pull-Effekt – prüfen. Je schneller wir in unserem Denken über Grenzen und Migration Metaphern aus der Hydraulik hinter uns lassen, desto rascher finden wir zu einer lösungsorientierten Debatte. Wir brauchen eine Migrationsdebatte, die genau hinsieht, was Menschen auf beiden Seiten von Grenzen wirklich bewegt. Wer macht sich wann und wo auf den Weg? Welche Gruppe wird in welcher Gesellschaft wie wahrgenommen? Welche Instrumente und Ressourcen gibt es, welche Institutionen und wie viele Beamte sind notwendig, um unsere gesetzlichen Selbstverpflichtungen, etwa das Versprechen auf faire Asylverfahren, auch zu erfüllen? Je eher wir genau hinsehen, desto schneller finden wir auch Wege, um die Situation der Bedürftigsten in der Welt – und dazu zählen Flüchtlinge, die Grenzen überschreiten müssen – zu verbessern. Denn das Leiden an Europas Grenzen ist real. Irrationale Ängste und schwammige Lösungsvorschläge verstellen den Blick auf menschliches Leid, das sich vermeiden ließe.
Das ehrgeizige Ziel muss auch darin bestehen, dafür eine Sprache zu finden, die allgemein verständlich ist. Dabei gilt es, anhand von konkreten Beispielen zu argumentieren und auf konkrete Erfahrungen zu verweisen, die uns helfen können, zu humanen Grenzen zu kommen. Denn, so erklärte der dichtende Politiker Johann Wolfgang von Goethe, der im 18. Jahrhundert zehn Jahre lang als eine Art Premierminister im Fürstentum Weimar regierte, es gebe in der Politik einen »ungeduldigen Verstand, der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschreibt«. Doch »allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind auf dem Wege, entsetzliches Unheil anzurichten«.[3]
Flüchtlinge und irreguläre Migranten sind keine unwiderstehliche Macht, sondern schwach und verwundbar. Stehen sie einem entschlossenen Staat gegenüber, ist dieser Staat bereit dazu, Gewalt anzuwenden, dann gelingt es, fast jede Zahl von Migranten abzuwehren. So leben heute keine syrischen Flüchtlinge in Israel, obwohl Israel, wie die Türkei, Jordanien oder der Libanon, an Syrien grenzt. Auch der israelische Zaun, der zwei Millionen Menschen in Gaza einschließt, ist fast unüberwindbar, weil es dort einen Schießbefehl gibt. Die Türkei ließ für einige Jahre syrische Flüchtlinge in großer Zahl ins Land und beschloss im Sommer 2015 nach einem Terroranschlag, diesen Zuzug wieder zu stoppen und entlang der syrischen Grenze eine Mauer zu bauen; mit der Schutzbedürftigkeit von Syrern hatte das wenig zu tun, denn die bestand weiterhin.
Eine andere Versuchung besteht darin, das Migrationsgeschehen in der Welt vor allem durch Fluchtursachen zu erklären. Sich gegen Kriege, politische Verfolgung oder extreme Armut einzusetzen ist auch dann wichtig, wenn diese, wie in den allermeisten Fällen, nicht zu Flucht führen. Denn dass es zwingende Gründe gibt, ein Land zu verlassen, erklärt noch nicht, wie vielen Menschen es gelingt, Grenzen irregulär zu überschreiten. Dass eine australische Regierung zwischen 1975 und 1982 etwa 150 000 vietnamesische Flüchtlinge durch Umsiedlung im Land aufnahm, war eine politische Entscheidung; dass eine spätere australische Regierung 2001 angesichts von 12 000 Bootsflüchtlingen in drei Jahren zu drastischen Maßnahmen griff und diese Migration schnell auf null drückte, ebenfalls. Die tatsächlich stattfindende Migration nach Australien war das Ergebnis einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Kommenden durch Eliten und Gesellschaft 1981 und 2001, nicht Folge der Zustände in Vietnam oder in Afghanistan. Dass 2016 fast 40 000 Nigerianer Italien erreichten und 2019 weniger als 500, hatte mit Fluchtursachen in ihrer nigerianischen Heimat wenig zu tun. Um diese Veränderung zu erklären, muss man sich mit italienischer Innenpolitik beschäftigen und nicht mit der Armut in Benin-Stadt.
Das Bild irregulärer Einwanderer als mächtiger Armee, die alle Grenzen überwindet, ist ein Mythos. Die Frage lautet vielmehr, ob Staaten bereit sind, Gewalt gegen unbewaffnete Menschen einzusetzen. So ist der wichtigste Verbündete schutzbedürftiger Menschen an Grenzen weder ihre Zahl noch ihre Entschlossenheit, nicht einmal ihre Verzweiflung und Schutzbedürftigkeit. Es ist das Gewissen und das Weltbild jener, die an Grenzen über Gewaltmittel verfügen. Und zu verschiedenen Zeiten haben auch Demokratien sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage gegeben, welche Grenzen sie wollen, oft mit dramatischen Folgen für Geflüchtete.
Wir werden im Folgenden eine Reise um die Welt machen, von Kanada bis Australien, von Westafrika bis Südostasien, vom Alpenrhein zur Oder, über die Ukraine und die Türkei nach Libyen und Marokko. Wir werden viele Menschen kennenlernen, deren Geschichten uns daran erinnern, dass Grenzen Schicksale bestimmen. Und warum wir uns für menschliche Grenzen der Europäischen Union einsetzen sollten.
Erfolgreiche Politik muss allerdings immer auch Lösungen präsentieren, die Mehrheiten überzeugen. Nicht irgendwann, sondern jetzt; nicht irgendwo, sondern an allen Außengrenzen der EU, vom westlichen Mittelmeer bis zur Ägäis, vor Lampedusa wie in den Bergen des Balkans. In diesem Buch finden Sie Vorschläge für eine neue Generation von Abkommen mit nord- und westafrikanischen Ländern, von Marokko und Tunesien bis Gambia und Nigeria; für eine Koalition europäischer Staaten, damit es keinen einzigen Toten im Mittelmeer gibt; für eine Reorganisation der Seenotrettung; für eine neue Einigung mit der Türkei; für die intensive Kooperation europäischer Asylbehörden bei Pilotprojekten in Melilla, auf Malta, Lampedusa und Lesbos; für eine internationale Koalition zur Wiederbelebung von Resettlement, der Neuansiedlungen Schutzbedürftiger, und für einen neuen Fokus und eine andere Kommunikation des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR. Vorschläge, bei denen es darum geht, Bewegungsfreiheit und Sicherheit, Freiheit und Kontrolle zu verbinden. Und so zu verhindern, dass die Überzeugung von der Unantastbarkeit der Menschenwürde sowie das 70 Jahre alte Versprechen der Genfer Flüchtlingskonvention nicht vor unseren Augen im Mittelmeer versinken.
In der Politik muss man andere von Lösungen überzeugen, damit sich Dinge ändern. Der 1955 verstorbene amerikanische Autor Dale Carnegie schrieb in seinem bis heute verlegten Ratgeber Wie man Freunde gewinnt: »Haben Sie je darüber nachgedacht, dass es auf der ganzen Welt nur einen einzigen Weg gibt, einen Menschen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun? Man muss erreichen, dass er es selbst tun will! Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.« Und er ergänzte: »Natürlich können Sie jemandem den Revolver auf die Brust setzen und ihn zwingen, Ihnen seine Uhr zu geben … Aber diese unsanften Holzhammermethoden haben höchst unerfreuliche Rückwirkungen.« Das gilt auch, wenn es um Migration geht. Im November 1784 schrieb Johann Wolfgang von Goethe über die Kunst des Führens: »Man muss Hindernisse wegnehmen, Begriffe aufklären, Beispiele geben, alle Teilhaber zu interessieren suchen. Das ist freilich beschwerlicher als befehlen, indessen die einzige Art, in einer … wichtigen Sache zum Zwecke zu gelangen und nicht verändern wollen, sondern verändern.«[4] Das ist auch das Ziel dieses Buches.
Europas Grenzrevolution
»Die Geschichte der Menschheit ist voll von Abgrenzungen, gezogenen Linien, Palisaden und Barrieren.«
Tobias Prüwer[5]
Moderne Grenzen markieren Zuständigkeiten. Das tun sie meist unspektakulär, etwa als Verwaltungsgrenzen zwischen Bezirken, Landkreisen oder Bundesländern. Wenn ich mit meinem Fahrrad vom Berliner Bezirk Treptow in den Berliner Bezirk Neukölln fahre, überquere ich eine solche im Alltag unsichtbare Grenze. Dabei verspüre ich oft eine Mischung aus Ehrfurcht und Euphorie, so als würde ich etwas Besonderes erleben. Die Pflastersteine hier zeugen von dramatischen Geschichten, von Helden und Opfern, von Mut und Verzweiflung. Und davon, wie manche Grenzen in kurzer Zeit ihren Charakter vollkommen verändern.
Hier verlief einst eine Befestigungsanlage. Zwei Mauern mit Stacheldraht, Lichttrassen, Wachtürmen und einem Todesstreifen. Er trennte die Inselstadt Westberlin von der DDR. Genau an dieser Stelle, an der ich täglich die Bezirksgrenze passiere, gelangten einst 54 Menschen durch einen Tunnel aus dem Osten in den Westen.[6] Ein junger Fluchthelfer, Harry Seidel, hatte ihn im Sommer 1962 von Neukölln bis Treptow gegraben. Im November des gleichen Jahres wurde Seidel bei einem weiteren Tunnelbau in Ostberlin verhaftet. Er sollte zum Tod verurteilt werden: Wenn es um den »Schutz der Staatsgrenze« ging, kannte der ostdeutsche Staat keine Milde. Doch dann erhielt er lebenslange Haft. Schließlich kam er nach vier Jahren frei. 2012 erhielt er zusammen mit anderen Fluchthelfern das Bundesverdienstkreuz.
Die spektakuläre Verwandlung dieser Grenze inmitten Berlins fand unter den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Es war eines der Wunder meiner Jugend. Die Verwandlung anderer Grenzen in Europa dauerte länger, war aber nicht weniger spektakulär.
Die deutsch-polnische Grenze etwa, unweit von Berlin. Im Spiegel war 1961 über die Beziehungen zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen Folgendes zu lesen: »Seit 16 Jahren gibt es in Europa kaum eine Grenze, die so scharf bewacht wird, so häufig in den Schlagzeilen der Weltpresse erscheint und so schwierig zu passieren ist wie die 456 Kilometer lange Grenzlinie an Oder und Neiße. Stacheldrahtzäune, Wachtürme und schwerbewaffnete Grenzpolizisten sichern jene Linie, hinter der die ehemaligen Ostprovinzen des 1945 zerschlagenen Deutschen Reiches liegen.«[7] 30 Jahre später, 1991, beschrieb Der Spiegel dieselbe Grenze nach dem Mauerfall. Alles, was einst Furcht erregt hatte, wirkte nun wie aus der Zeit gefallen: »Die deutsch-polnische Demarkationslinie hat keine Balken und keine Stacheldrahtverhaue. Die Wachtürme sind verfallen. Es gibt hier keine Hindernisse außer Oder und Neiße.« Die große Mehrheit der illegalen Grenzgänger 1991 kam »aus Osteuropa – überwiegend aus Rumänien … Nach Schätzungen des Bundesgrenzschutzes warten jenseits von Oder und Neiße 40 000 bis 50 000 Rumänen auf die Weiterreise in den Westen, um in Deutschland zu arbeiten. Fast alle mittellos und alle ohne gültiges deutsches Visum.«[8]
Nur fünf Jahre später, 1996, hatte sich auch das geändert, war dies die Schengen-Außengrenze. Nun berichtete Der Spiegel über Menschen, die beim Versuch, nach Deutschland zu kommen, ihr Leben verloren: »Jeder am Fluß weiß, daß es hier bei Dunkelheit nicht ganz geheuer ist – dann, wenn Schmuggler, Schlepper und heimliche Einwanderer über den deutsch-polnischen Grenzfluß kommen. Aber die Einheimischen schauen lieber nicht so genau hin … Beiderseits der Flüsse, die Europas Wohlstandsgrenze markieren, treiben die Leichen illegaler Grenzgänger aus Osteuropa und Südasien an, die ihre Sehnsucht nach Arbeit und Wohlstand im Mark-Paradies mit dem Leben bezahlt haben.«[9] Das brandenburgische Innenministerium sprach 1996 von 45 Toten an dieser Grenze in nur vier Jahren.
2007 schließlich, elf Jahre später, erfolgte die letzte große Verwandlung. Nun trat Polen dem Schengenraum bei, alle Grenzkontrollen wurden aufgehoben. Bei einer Mitternachtsfeier im Dezember im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien erklärte ein ergriffener polnischer Premierminister, dieser Tag sei ein »Triumph der Freiheit«. Heute sterben an der Oder keine Migranten mehr. Rumänen können seit 2001 ohne Visum nach Deutschland reisen, und ihr Land ist seit 2007 Mitglied der EU.
Tatsächlich lässt sich die jüngere europäische Geschichte als wunderbare »Metamorphose der Grenzen« erzählen. Im Mai 1950 forderte der damalige französische Außenminister Robert Schuman, selbst Kind der westeuropäischen Grenzregion Lothringen, »schöpferische Anstrengungen«, um den Frieden in Europa zu bewahren. Schon im August 1950 kam es zum Grenzsturm überzeugter junger Europäer am kleinen Übergang von St. Germanshof an der französischen Grenze in der südlichen Pfalz. 300 Studenten aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Belgien und Großbritannien verbrannten hier vor den Augen von Journalisten Schlagbäume. Das Medienecho war groß. Wer allerdings damals hoffnungsvoll und 20 Jahre alt war, erlebte das Ende aller Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Deutschland 1995 erst im Rentenalter.
Doch das war nur ein Anfang. Schengen wuchs weiter, von anfänglich fünf auf heute 26 Mitglieder. Grenzposten wurden zwar nicht verbrannt, aber überall abgebaut. Mehr als 16 000 Kilometer Landgrenze in Europa wurden so zu unsichtbaren Schengengrenzen. Nun konnte man von Weil am Rhein in Baden nach Saint-Louis in Frankreich den breiten Fluss über eine neue Fußgängerbrücke überqueren, ohne Kontrolle und ohne sich ausweisen zu müssen. Am Strand der Ostseeinsel Usedom konnte man mit dem Fahrrad nach Polen fahren, ganz ohne die einst strikten Kontrollen. Im österreichischen Bregenzerwald konnte man auf einem Berg losspazieren, um nach kurzer Strecke ein unscheinbares Schild zu passieren, das, mitten im Wald, die Staatsgrenze markierte. Die Visionäre von St. Germanshof hatten sich durchgesetzt.
Das Geheimnis moderner Grenzen ist: Sie sind durchlässig, können am Ende sogar unsichtbar werden, solange Staaten eng kooperieren, gemeinsam Entscheidungen treffen und Vertrauen zwischen Gesellschaften wächst. Ist das nicht mehr der Fall, verschwindet auch die Freizügigkeit wieder. Dann gleichen Grenzen einem angegriffenen Chamäleon, das schnell sein Aussehen verändert. So auch im März 2020. Am 10. März erklärte das Robert-Koch-Institut in Berlin die französische Region am Oberrhein zum Hochrisikogebiet für Covid-19-Infektionen. Am Morgen des 18. März wurden an den Grenzen zu Frankreich wieder Grenzkontrollen eingeführt. Im Saarland blockierten Absperrgitter eine der wichtigsten Verbindungen nach Frankreich, die Europastraße 29. Viele Gemeinden, überall in der EU, fühlten sich über Nacht von ihren Nachbarn und Freunden auf der anderen Seite durch Grenzen abgeschnitten. Von Kehl im Westen bis zum bayerischen Oberndorf im Süden wachten wieder Grenzschützer darüber, wer von einem EU-Land ins andere reisen wollte.
Wächst die Angst, verhärten sich Grenzen. Wer sie wieder aufweichen will, muss die Beziehungen zwischen den Ländern verbessern. Denn die Metamorphose von Grenzen kann auch rückwärts ablaufen, und dann verwandelt sich der bunte Schmetterling wieder in eine hässliche Raupe.
So sind Grenzen der Lackmustest für zwischenstaatliche Beziehungen. Das Dreiländermuseum in der südbadischen Stadt Lörrach, ein wunderbarer Ort, erzählt dies anhand der dramatischen Geschichte der Region am Oberrhein. So gab es im frühen 20. Jahrhundert zwischen Baden und dem Schweizer Kanton Basel keine Personenkontrollen. Das schien natürlich, denn bei Basel führt die Schweizer Grenze nördlich des Rheins 18 Kilometer lang durch Weingärten, Wälder und Hügel. In der Stadt Basel lebten damals viele Deutsche, überall im Oberrheingebiet wurde ein ähnlicher alemannischer Dialekt gesprochen. Dann begann der Erste Weltkrieg. Das Fremde wurde zur Bedrohung. Zunächst wurde die Ausreise aus Baden verboten, die Grenzüberwachung übernahm das Militär. Ab November 1914 brauchte man einen Reisepass mit Visum. Der Besuch von Verwandten jenseits der Grenze erforderte Formulare. Auch nach dem Krieg blieben Kontrollen bestehen. Und kaum waren die restriktiven Grenzregelungen in den 1920er-Jahren wieder gelockert worden, griffen im fernen Berlin die Nationalsozialisten nach der Macht. Als es 1939 erneut zum Krieg kam, errichtete die Schweiz Schlagbäume an allen Grenzübergängen. Wieder kam ein Visazwang. Die Region entwickelte sich zum Schauplatz unzähliger Tragödien von gescheiterten Fluchtversuchen verzweifelter deutscher Juden. Ein Polizeibericht aus Basel vom 23. November 1938 schilderte den neuen Alltag:
»Betreffend Juden an der Grenze Riehen [Grenzdorf im Kanton Basel]
Um 21.30 Uhr waren im Polizeiposten Riehen zwei Juden und eine Jüdin und im Zollamt Riehen noch weitere zehn jüdische Personen, wovon die Hälfte weiblich, welche alle schwarz über die Grenze gekommen. Diesen wurde durch Unterzeichneten bekanntgegeben, dass durch den Tagesoffizier der Polizei verfügt wurde, dass sämtliche Personen wieder über die deutsche Grenze zu verbringen sind. Nach einigem Sträuben wurden sie nach der Grenze geführt, wo sie von deutschen Beamten in Empfang genommen wurden …
Einer der Juden weigerte sich, wieder über die Grenze zu gehen, und musste getragen werden. Ein zweiter Jude flüchtete sich, wurde jedoch durch einen Schweizer Grenzwächter eingeholt und musste ebenfalls bis zur Grenze durch Tragen transportiert werden.«[10]
1942 befahl SS-Führer Heinrich Himmler die Errichtung eines drei Meter hohen Stacheldrahtzaunes. Dieser sollte Kriegsgefangene, Deserteure und Juden daran hindern, in die Schweiz zu fliehen. Der Zaun blieb auch unter der französischen Besatzung Badens noch bis 1951 bestehen.[11]
Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis Personenkontrollen zwischen der Schweiz und Deutschland erneut aufgehoben wurden. Im Oktober 2004 unterzeichneten die EU und die Schweiz ein Abkommen zur Schengen-Assoziierung. Für die Schweizer Volkspartei (SVP), die größte Partei im Land, war dies ein Verrat an nationalen Interessen. Sie warnte vor einem Desaster, vor der »größten Bedrohung der Souveränität des Landes seit 1848«. Sie beförderte ein Trojanisches Pferd, fünf Tonnen schwer und acht Meter hoch, durch die Schweiz, als Symbol für Schengen. Ein Aktionskomitee warnte 2005: »Wir öffnen die Tür für zehntausende von Kriminellen, Illegalen, Schwarzarbeitern, Zwangsprostituierten und sogar Terroristen … Kein vernünftiger Mensch unterschreibt einen solchen Vertrag.« Doch bei der Volksabstimmung im Juni 2005 stimmten 55 Prozent für die Schengen-Assoziierung.
Dabei zeigte sich ein weiterer Grund für den Erfolg der europäischen Grenzrevolution der letzten Jahrzehnte: Um Mehrheiten davon zu überzeugen, Grenzkontrollen aufzugeben, mussten Politiker zeigen, dass dies zu mehr und nicht zu weniger Sicherheit führen würde. So erklärte der Schweizer Präsident Hans-Rudolf Merz in einer Rede im März 2009: »Schengen mag auf den ersten Blick wie die Quadratur des Kreises erscheinen: mehr Sicherheit durch mehr Freiheit.« Die Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruchs liege in der engen Kooperation zwischen Demokratien, die die Sicherheit aller erhöhen werde.[12]
So haben sich Grenzen in Europa im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrmals dramatisch verwandelt, verschwunden aber sind sie nie. »No Borders«, »Keine Grenzen«, bedeutet, zu Ende gedacht, entweder Anarchie oder ein grenzenloses Imperium, entweder das Fehlen legitimer Autoritäten oder das Fehlen nationaler Souveränität, wenn Mächte auf Grenzen keine Rücksicht nehmen und auch in anderen Ländern Gegner ermorden. Wiener Juden, die versuchten, über den alten Rhein in Vorarlberg in die Schweiz zu gelangen, wurden manchmal hinter der Landesgrenze im kleinen Schweizer Ort Diepoldsau untergebracht. Es war die Schweizer Grenze, die sie vor dem Zugriff der Gestapo schützte. Wer Schutz vor staatlicher Verfolgung sucht, sucht ihn hinter Grenzen und muss hoffen, dass diese vom Aufnahmestaat verteidigt werden.
Dagegen sind »No inhumane Borders«, »Keine inhumanen Grenzen«, ein großes und erstrebenswertes Ziel und unsichtbare Grenzen eine erreichbare Utopie. Hier ist Europa mit der visionären Grenzrevolution an seinen Binnengrenzen seit 1985 weitergekommen als jeder andere Kontinent. Nun gilt es, die Mehrheit der Europäerinnen und Europäer davon zu überzeugen, dass diese vermeintliche Quadratur des Kreises – mehr Sicherheit und mehr Freiheit – auch an den Außengrenzen der EU möglich ist.
Unmenschliche Grenzen
»Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde.«
Genfer Flüchtlingskonvention Artikel 33 (1951)
In einer Welt der Staaten wird es immer Grenzen geben. Die entscheidende Frage ist: Sind diese Grenzen unmenschlich oder menschlich, undurchlässig oder unsichtbar? Unsere Grenzen sind dabei Visitenkarten unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Sie zeigen, wer wir sein wollen. Vor allem aber zeigen sie, wer wir sind.
Der Optiker und die Ertrinkenden
Seit jenem Tag im Oktober 2013 plagt Carmine Menna ein schlechtes Gewissen. Damals fuhr der einzige Optiker von Lampedusa, der südlichsten europäischen Insel im Mittelmeer, mit seiner Frau und sechs Freunden auf der 15-Meter-Jacht eines Bekannten zur Entspannung auf das offene Meer hinaus. Sie tranken Wein, redeten und legten sich schlafen. Am nächsten Morgen hörte Menna Schreie. Er hielt sie für das Kreischen von Möwen, doch als die Jacht dem Geräusch entgegenfuhr, merkte er: Es war das Rufen Ertrinkender. Verzweifelte Menschen, die wenige Hundert Meter von der Küste Lampedusas entfernt um ihr Leben kämpften.
Es handelte sich um einen der tödlichsten Unfälle der letzten Jahre. Das Unglücksschiff hatte schon fast die 200 Meilen von Libyen nach Lampedusa zurückgelegt, bevor es in Sichtweite der Inselküste Feuer fing. Jetzt kämpften diejenigen, die dem sinkenden Schiff entkommen waren, gegen den Tod. Es gelang Menna und seinen Freunden, 47 Menschen auf ihre kleine Jacht zu ziehen. 366 Menschen ertranken, die meisten aus Ost- und Westafrika, aus Somalia, Eritrea und Ghana.
Nach der Rückkehr wehrte sich Menna dagegen, als Held gesehen zu werden. Es sei menschlich, auf Hilferufe zu reagieren, erklärte er. Tatsächlich wurde er von Schuldgefühlen überwältigt. Ein Buch, das eine britische Journalistin später über das Unglück von Lampedusa schrieb, erklärte, warum.[13] Carmine Menna hatte vor dem Unfall seine Augen vor dem Schicksal von Migranten verschlossen. Immer wieder sah er junge Afrikaner auf seiner Insel und beschloss, »nicht zu viel darüber nachzudenken«. Er entdeckte Wracks hölzerner Boote, die Menschen von Libyen auf die Insel gebracht hatten, doch dabei fiel ihm nur ein, dass er für seine Frau Sardinen kaufen sollte. Er hörte einen Bericht über ertrinkende Migranten vor der Küste Siziliens und schaltete das Radio aus. Nach dem Unfall machte sich Menna nun Vorwürfe: »Ich hatte sie jeden Tag gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen. Ich hatte ihnen nicht die Hand gereicht. Im Fernsehen, in den Zeitungen, im Radio war über sie berichtet worden. Ich hätte ihre Stimmen hören können. Aber es hatte mich nicht gekümmert.«
Doch dann erfuhr Menna etwas, das ihn erschreckte. Einer der geretteten Afrikaner erzählte, schon vor Mennas Jacht sei ein Boot vorbeigekommen, habe aber nicht angehalten. Der Bootsführer hatte sich offenbar entschieden, die Menschen ertrinken zu lassen. Menna dachte daran, was ihm sein Vater über die menschliche Natur erzählt hatte, als dessen Lehre aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs: Jeder »trägt eine verborgene Neigung zu Grausamkeit und Gleichgültigkeit im Herzen; wir alle sind zu schrecklichen Dingen fähig«. Wie die Besatzung des Schiffes, die sich in ihrer grausamen Gleichgültigkeit so verhielt, wie Menschen es oft tun: unmenschlich und feige.
Nur wenige Tage nach dem Unglück kam es zur nächsten Tragödie. Ein Fischerboot mit syrischen Familien, darunter vielen Ärzten, insgesamt 480 Personen, wurde auf offener See von Maschinengewehrsalven libyscher Milizen getroffen, die die Flüchtlinge ausrauben wollten. Das Boot bekam 61 Meilen vor Lampedusa und 118 Meilen vor Malta ein Leck. Ein syrischer Arzt, Mohamad Jammo, rief die Seenotrettungszentrale in Rom an und flehte um Hilfe, das erste Mal um 12.39 Uhr mittags: »Bitte beeilen Sie sich!« Doch obwohl andere Boote in der Nähe waren, darunter ein Patrouillenschiff der italienischen Marine in etwa eineinhalbstündiger Entfernung, blieb rechtzeitige Hilfe aus. Die italienische Militärführung gab ihrem Schiff, trotz eindringlicher Bitten auch der maltesischen Behörden, keinen Auftrag zu handeln. Nach fünf Stunden kenterte das Flüchtlingsboot. Nun, viel zu spät, wurde ein Rettungsversuch unternommen, wurden aus der Luft Schwimmwesten ins Wasser geworfen. Etwa 300 Menschen, darunter 60 Kinder, ertranken. Der Arzt, der den Hilferuf abgesetzt hatte, verlor zwei seiner Kinder.
Wenige Tage darauf erklärte die italienische Regierung den Beginn eines nationalen Seenotrettungsprogramms, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte: »Mare Nostrum«. Das Ziel: mit fünf Schiffen und drei Flugzeugen des italienischen Militärs in der Nähe Nordafrikas aktiv nach Booten mit Migranten Ausschau zu halten, um Menschenleben zu retten. Im Parlament war die Unterstützung groß. Laura Boldrini, die Präsidentin des italienischen Abgeordnetenhauses, sprach von einem humanitären »Krieg gegen das Meer«. Italien wurde damals von einer Großen Koalition regiert. Innenminister war der Sizilianer Angelino Alfano, Chef der Partei von Silvio Berlusconi. Nur die separatistische Lega Nord unter ihrem neuen Parteivorsitzenden Matteo Salvini griff die Politik der Seenotrettung an.
Begleitet wurde »Mare Nostrum« von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. 2014 wurde von der Marine ein kurzer Film dazu ausgestrahlt. Man sieht Menschen im Meer, die gegen das Ertrinken ankämpfen, Tote, die im Wasser treiben, und ein Schiff mit einem Deck voller Särge. Dann sieht man Papst Franziskus, der von einer »Schande« spricht, und das anrückende italienische Militär. Im Hintergrund hört man dramatische Musik, die an den Film Gladiator erinnert. Das Video hat eine einfache Botschaft: Das Meer ist ein humanitäres Schlachtfeld. Die italienische Marine setzt modernste Technologie und Medizin ein, um Leben zu retten. Der Clip endet mit dem Bild zweier Kinder, die ein Plakat hochhalten mit den Worten: »Thank you Italya«.[14] Im selben Jahr wurde eine siebenteilige Serie über die Retter in Uniform, Catias Wahl, im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt. Es ist die Geschichte von Catia Pellegrino, der ersten Frau als Kommandantin eines italienischen Militärschiffs. Pellegrino und ihre Männer erscheinen als Helden, Teil einer humanitären Armee von 900 Marinesoldaten, Fregatten und Korvetten, Hubschraubern, Drohnen und Suchflugzeugen.
Das italienische Militär rettete in einem Jahr, in Hunderten von Einsätzen, 82 000 Menschen und brachte sie nach Italien. Andere hinzugezogene Schiffe der Küstenwache oder Carabinieri retteten weitere 40 000. Politiker feierten ihr Militär. Im Oktober 2015, bei einem Besuch des UN-Generalsekretärs in Rom, erklärte Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi, Italien sei ein Land, in dem Soldaten auf Kriegsschiffen bei der Geburt jener Kinder assistierten, deren Mütter sie davor vor dem Tod gerettet hätten: »Auf dieses Italien sind wir stolz.«
Zwei Jahre später, im Mai 2017, stellte das italienische Magazin Espresso ein Video mit dem Titel »Der Schiffbruch der Kinder« online. Es ging um den tödlichen Unfall im Oktober 2013, bei dem der syrische Arzt Mohamad Jammo seine zwei Kinder verloren hatte: Man hört Telefongespräche zwischen maltesischen und italienischen Beamten der Seenotrettungszentralen und die zunehmend verzweifelten Bitten der syrischen Flüchtlinge um Hilfe. Es ist ein Dokument des Schreckens:
12.39 Uhr
Hallo, wir haben 300 Personen an Bord.
Sind Kinder bei Ihnen?
Etwa 100 Kinder und 100 Frauen und vielleicht 100 Männer.
Sie kommen aus Libyen, oder?
Ja, aus Zuwara. Bitte beeilen Sie sich. Das Wasser kommt rein. Bitte beeilen Sie sich. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Bitte beeilen Sie sich.
Mein Herr, bewegen Sie sich, oder stehen Sie still?
Die Wellen bewegen uns. Ich schwöre Ihnen, wir befinden uns in einer echten Notlage. Bitte, ich bin Arzt, bitte.
Was ist das Problem an Bord?
Das Boot geht unter. Ich schwöre Ihnen, im Boot befinden sich etwa zwei Meter Wasser. Am Boden.
Wie lautet Ihr Name?
Mein Name ist Mohamad Jammo. Rufen Sie einen Arzt.
Mein Herr, wiederholen Sie Ihre Position noch einmal …
Nord 34 20 18. Und Ost 12 42 05.
Okay, danke, mein Herr, danke.
13.17 Uhr
Hallo, bitte, haben Sie jemanden zu uns geschickt?
Hallo, hallo, bitte sprechen Sie, sprechen Sie.
Haben Sie jemanden zu uns geschickt? Wir sind Syrer, etwa 300 …
Mein Herr, ich habe Ihnen die Nummer der maltesischen Behörde gegeben, weil Sie sich in der Nähe von Malta befinden. Sie befinden sich in der Nähe von Malta, haben Sie mich verstanden?
In der Nähe von Malta? Sind wir in der Nähe von Malta?
Ja, mein Herr, ja.
…
13.48 Uhr
Mein Herr? Hallo, hallo.
Bitte, ich habe Malta angerufen. Sie sagten uns, dass wir näher an Lampedusa sind als an Malta. Ich habe ihnen den Standort genannt. Für uns sind Sie näher dran. Wir sterben, bitte.
Okay, Sie sind, Sie sind …
WIR STERBEN. 300 Menschen, wir sterben.
Haben Sie Malta angerufen? Haben Sie Malta angerufen?
Verlassen Sie uns nicht, unser Guthaben ist verbraucht. Wir sind ohne Guthaben, verstehen Sie mich?
Ja, ich verstehe, ich verstehe.
Wir haben kein Guthaben mehr. Das Telefonguthaben ist aufgebraucht. Es ist fast vorbei.
Ja, ja, ja, ja, ich rufe Malta an, ich rufe Malta an.
Mein Telefonguthaben geht zur Neige. Wenn Sie die Verbindung trennen, haben Sie jetzt meine Nummer, rufen Sie mich bitte an.
…
16.44 Uhr
ROM: Meine Dame, zu Ihrem letzten Fax habe ich einige Fragen an Sie. Sie wissen, dass das Kriegsschiff eine wichtige Einheit bei der Sichtung neuer Ziele im südlichen Gebiet ist. Wenn Sie wollen, dass wir ein Kriegsschiff schicken, um die Leute zu retten … dann werden wir mit unserem Kriegsschiff die Aufgabe haben, sie zur nächsten Küste zu bringen. Und ich glaube nicht, dass dies die beste Vorgehensweise ist. Denn dann hätten wir keine Einheiten in der Gegend, die in der Lage wären, die neuen Ziele auszumachen. Normalerweise …
MALTA: Okay, was ist mit der P 402? Die P 402 und dieses Schiff. Das Kriegsschiff.
ROM: Nein, eigentlich nicht P 402.
MALTA: P 402.
ROM: P 402 ist Ihr Schiff.
MALTA: Nein, P 402 ist ein italienisches Marineschiff. Ich weiß nicht, ob es Ihr Schiff ist.
ROM: Nun, wahrscheinlich ist es ein Marineschiff und kein Schiff der Küstenwache. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
MALTA: Ah, o. k., kein Schiff der Küstenwache, aber es ist das nächstgelegene. Sie verstehen, dieses Boot. Weil wir ein Flugzeug in der Gegend haben und sie die Migranten gesichtet haben, es sind ungefähr 250. Und das Boot hat anscheinend aufgehört, sich zu bewegen, und sie rufen weiter an. Sie fragen, wann das Schiff kommt. Ihr Schiff ist das nächstgelegene. Wenn Sie Ihr Schiff nicht schicken können, müssen wir sehen, was wir tun müssen. Wir haben auch einem zivilen Schiff gesagt, es solle versuchen, in das Gebiet zu fahren, aber sie sind etwa 70 Seemeilen entfernt.
17.17 Uhr
MALTA: Ich bin die diensthabende Offizierin, unser Flugzeug teilt uns mit, dass das Boot kentert, die Menschen sind im Wasser. Von dem Boot, von dem ich Ihnen erzählt habe. Die Migranten … das Boot ist gesunken.
ROM: Okay, aber ist es dasselbe Boot?
MALTA: Es kentert, die Menschen sind im Wasser. Es ist dasselbe Boot, es kentert.
ROM: Nun, ich habe bereits Anweisungen an die Nave Libra weitergegeben. Also …
MALTA: O. k., bitte sagen Sie ihnen, sie sollen sich beeilen, denn die Menschen sind im Wasser.
ROM: Sie sind im Wasser, und das Boot kentert.
17.29 Uhr
(Videoaufnahmen des gekenterten Bootes und der im Wasser treibenden und um Hilfe rufenden Menschen)
Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Gesprächsprotokolls leitete ein Untersuchungsrichter im sizilianischen Agrigento eine Untersuchung gegen italienische Militärs wegen unterlassener Hilfeleistung ein. Der Richter erinnerte an die UN-Seerechtskonvention: »Jeder Staat muss verlangen, dass der Kommandant eines Schiffes unter seiner Flagge so weit wie möglich … jedem Hilfe leistet, der in einer Notlage auf See angetroffen wird, und dabei so schnell wie möglich gefährdeten Personen zu Hilfe eilt.« Er unterstrich, dass sich das italienische Militärschiff Libra in der Nähe des gefährdeten Boots befunden hatte. Es sei »in der Lage [gewesen], beizeiten und rechtzeitig einzugreifen, um den Ertrinkungstod von 300 Personen zu verhindern, aber diese Hilfeleistung wurde nicht eingeleitet«. Unter den Beschuldigten befand sich auch die Kommandantin der Libra, die nicht rechtzeitig zu Hilfe gekommen war: Catia Pellegrino, die Heldin von »Mare Nostrum« und Catias Wahl.[15]
Was ist eine unmenschliche Grenze? Eine unmenschliche Grenze ist eine Grenze, an der Menschen in kleinen Booten, die in Seenot geraten, nicht gerettet werden. An der man Menschen, die man retten könnte, ertrinken lässt. Eine humane Grenze ist eine Grenze, an der jeder so handelt wie Carmine Menna. Hier haben wir einen Maßstab, an dem wir festhalten können. Tatsächlich beginnt damit aber erst die Suche nach der richtigen Politik, die sicherstellen kann, dass an Europas Grenzen keine Menschen sterben.
Im Sommer 2017 präsentierte Matteo Renzi, der ehemalige Premierminister, der 2015 noch so stolz auf sein lebensrettendes Militär gewesen war, ein Buch, Avanti (Vorwärts), in dem die Frage der Migration eine große Rolle spielte. Renzi forderte, Italien müsse sich in der Migrationspolitik von Schuldgefühlen befreien. Italien könne nicht alle Menschen aufnehmen, denen es schlecht gehe. Migranten sollte vor Ort, in ihrer Heimat – »in casa loro« –, geholfen werden. Es war eine Formulierung, die die Italiener kannten. Auch das Argument, dass unbegrenzte Einwanderung zu einer sozialen Katastrophe führen würde, verwendeten Politiker der Opposition seit Langem.
Renzis Argumente spiegelten die radikal neue Politik der von seiner Partei dominierten Regierung wider.[16] Italiens Innenminister, Marco Minniti, verhandelte ab Anfang 2017 intensiv mit libyschen Stammesführern und Milizen. Er wollte, dass Migranten nicht mehr von Libyen aus in See stachen – und dass Gerettete, wenn sie es doch wagten und aufgegriffen wurden, nach Afrika zurückgebracht wurden. Man belebte alte Abkommen mit Libyen aus der Zeit von Silvio Berlusconi wieder. Der italienische Geheimdienst nutzte seine Kontakte im Land. Im Sommer 2017 sank die Zahl der in Italien Ankommenden dramatisch.
Noch 2013 war es italienische Politik, bei der Seenotrettung erst einmal abzuwarten. 2014 war es italienische Politik, proaktiv zu retten. Das stieß damals auf breite Zustimmung, und die Partei von Matteo Renzi, die sich dafür eingesetzt hatte, feierte bei der Europawahl 2014 einen Triumph. Doch 2017 wurde es wieder italienische Politik, sich aus der Seenotrettung zurückzuziehen. In Umfragen 2018 sprach sich eine Mehrheit der Italiener dafür aus, Migration über das Mittelmeer möglichst ganz zu stoppen. Und im Juni 2018 wurde jener Politiker, der sich seit Jahren am schärfsten gegen die Seenotrettung ausgesprochen hatte, Matteo Salvini, Innenminister. Vor allem aufgrund seiner harten Politik war er immens populär. Was war geschehen? Was erklärt derart starke Schwankungen? Hatte die italienische Gesellschaft in wenigen Jahren ihre Empathiefähigkeit verloren?
Im Herbst 2013 erklärte Enrico Letta, der damalige italienische Ministerpräsident, es sei nicht hinnehmbar, dass das Mittelmehr zum »Todesmeer« werde. Seenotrettung bis vor die Küste Libyens im Rahmen der Operation »Mare Nostrum« sollte das Sterben im Mittelmeer verhindern. Die Mission begann im Oktober 2013 und dauerte zwölf Monate. Bis heute wird »Mare Nostrum« von vielen als Sternstunde empathischer europäischer Politik gelobt. Manche wollen sogar europäische Politiker vor Gericht bringen, weil sie sich im Herbst 2014 dafür eingesetzt haben sollen, dass Italien die Operation nicht verlängerte. Allerdings starben in der zweiten Hälfte dieser Operation, von Mai bis Oktober 2014, als Catia Pellegrino und ihre Männer von einem Kamerateam begleitet wurden, laut der Internationalen Organisation für Migranten (IOM) 3029 Menschen auf dem Meer zwischen Nordafrika und Italien. Damit wurden diese sechs Monate zum tödlichsten Halbjahr in Friedenszeiten in der Geschichte des zentralen Mittelmeeres. Nie zuvor waren hier so viele Menschen in sechs Monaten ums Leben gekommen.
Im Oktober 2014 wurde »Mare Nostrum« durch eine kleinere EU-Mission ersetzt, die Seenotrettung nicht mehr als ihre Hauptaufgabe definierte. In den sechs darauffolgenden Monaten starben weiterhin Menschen – insgesamt 1704, davon fast die Hälfte bei einem einzigen Unfall im April 2015. Direkt nach dem Unglück erklärte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, diese Toten seien das Resultat »eines monumentalen Mangels an Mitgefühl«.[17]
Die EU berief einen Sondergipfel ein. Die Kommission entwarf eine Strategie. In den deutschen Medien wurde das Ende von »Mare Nostrum« 2014 im Nachhinein als ursächlich für den Unfall beschrieben. Bild zitierte den deutschen Verein Pro Asyl: »Auf die italienische Großtat folgt nun Europas Schande!«[18] Und prangerte die Kälte von Beamten in Brüssel an, die im November 2013 geschrieben hatten, dass es einen »kontraproduktiven Pull-Faktor« geben könne. Bild schrieb: »Klartext des eiskalten EU-Diplomaten-Kauderwelschs: Wenn wir Flüchtlinge aus Seenot retten, führt das nur dazu, dass noch mehr in See stechen.« Der Spiegel schrieb im April 2015 über eine »Chronik einer angekündigten Katastrophe«. Und weiter: »Die Frage, wer Schuld hat am Tod so vieler Menschen und wer welchen Teil der Verantwortung trägt, ist nicht leicht zu beantworten. In jedem Fall führt sie auch in die Hauptstädte Europas.«[19] Im April 2015 sprach Innenminister de Maizière im Bundestag von Bildern, die sich »in unsere Herzen eingebrannt« hätten. Er betonte: »Seenotrettung ist das Erste, Wichtigste und Dringlichste, was unverzüglich beginnen muss.«
Überall wurde nun mehr Seenotrettung gefordert. Dazu wurde auch eine neue EU-Mission – später Sophia genannt – ins Leben gerufen. So kehrte eine Koalition europäischer Staaten im April 2015 zum Ansatz von »Mare Nostrum« zurück. In den darauffolgenden zwei Jahren befanden sich die meisten Seenotretter in der Geschichte des Mittelmeers vor Libyen, koordiniert von der Seenotrettungsleitstelle in Rom, eine Armada aus italienischen und europäischen, staatlichen und privaten Booten. Die Zahl der Boote zwischen Libyen und Italien wuchs schnell. Noch nie gab es so viele Rettungsschiffe und so viele von der italienischen Küstenwache koordinierte Rettungsaktionen, allein 2016 wurden mehr als 181 000 Menschen nach Italien gebracht. Und erneut scheiterte die Strategie zur Verhinderung von Toten.
Die Zahl der Ertrunkenen erreichte einen tragischen Höchststand: Neben das tödlichste Halbjahr von Mai bis Oktober 2014 traten das tödlichste Jahr 2016 mit 4581 Toten und die tödlichsten zwei Jahre von Mai 2015 bis April 2017.
Tote im zentralen Mittelmeer pro Monat 2014 – 2019 [20]
Januar
0
67
90
225
215
152
Februar
9
336
7
217
121
6
März
1
53
258
300
23
56
April
50
1480
611
279
20
52
Mai
329
95
1130
621
11
65
Juni
314
5
388
529
564
27
Juli
839
206
208
68
157
301
August
616
652
40
143
19
167
September
813
76
341
102
130
19
Oktober
118
163
431
167
7
91
November
18
8
703
193
24
279
Dezember
58
8
374
9
23
47
Gesamt
3165
3149
4581
2853
1314
1262
Die zweite Hälfte von »Mare Nostrum« war von Mai bis Oktober 2014. Die Politik des neuen Innenministers der Großen Koalition in Rom reduzierte Abfahrten aus Libyen und Tote ab Juli 2017. Matteo Salvini wurde im Juni 2018 Innenminister.
Aus diesen Zahlen folgt eine offensichtliche Erkenntnis: Je mehr Menschen sich in klapprige Holz- und Schlauchboote setzten, desto mehr Menschen starben. Manche fürchteten, diese Erkenntnis werde in eine Rechtfertigung dafür münden, Menschen ertrinken zu lassen. So kam es zu immer komplizierteren Argumenten, die die absoluten Zahlen von Toten durch Prozente ersetzten. Zu Ende gedacht, liefen sie darauf hinaus, es wäre besser, 100 von 1000 Menschen würden im Mittelmeer ertrinken als 2 von 4, denn im ersten Fall wären nur 10, im zweiten 50 Prozent der Aufgebrochenen gestorben. Doch diese Argumente überzeugten immer weniger Menschen in dem Land, das sich jahrelang für Seenotrettung eingesetzt hatte wie kein zweites: Italien. Nun verstummten viele Politiker. Salvini, der seit Jahren jede Form von Rettung, staatlich oder privat, außerhalb von Italiens Rettungszone bekämpft hatte, stieg zum einflussreichsten Politiker des Landes auf. Bei der Europawahl im Mai 2014 hatte Salvinis Lega nur 6 Prozent der Stimmen gewonnen. Im März 2018 erreichte sie bei Parlamentswahlen 17 Prozent. Im Juni wurde Salvini in Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung Vizepremier- und Innenminister. Am 10. Juni erklärte er auf Twitter Italiens Häfen für alle Seenotretter für geschlossen. Einen Tag später lobte er im Senat in Rom seinen Vorgänger als Innenminister, Marco Minniti, der 2017 die Kooperation mit Libyen erneuert hatte, und bekundete sein Mitgefühl für junge Afrikaner, die von Menschenhändlern missbraucht wurden. Die NGOs, die sich für Seenotrettung eingesetzt hätten, sagte er in Interviews, hätten das Problem im Mittelmeer verschärft: »Ich würde dieses Konzept gern in Ruhe den Menschen erklären, die ja nicht unbedingt immer aus böser Absicht in diesem Bereich engagiert sind. Wenn ihr aber hingeht, um sie abzuholen, provoziert ihr weitere Abfahrten. Wenn ihr weitere Abfahrten provoziert, steigert ihr die Gewinne der Menschenhändler. Wenn die Schmuggler mehr Geld haben, können sie sich mehr Waffen und Drogen beschaffen. Und hauptsächlich wird es mehr Tote auf See geben. Hingegen haben sich die Todesfälle im Mittelmeer inzwischen, seitdem im Innenministerium der ach so schlimme Salvini sitzt, drastisch verringert.«[21]
Immer mehr Italiener stimmten ihm zu. Im Juli 2018 war Salvini laut einer in der italienischen Tageszeitung Il Giorno veröffentlichten Umfrage bereits der beliebteste Minister in Italien. Im selben Monat hob Salvini bei der jährlichen Kundgebung seiner Partei im norditalienischen Pontida nationalistische Anti-Immigrations-Parteien in ganz Europa hervor. Er lobte die Französin Marine Le Pen und den Ungarn Viktor Orbán, aber auch Donald Trump und Wladimir Putin, und kündigte europäische Ambitionen an: »Ein internationales Bündnis von Populisten. Ich werde die Hauptstädte bereisen, und nicht nur die europäischen, um eine Alternative zu diesem Europa zu schaffen, das auf Ausbeutung … und Masseneinwanderung beruht.«[22] Salvinis Lega überholte sowohl die Demokratische Partei von Matteo Renzi als auch die Protestpartei Fünf Sterne und wurde bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 mit 34 Prozent zur stärksten Partei Italiens. Und auch als Salvini sein Amt im August 2019 wieder verlor, blieb seine Partei die beliebteste Partei des Landes.
Wie kam es zu dieser radikalen Wende in der italienischen Debatte über Seenotrettung? Tatsächlich hatte es seit 2013 in ganz Europa eine Diskussion mit zwei scheinbar unversöhnlichen Positionen gegeben. Die eine: Es gibt keinen Pull-Faktor. Rettungsboote reduzieren die Zahl der Toten, weil jedes Schiffbrüchige vor dem sicheren Tod rettet. Dadurch ertrinken weniger Menschen. Die andere: Rettung schafft einen Pull-Faktor. Man solle die Zahl der Rettungsboote reduzieren, dann würden sich weniger Menschen in Boote setzen, die gar nicht imstande seien, Italien oder Malta zu erreichen. Dadurch würden weniger Menschen ertrinken. Doch beide Positionen sind irreführend.
Die Vorstellung, erst die Seenotrettung habe zu Toten geführt, war offensichtlich falsch. Zu viele Tote hatte es schon lange vor »Mare Nostrum« gegeben. Doch die gegenteilige Idee, man müsse vor allem mehr Seenotretter losschicken, um Menschenleben zu retten, war nun ebenfalls diskreditiert. Tatsächlich hielt auch die italienische Regierung, die nach dem Rücktritt von Matteo Salvini ins Amt kam, an der Kooperation mit Libyen und der ablehnenden Politik gegenüber der Seenotrettung fest.
Mit welcher anderen Politik hätten Italiens und Europas Politiker auf die Unfälle 2013 und 2015 reagieren können, sodass tatsächlich weniger Menschen ertrinken? Auch der Optiker Carmine Menna stellte sich angesichts der Toten, die ihn im Traum verfolgten, diese Frage: »Er wusste, dass Europa nicht jeden einzelnen Menschen willkommen heißen konnte, der sich ein besseres Leben wünschte, doch zu diesem Schlamassel musste es eine Alternative geben. Von seiner Internetrecherche wusste er, dass die meisten Eritreer, die in Europa ankamen, automatisch Asyl erhielten … Warum also zwang man sie dazu, diese tückische Reise zu unternehmen? Es war wie ein teuflisches Ausleseverfahren: Meistere diesen tödlichen Hindernislauf und zack! hast du dir einen Platz im Paradies verdient.«[23] Eine unmenschliche Grenze ist eine, an der Menschen Seenotrettung verweigert wird. Es ist eine, an der jedes Jahr Tausende ertrinken. Und es ist eine, die Flüchtende zu einem tödlichen Hindernislauf zwingt.
Die Schweizer Grenze und Refoulement
Die europäische Diskussion über Grenzen wird seit Jahren von populären Trugschlüssen bestimmt, von Wahrnehmungen, die oberflächlich plausibel klingen, aber nicht plausibel sind. Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert hat sie als Idées reçues bezeichnet, als formelhafte Klischeevorstellungen. Ihre Dominanz wird gefördert durch die Angewohnheit, Flucht und Migration als Phänomene in der Sprache der Physik und Hydraulik zu beschreiben: Da geht es um Pull- und Push-Effekte, um Dämme, die Ströme stoppen, und um biblische Fluten, so stark, dass ihnen kein Damm gewachsen ist. Aus diesen Bildern erwächst ein weit verbreitetes Klischee, das sich viele derjenigen zu eigen machten, die Migrationskontrolle als unmoralisch ablehnen. Sie erklären, dass solche Kontrollen von vornherein zum Scheitern verurteilt seien. Sei der Druck zur Flucht und Abwanderung erst einmal groß genug, sei das Überschreiten von Grenzen nicht mehr zu verhindern.
2016 schrieb der britisch-polnische Soziologe Zygmunt Bauman einen Essay über Migration und Panikmache. Er prophezeite, dass die derzeitige Massenmigration »nicht so bald zum Stillstand kommen« werde, denn sie sei das Resultat globaler Ungleichheiten. Die Weltbevölkerung verhalte sich, so Bauman, »wie eine Flüssigkeit in kommunizierenden Röhren«. Die Zahl der Immigranten steige, bis ein Gleichgewicht erreicht sei und sich die Wohlstandsniveaus in den »entwickelten« und den »in Entwicklung befindlichen« Teilen der globalisierten Welt angeglichen hätten.[24] Daher sei die Errichtung von Mauern zur Abwehr von Migranten »lächerlich«, man brauche es erst gar nicht versuchen. Auch der Autor Sascha Lobo argumentierte jüngst so: »Migration wird weder mit Gewalt noch mit Geld gestoppt werden können … Migration ist unaufhaltsam, auch deshalb, weil sie heute mit der Kraft der Vernetzung geschieht.«[25] Auch Rechte und Rechtsextreme, so Lobo, würden daran scheitern. Sie »setzen auf Abschreckung, Zäune und Gewalt. Aber auch das ist – neben todbringender Menschenfeindlichkeit – ein Trugschluss. Die Wahrheit ist, Migration lässt sich nicht verhindern, auch nicht gewaltsam.«[26]
Die politische Botschaft hinter solchen Analysen ist eindeutig: Glaubt nicht den Festungsbauern, die Abschottung versprechen, denn diese ist unmöglich. Das Wünschenswerte, offene Grenzen, ist auch das migrationswissenschaftlich erwiesenermaßen Unvermeidliche. Denn, so Lobo 2019: »Mehrere Millionen Menschen haben einen regelrechten Ring des Migrationsdrucks rund um Europa entstehen lassen.« Diesem Druck könne kein Staudamm widerstehen.
Das Problem an diesem Bild ist: Es ist falsch. Es beruht auf Wunschdenken. Und es lenkt so von der Herausforderung ab, zu humanen Grenzen zu gelangen. Denn entschlossene Grenzkontrolle kann funktionieren. Nicht technisches Unvermögen oder irgendein Naturgesetz der Migrationsphysik hält Regierungen davon ab, größere Migrationsbewegungen zu stoppen, sondern ihre Werte und die Interessen, die sie verfolgen.
Genau das zeigte sich in tragischer Weise vor etwa 80 Jahren mitten in Europa. Damals spielte sich an den Grenzen der Schweiz eines der großen Flüchtlingsdramen der europäischen Geschichte ab. Im Jargon der heutigen Migrationsliteratur bestand in den Nachbarländern der Schweiz in jenen Jahren ein hoher, kaum zu steigernder »Migrationsdruck«. Es gab viele Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, um ihr Leben zu retten: Juden und Roma, aber auch verfolgte politische Gegner der Nationalsozialisten, sexuelle Minderheiten und Glaubensgemeinschaften. Zwischen 1938 und 1945 versuchten Schutzsuchende, heimlich die Schweizer Landesgrenze zu überqueren, da ihnen die legale Einreise verweigert wurde. Zehntausende wurden abgewiesen und zurückgeschickt. Für viele bedeutete dies den Tod.
Im März 1938 brach nach dem »Anschluss« Österreichs eine Orgie der Gewalt über die Wiener Juden herein, mit Verhaftungen, Enteignungen und alltäglichem Terror.[27] Der deutsche Schriftsteller Carl Zuckmayer, der damals in Wien lebte, war fassungslos angesichts der Zerstörungswut, die er als einen »Hexensabbath des Pöbels und ein Begräbnis aller menschlichen Würde« beschrieb. Zuckmayer tat das offensichtlich Vernünftige und floh binnen weniger Tage mit dem Zug in die Schweiz.