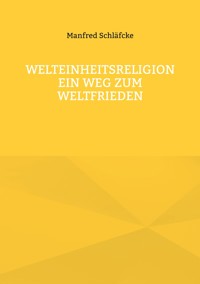
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Alle historischen Religionen enthalten - wie der Dalai Lama erkannt hat - Überlieferungen, die zu Kriegen geführt haben. Daher bedürfen sie alle dringend der weiteren Aufklärung im Sinne Kants. Geht man diesen Weg kritisch und selbstkritisch konsequent voran, dann arbeitet man auf eine Welteinheitsreligion hin, die auf dem Liebesgebot beruht und alle Menschen spirituell verbinden kann. Nur so kommt man dem Religionsfrieden näher, ohne den der Weltfrieden eine Utopie bleibt. Der Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen ist ein aktuelles Alarmzeichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Liebe
2 Schuld
3 Vergebung
4 Gottes Kinder
5 Der historische Jesus
6 Das veraltete Weltbild
7 Politische Aufgaben
8 Die religiöse Aufgabe
Literaturhinweise
Vorwort
Durch die modernen Kommunikations- und Verkehrsmittel sind die Menschen verschiedener Kulturkreise einander immer näher gerückt. Menschen, die aus ihrem Kulturkreis in einen anderen emigrieren, erleiden nicht selten einen
„Kulturschock“ , so zum Beispiel traditionelle Muslime, die sich in einem westeuropäischen Land mit der Vermarktung des weiblichen Körpers in der Werbung oder mit Pornoheften im Bahnhofskiosk konfrontiert sehen und mit Erschrecken registrieren, welche Freiheiten jungen Mädchen gewährt werden oder welche negativen Folgen der Konsum von Alkohol haben kann, der dem Moslem durch den Koran und in seinem Herkunftsland oft auch durch die staatliche Gesetzgebung verboten ist.
Was individuell schon Probleme mit sich bringt, wirkt sich viel schlimmer aus, wenn große Gruppen sich kulturell, und das heißt meistens auch religiös, unterscheiden, nahe beieinander leben und meinen, ihre Lebensweise sei die beste oder gar die einzig richtige, die man dem anderen aufzwingen darf oder sogar soll. Es entstehen aus kulturellen Unterschieden und Gegensätzen dann leicht Konflikte und Gewalttätigkeiten, heilige Kriege, Kreuzzüge,Völkermord, Ketzerverfolgungen, Konfessionskriege. Manch einer befürchtet auch für die Zukunft einen Kampf der Kulturen (vgl. Literaturhinweise: Huntington). Mancher meint, wir befänden uns bereits in einem derartigen Kampf (vgl. Literaturhinweise: Ulfkotte). Führende Vertreter der Religionsgemeinschaften haben zumindest die Gefahren erkannt. Sie fordern einen Dialog zwischen den Religionen bzw. Konfessionen mit dem Ziel, einander besser zu verstehen, eventuelle Vorurteile abzubauen und Gemeinsamkeiten herauszufinden. Man hofft auf diesem Wege des „interreligiösen Dialogs“ dem Ziel eines Friedens zwischen den Religionen näher kommen und damit einen Beitrag zum Weltfrieden leisten zu können (vgl. Literaturhinweise: Küng).
Diese Bemühungen, meist durch Begegnungen von führenden Amtsträgern der Religionsgemeinschaften vorangetrieben, hatten jedoch auch ihre Grenzen. Denn viele im Zusammenleben störende Unterschiede und wesentliche, konfliktträchtige Gegensätze konnten dabei nicht ausgeräumt werden.
Der Verfasser des folgenden achtteiligen Essays hat neben Germanistik und Philosophie evangelische Theologiestudiert, hat sich während seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer an Gymnasien auch mit den sogenannten
„Fremdreligionen“ (Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Bahai-Religion) gründlicher beschäftigt und ist über lange Jahre zu der Auffassung gelangt, dass die Anhänger aller Religionen auch zentrale Dogmen ihrer eigenen Religion aufgeben müssen, wenn sie ernsthaft den religiösen Frieden wollen.
Ein katholischer Christ müsste sich zum Beispiel von dem Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes und den Mariendogmen verabschieden, ein Protestant von der Lehre, Jesus habe für die Sünden seiner gläubigen Anhänger den Tod am Kreuz erlitten, ein Jude z.B. von dem Glauben, das „Heilige Land“ Palästina von der Mittelmeerküste bis über den Jordan nach Osten in den Staat Jordanien hinein (auch die Gebiete der Stämme Ruben, Gad und Halb-Manasse) stehe allein dem jüdischen Volk als sein eigenes von Gott verheißenes Land zu, ein Moslem z.B. vom Anspruch, die Scharia gelte für alle Menschen und müsse zur Not mit Gewalt durchgesetzt werden, ein Bahai z.B. von dem Dogma, das Kitab i Aqdas (das „Heiligste Buch“) sei die offenbarte gesetzliche Grundlage für ca. tausend Jahre, ein Hindu von der Kastenordnung und ein Buddhist z.B. von der Lehre, die eigene leidvolle Existenz sei zum Teil durch eigene Übeltaten während der eigenen vorigen Existenz verschuldet.
Der interreligiöse Dialog sollte als Ziel eine Welteinheitsreligion anstreben, in der der Kern aller Religionen, das Liebesgebot, die Grundlage ist und in der die vielen religiösen Irrtümer der historischen Religionen nicht mehr enthalten sind. Dieser Weg ist sicher für sehr viele Menschen mit Abschiedsschmerzen verbunden, aber er wird belohnt mit einer neuen spirituellen Freiheit und dem zunehmenden Bewusstsein, dass alle Menschen im Geiste der Liebe und des Friedens verbunden werden können. Ein Kampf der Kulturen lässt sich am ehesten vermeiden, wenn der Weg der religiösen Kritik und Selbstkritik vernunftgemäß konsequent zu Ende gegangen wird. Hierzu soll der folgende Essay mit Blick auf das Christentum ein Beitrag sein.
Manfred Schläfcke
Liebe
Ansatzpunkt meiner Überlegungen, die der Aufklärungsbewegung verbunden sind, liegt in der Ethik, genauer gesagt, im Liebesgebot:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“(Mt 19,19)
Der deutsche Begriff „Liebe“ ist mehrdeutig. Die alten Griechen waren etwas besser dran, denn statt des einen Wortes „Liebe“ hatten sie zwei Begriffe: Eros (die begehrende Liebe) und Agape (die wohlwollende, tätige, dienende Liebe)1.
Dort, wo im Neuen Testament das Liebesgebot steht, ist im griechischen Urtext immer von Agape die Rede. Und so muss auch das ins Deutsche übersetzte Liebesgebot verstanden werden.
Das Liebesgebot lautet nicht: Liebe deinen Nächsten, nicht aber dich selbst. Dieses wäre die Forderung extremer Selbstlosigkeit (Altruismus). Selbstliebe wird im Liebesgebot als selbstverständlich vorausgesetzt und als gut angesehen, allerdings nicht als oberster Grundsatz unseres Handelns. Denn dann würde ich nur mich selbst lieben (Egoismus).
Das Liebesgebot fordert von uns, einen Mittelweg zu gehen, nämlich unserem Nächsten ebenso wohlgesonnen zu sein wie uns selbst und danach zu handeln (Humanismus).2 Wenn z.B. jemand in Not ist, wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lk 10,29-37) der am Straßenrand liegende, von Räubern halbtot geschlagene Mann, muss ihm geholfen werden. Der Samariter tut das, was er sich anstelle des hilfsbedürftigen Mannes selbst wünschen würde, er leistet erste Hilfe, nimmt auf seinem Reittier den Mann mit in die nächste Herberge und pflegt ihn. Am darauffolgenden Tag seiner Weiterreise überlässt er die Pflege dem Wirt und übernimmt die dadurch entstehenden Kosten.
Der Nächste





























