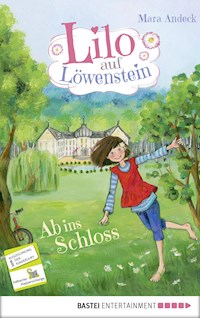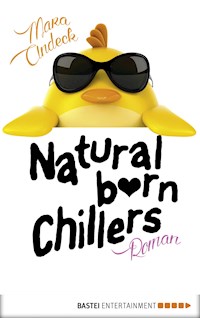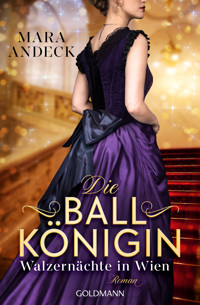9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie heißt Liebe auf Finnisch?
Tess ist genervt: Gerade hat sie noch von den perfekten Sommerferien mit Sonne, Stränden und Jungs geträumt, da machen ihre Eltern ihr einen Strich durch die Rechnung: Sie wollen umziehen - und ab sofort mit Opa, Cousin, Onkel und Tante sowie deren vier Nervensägen einen auf Großfamilie machen. Da ist Chaos vorprogrammiert. Tess ist schon dabei, sich auf unschlagbar öde Ferien einzustellen, da bahnt sich plötzlich eine süße Überraschung aus dem Norden an. Vielleicht steht Tess ja doch noch ein glitzernder Sommer bevor ...
Leicht, witzig und zum Mitschmachten schön: Mara Andecks Jugendbuch "Wenn das Leben dich nervt, streu Glitzer drauf"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Motto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Danke
Über die Autorin
Mara Andeck hat bei Boje bereits die beliebte Trilogie rund um Lilia und das Sachbuch Liebe in echt veröffentlicht. Als gelernte Wissenschaftsjournalistin geht sie den Dingen gerne auf den Grund, das gilt insbesondere für das Phänomen Liebe. Doch auch das Thema Großfamilie ist ihr nicht fremd, immerhin lebt sie in engem Kontakt zu vielen Verwandten – und die Treffen in großer Runde sind jedes Mal bemerkenswert. Die Autorin wohnt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf bei Stuttgart.
MARA ANDECK
Wenn das Leben dich nervt, streu Glitzer drauf
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2015 by Boje-Verlag in Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: © plainpicture/Anja Weber-Decker; © shutterstock/pockygallery
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-1348-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Verrückt sein in New York? Pfff, kann ja wohl jeder. Aber leb mal hier bei uns ein ganz normales Leben. Das ist eine echte Herausforderung. Glaubst du nicht? Na, dann lies selbst!
Tess
Theresa Walter
Fichtenstraße 70
60322 Frankfurt
An das Hessische Kultusministerium
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden
26. Mai
Betreff: Schulunterrichtszeiten
Sehr geehrte Frau Ministerin,
sehr geehrte Damen und Herren,
bestimmt wissen Sie, dass viele Jugendliche spät ins Bett gehen und morgens nur schwer aus den Federn kommen.
Und bestimmt denken Sie, das läge daran, dass wir abends ewig vorm Computer oder Fernseher oder auf Partys rumhängen und deswegen morgens nicht ausgeschlafen sind. Das stimmt aber nicht.
Na gut, es stimmt teilweise schon. Aber wir können nichts dafür. Jugendliche haben nämlich von Natur aus einen anderen Schlafrhythmus als Kinder und Erwachsene. Sie können abends nicht früh einschlafen und morgens nicht früh aufstehen, selbst wenn sie es wollen. Das ist wissenschaftlich bewiesen.
Und es ist seit der Steinzeit so. Die Jugend ist nämlich die Lebensphase, in der Menschen körperlich am fittesten sind. Bei den Höhlenmenschen hatten Jugendliche deswegen den härtesten Job in der ganzen Horde: Sie waren Nachtjäger. Bei Anbruch der Dunkelheit wurden sie aktiv, gingen auf die Pirsch und erlegten Höhlenbären für den ganzen Stamm. Und morgens haben sie dann natürlich ausgeschlafen.
Tja, und obwohl das inzwischen lange her ist, hat sich das Gehirn von Jugendlichen immer noch nicht umgestellt. So was dauert eben einfach.
Das habe ich mir nicht ausgedacht, das stand in der Zeitung! Ich möchte Sie daher bitten, die Unterrichtszeiten an den Schulen ab der achten Klasse auf frühestens neun Uhr zu verlegen. Allerfrühestens. Besser wäre zehn. Jedes Wort, das man vorher an Jugendliche richtet, ist reine Zeitverschwendung und frustrierend für alle Beteiligten.
Mit freundlichen Grüßen
Theresa Walter, 14, müde
1
Vor ungefähr einem Jahr, an einem sonnigen Tag im Mai, saß ich zufrieden in meinem Zimmer und häkelte Topflappen.
Ja, echt. Ich thronte im Schneidersitz auf meinem Bett, und zwischen meinen Fingern entstand ein gelb-rosa geringelter Lappen mit Aufhängeschlaufe. Und das, obwohl vor mir auf der Bettdecke bereits drei dieser Schlabberlappen lagen – allesamt made by me, einer scheußlicher als der andere.
Zufrieden war ich in diesem Moment, weil ich gerade einen Brief geschrieben hatte, der die Welt für Tausende von Jugendlichen ein bisschen lebenswerter machen sollte. Und ich häkelte aus einem ähnlichen Grund. Ich wollte damit ein bestimmtes Teenieleben ein bisschen lebenswerter machen – meins nämlich.
Häkeln? Lebensverändernd? Das leuchtet vielleicht nicht auf den ersten Blick ein, aber ich kann es erklären: Meine Eltern und ich, wir befanden uns damals in einer ganz klassischen Erziehungs-Situation: Ich hatte eine Idee. Sie hatten was dagegen. Und um einen Ausweg zu finden, musste ich diesmal eben häkeln.
Jeder, der selbst mal Eltern hatte, kennt die Regel: Versuche nie, deine Eltern zu verstehen. Es ist nicht möglich. Sie handeln grundsätzlich nicht nach den Gesetzen der Logik, und man kann ihre Gründe auch nicht nachvollziehen.
Trotzdem weiß jeder, der mal prägende Jugendjahre mit Eltern verbracht hat, wie leicht sie zu berechnen und zu lenken sind. Man muss nur zwei Grundregeln kennen.
Erstens: Eltern wollen niemals, dass du das tust, was du gerade tust. Und zweitens: Sie wollen immer, dass du tust, was du gerade nicht tust.
Mal an einem konkreten Beispiel: Angenommen es ist Sommer, es ist heiß, und du gehst ins Freibad. Was werden deine Eltern sagen? Richtig! »Solltest du nicht lieber …« Und dann kommen Vorschläge wie Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen oder dein Zimmer aufräumen.
Aber mal angenommen, es ist heiß, du räumst dein Zimmer auf, machst Hausaufgaben und lernst Vokabeln. Wetten, dass dann irgendwann die Tür aufgeht, ein Elternteil den Kopf hereinstreckt und fragt: »Sag mal, solltest du bei dem schönen Sonnenschein nicht lieber ins Freibad gehen und dich mit deinen Freunden treffen? Als ich in deinem Alter war, habe ich immer …«
Ja, so sind sie. Und so kriegt man sie auch rum, wenn man etwas von ihnen will. Man darf nicht nach dem Warum fragen, man muss ihr Verhalten einfach einplanen.
Und genau das tat ich an jenem sonnigen Häkel-Nachmittag im Mai. Ich hatte nämlich ein paar Tage zuvor den Plan gefasst, die Sommerferien mit meiner besten Freundin Jojo in einem coolen Jugendzeltlager in Spanien zu verbringen.
Und wenn ich jetzt erzähle, dass meine Eltern mich dafür zu jung hielten, wird jeder, der mal Eltern hatte, verstehen, warum ich kurzerhand zur Häkelnadel griff und wie früher im Kindergarten hässliche, geringelte Lappen herstellte. Denn dafür war ich mit fast fünfzehn definitiv zu alt.
Es konnte nicht mehr lange dauern, dann würden sie kommen und mir altersgemäße Freizeitbeschäftigungen vorschlagen, die ich natürlich ausschlagen musste, egal wie himmlisch sie klingen mochten. So lange, bis sie sich Sorgen machen würden, abends im Wohnzimmer über mich sprechen und über einen Besuch bei einem Psychologen nachdenken würden.
Irgendwann würden sie dann weich werden und nach jedem Strohhalm greifen, der sich ihnen bot. Und das war der Moment, in dem ich die Sommerferien wieder ins Gespräch bringen musste.
Natürlich würde ich Spanien nicht mehr erwähnen. Bloß nicht! Das wäre viel zu durchschaubar. Ich würde stattdessen so tun, als hätte ich nur noch Häkeln im Kopf. Zum Beispiel könnte ich laut darüber nachdenken, wie viel Wolle man für sechs Wochen Ferien benötigte. Ja, das war gut! Sie würden erbleichen und mir tolle Reisevorschläge machen. Alles würde ihnen recht sein – alles außer Häkeln. So weit die Theorie.
Und sie funktionierte. Tatsächlich streckten an diesem Nachmittag beide mehrfach ihren Kopf in mein Zimmer. Tatsächlich sprachen sie abends im Wohnzimmer über mich. Und was ich hörte, als ich leise barfuß an die Tür schlich und lauschte, klang wirklich so, als müsste ich nicht mehr lange Quadrate in Rosa und Gelb häkeln.
»Tess wird langsam schrullig«, sagte mein Vater.
»Ja, sie entwickelt typische Einzelkind-Marotten«, seufzte meine Mutter. »Sie ist zu viel allein, sie kreist nur um sich selbst, sie ist altklug, wunderlich und zieht sich von der Außenwelt zurück. Da läuft was falsch.«
Draußen vor der Tür nickte ich heftig. Genau das sollten sie denken.
»Sie muss hier raus.« Das kam wieder von meinem Vater. »Sie braucht eindeutig mehr Leben, mehr Abwechslung. Ich glaube, wir denken da in die richtige Richtung. Für Tess ist ein Tapetenwechsel das Beste.«
Ich hatte genug gehört, die beiden waren auf der richtigen Spur.
Zuversichtlich kroch ich in mein Bett und träumte von weißen Stränden, blauem Meer, braun gebrannten Jungs und grenzenloser Freiheit.
Umso härter traf mich die Eröffnung, die mir meine Eltern am nächsten Tag beim Frühstück machten.
»Was ich dir jetzt sage, wird dein Leben verändern«, verkündete meine Mutter. Sie trug ein Nachthemd mit einem aufgestickten Schaf, das einen merkwürdig starren Blick hatte. Sah so jemand aus, der Menschenleben veränderte?
Na gut, vielleicht. Aber warum sagte sie dann nichts? Warum überbrachte sie mir die Jubelnachricht nicht? Sie hatte es doch gerade groß angekündigt, aber stattdessen blickte sie nur hilfesuchend meinen Vater an.
Der wirkte noch total verschlafen, und seine Augen erinnerten mich an die vom Nachthemdschaf. »Jaaa«, sagte er gedehnt, als ob er Zeit schinden wollte. »Wir haben gemerkt, dass es dir zurzeit nicht so gut geht, und da hatten wir eine Idee.« Er zögerte, und ich sah ihn aufmunternd an. »Du brauchst einen Tapetenwechsel.«
Ich nickte. Obwohl meine Eltern sich seltsam zögerlich verhielten, war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht misstrauisch. Ich war nur überrascht, dass ich sie so schnell rumgekriegt hatte. Und ich fand das fast schade, denn ich hatte noch richtig viel Wolle übrig.
Jetzt verschränkte mein Vater die Arme vor der Brust, als müsse er sich gegen etwas wappnen. »Wir ziehen um«, stieß er hervor.
Moment! Hatte er das echt gesagt? Ich verschluckte mich vor Schreck an meinem Müsli. Am liebsten hätte ich die Stelle zurückgespult und noch mal angehört. Das konnte er doch nicht wirklich gesagt haben, oder?
Hatte er aber. »Wir ziehen in eine schöne, große Altbauwohnung, ganz in der Nähe«, erklärte er und strahlte mich an.
Schock! Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich reagierte mit Panik, und mein Gehirn ratterte wie eine kaputte Häkelmaschine. Aber dann beruhigte ich mich wieder. Umzug? Okay, Umzug. Eigentlich war das ja nicht schlimm. An meinen Reiseplänen würde sich nichts ändern, und eine Verschlechterung würde die neue Wohnung garantiert nicht sein. Warum sollten die beiden den Umzug sonst planen? Vielleicht würde ich sogar ein größeres Zimmer bekommen, mit eigenem Bad, das wäre genial. Also gut, wenn es meinen Eltern wichtig war, dann sollten sie von mir aus die Tapete wechseln. Dann würde ich eben ein paar Häuser weiter vor mich hin häkeln, so what?
Mein Spanien-Plan würde trotzdem klappen, da war ich mir sicher.
Noch.
Aber jetzt rückte meine Mutter mit der ganzen Wahrheit raus. »Und was das Beste ist«, verkündete sie und machte eine Pause, in der ich locker eine ganze Reihe Häkelmaschen an einem Topflappen hätte schaffen können. »Wir ziehen nicht allein in unser neues Haus.«
»Aha. Wer denn noch?«, fragte ich, aber nur aus Höflichkeit. Eigentlich war es mir egal, wenn ein paar ihrer Freunde im selben Haus wohnen würden. Vielleicht war das sogar ganz gut. Es würde sie von mir ablenken.
»Opa!«, rief meine Mutter übertrieben fröhlich. »Und Marius und Gwenny mit den vier Kleinen. Natürlich bekommt jede Familie eine eigene Wohnung, ist ja klar, und Opa auch. Und die Dachwohnung, die bekommt Basti, er studiert ja ab Herbst Philosophie, hier an der Uni.« Sie strahlte mich an. »Ist das nicht toll, Tess? Dann lebst du in einer Großfamilie! Dann hast du nicht mehr nur uns Eltern, sondern auch Opa, Onkel, Tante, Cousinen und Cousins in allen Altersstufen. Drei Generationen unter einem Dach! Da musst du nicht mehr allein in deinem Zimmer sitzen und stricken.«
»Häkeln«, verbesserte ich mechanisch. Doch in Gedanken war ich schon einen Schritt weiter. Leben in der Großfamilie? Alle Walters auf einem Haufen? Niemals! Allein der Gedanke jagte mir Schauer über den Rücken! Nichts gegen meine Familie, einzeln sind wir alle ganz okay. Aber in der Familienhorde werden wir zur Naturkatastrophe. Und das ist für niemanden schön, für andere Menschen nicht, und für uns selbst schon gar nicht. Deswegen wunderte ich mich über die Idee meiner Eltern. Wie konnten sie sich das freiwillig antun?
Aber eigentlich war mir egal, was sie sich dabei gedacht hatten, denn eins wusste ich genau: Ich. Wollte. Es. Nicht. Punkt.
Und wenn ich etwas nicht wollte, würde ich es auch nicht zulassen. Fest stand: Ich musste meine Strategie ändern.
Erstens: Weg mit der Häkelnadel. Das mit Spanien musste ich anders durchsetzen. Jetzt war es wichtig, alles abzulegen, was auch nur entfernt nach Einzelkindmarotte roch. Also keine Schrullen mehr. Kein »wunderliches« Verhalten. Und nicht mehr altklug sein. Was ist das Gegenteil davon? Neudumm? Egal was, ich musste es werden. Und ich musste zweitens so viel Leben und Chaos in unsere Bude bringen, dass meine Eltern zu dem Entschluss kommen würden, dass wir alle dringend mehr Ruhe und Besinnlichkeit brauchten.
Und dann, wenn ich dieses Umzugs-Horrorszenario verhindert hatte, nix wie ab nach Spanien.
Aber mit dem nächsten Satz zerstörte meine Mutter auch diese Träume. »Und rate mal, wann wir umziehen«, sagte sie, und in ihrer Stimme klang dieser künstliche Jubelton mit, der zeigte, dass sie genau wusste, wie wenig ich mich über ihre Worte freuen würde. »In den Sommerferien! Wir bleiben dieses Jahr zu Hause und nutzen die Zeit, um uns so richtig gut einzuleben. Wir alle zusammen!«
In den Sommerferien? Das war ja schon in acht Wochen! Und das wiederum bedeutete, dass der Umzug nicht mehr nur eine Idee war, sondern längst beschlossene Sache. Die Spanienreise konnte ich mir abschminken. Aus der Traum. In diesem Moment hätte ich als Zeichen meines Protests gern auf einen Buzzer geschlagen – BÖÖÖP!
Eltern. Gerade weil man sie nicht verstehen kann, bleibt immer ein Restrisiko, wenn man ihre Handlungen vorausberechnen will. Und dieses Mal hatte ich mich gründlich verrechnet.
Theresa Walter
Fichtenstraße 70
60322 Frankfurt
An das Institut für Psychologie
der Goethe-Universität Frankfurt
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main
27. Mai
Betreff: Eltern und Wissenschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie Kinder und Jugendliche wissenschaftlich untersuchen. Damit wollen Sie Eltern helfen, ihren Nachwuchs besser zu verstehen.
Aber warum erforscht denn niemand Eltern? Ich finde darüber nichts auf Ihrer Seite. Dabei bräuchten viele Kinder und Jugendliche dringend Hilfe, um ihre Eltern besser zu verstehen.
Falls die Experimente an Eltern daran scheitern, dass Sie keine geeigneten Versuchspersonen haben, wäre ich gern bereit, meine unter einem Vorwand zu Ihnen zu locken. Es handelt sich um gesunde Exemplare mittleren Alters mit einem ausgeprägten Elterntrieb und der Neigung zu seltsamen Entscheidungen.
Mit freundlichen Grüßen
Theresa Walter, 14, frustriert
2
Nach diesen Neuigkeiten konnte ich mich in der Schule nur schwer konzentrieren. Nicht nur, weil es horrormäßig früh war, sondern auch, weil mir das mit dem Umzug echt an die Nieren ging. Ich wusste nicht, ob ich kämpfen sollte, um diese Katastrophe zu verhindern, oder ob ich den Kampf sowieso längst verloren hatte.
Wie schon gesagt, meine Eltern waren oft schwer zu verstehen, sie gingen selten den direkten Weg. Wenn sie Insekten wären, dann wären sie garantiert Fliegen. Die sausen ja auch immer im Zickzack-Flug durch die Luft, damit erst kurz vor der Landung klar wird, wohin sie wollen. Meinen Eltern half dieser Trick aber längst nichts mehr. Nach vierzehn harten Jahren des Zusammenlebens konnte ich ihr Verhalten inzwischen ganz gut deuten, und wenn sie so bedröppelt wirkten wie heute beim Frühstück, hatten sie ganz eindeutig ein schlechtes Gewissen. Vermutlich war die Umzugsplanung also wirklich schon viel weiter, als sie zugaben. Was also tun? Kämpfen oder nachgeben? Ich hatte Jojo vor der Schule alles erzählt, und ihrer Meinung nach hatten wir verloren. »Kopf hoch«, hatte sie gesagt und ihre eigene Enttäuschung einigermaßen verborgen. »Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben dran. Vielleicht wird’s ja in den Herbstferien was. Oder nächstes Jahr.«
Pfff. Nächstes Jahr. Genauso gut könnte sie sagen: im nächsten Leben.
Ich saß im Biosaal und starrte auf die Glasschränke an der Wand. Ein ausgestopfter Bussard starrte zurück. Daneben lagen auf schwarzem Stoff ausgeblichene Schädel von Mäusen, Wieseln, Mardern und Füchsen. Käfer und Insekten waren in weißen Schaukästen mit Nadeln festgepinnt. Und in einem Glasbehälter rechts davon dümpelte in trüber Flüssigkeit ein Gehirn vor sich hin. So ungefähr fühlte sich meins auch gerade an.
Einer der Glasschränke war leer, und weil der Unterricht so unendlich langweilig war, stellte ich mir vor, dass darin bauchige Reagenzgläser stünden, in denen winzige Menschlein umherpaddelten und winkten. In jedem eins, und zwar Mini-Ausgaben von meinen Klassenkameraden und mir. Ich nahm meinen Schreibblock, zeichnete ein paar Reagenzgläser, malte Etiketten darauf und beschriftete sie: Kai – braun gebrannt, selbstbewusst, sexy. Lea – klein, blond, niedlich. Amelie – politisch engagiert und diskussionsfreudig. Jedem aus meiner Klasse ordnete ich ein paar typische Eigenschaften zu, die ihn charakterisierten, und das war ganz leicht. Es gab für jeden von uns Wörter, die sich geradezu aufdrängten, und ich war mir sicher, dass fünfundneunzig Prozent meiner Mitschüler spontan dieselben Begriffe gewählt hätten. Wir waren schließlich seit der Fünften zusammen in einer Klasse, und irgendwie hatte jeder im Laufe der Jahre eine Schublade bekommen, in die man ihn einsortiert hatte. Wir fragten uns schon lange nicht mehr, ob wir da noch reinpassten.
Jojo – neugierig, hübsch, klug. Kilian – schüchtern, unfreiwillig komisch. Bo – riecht nach Aschenbecher und sieht so aus, als würde er in einem schlafen. Und dann ich. Tess. Ich stockte und malte ein Fragezeichen hinter meinen Namen. Was gehörte auf mein Etikett? Ich wusste es nicht.
Vorsichtig stupste ich Jojo an und flüsterte ihr meine Frage zu. Sie betrachtete mit gerunzelter Stirn meinen Block. Es dauerte eine Weile, bis sie kapierte, was ich von ihr wollte, aber dann schrieb sie schnell etwas auf mein Etikett: Tess – schön, stark, intelligent, erfolgreich.
Ich verdrehte die Augen. »Mensch, ich will das wirklich wissen. Jetzt sag doch mal, wie ich in der Klasse gesehen werde.«
Sie grinste und klopfte nachdrücklich mit ihrem Stift auf die Wörter, die sie hingekritzelt hatte. »Keine Ahnung. Ich weiß nur, wie ich dich sehe.« Aber als sie meinen Blick sah, wurde sie ernst. »Hmmm, ich denk mal, alle finden dich nett. Und sie finden, dass man sich gut mit dir unterhalten kann. Auch über ernste Sachen.«
NETT? Genau das hatte ich befürchtet. Das hieß ja wohl übersetzt: Du störst niemanden, aber du interessierst auch keinen so richtig. Und: Man kann dich ruhig auf Partys einladen, denn du machst nichts kaputt, und man braucht ja auch immer ein bisschen Publikum. Ich war also ungefähr sowas wie diese Verpackungschips aus Styropor, mit denen man Hohlräume in Paketen füllen kann, damit den wirklich wertvollen Sachen darin nichts passiert. Na toll.
Nett. Den Stempel »nett« hatte ich, weil ich in der fünften und sechsten Klasse still, schüchtern und unauffällig gewesen war. Das war zwar längst vorbei, aber das merkte niemand. In der Schule gilt nämlich: einmal Star, immer Star. Einmal Depp, immer Depp. Und einmal nett, immer nett. Wenn man das ändern will, muss man lange daran arbeiten, und vielleicht klappt es trotzdem nie.
Aber ich wollte kein unwichtiger Styroporstreusel mehr sein, sondern ein wertvolles Einzelstück. Und auf Partys wollte ich raus aus dieser Ach-du-bist-ja-auch-da-Nummer. Ich wollte endlich so gesehen werden, wie ich wirklich war.
Da gab es nur ein klitzekleines Problem: Ich wusste ja selbst nicht genau, wer oder wie ich war. Das musste ich also dringend erst mal herausfinden. Nur – wie findet man im ganz normalen Alltagstrott irgendetwas über sich selbst heraus? Da ist doch immer irgendwer, der dich in alte Schubladen quetscht.
Keine Familie, keine Clique, kein Alltagskram! Nur ich und Jojo! Das war’s, was ich brauchte, und das hätte ich in Spanien haben können. Auch deshalb war die Idee mit der Reise für mich so wichtig gewesen, weil sie viel mehr hätte sein können als nur ein Urlaub: ein Neuanfang.
In diesen Gedanken wurde ich gestört, als plötzlich der Schatten unseres Biolehrers auf mich fiel.
»Jovana, was machst du da?«, polterte er los.
Uff, er meinte nicht mich, er meinte Jojo. Aber nach der ersten Erleichterung merkte ich: Das war viel schlimmer. Er hatte Jojo nämlich beim Spielen mit ihrem Handy ertappt, und jetzt war das Ding gleich weg, er würde es einkassieren. Und weil ihr das schon zum zweiten Mal passierte, würden ihre Eltern Post von unserem Direktor bekommen.
»Sorry«, sagte ich schnell und plinkerte Herrn Marquart an. »Das ist meins. Ich wollte Jojo nur schnell was zeigen.«
»Tja, dann hast du jetzt Pech gehabt, Theresa«, sagte er und konfiszierte Jojos Handy. »Um eins kannst du’s auf dem Rektorat abholen.«
Pech? Wir hatten Glück gehabt. Mich hatte noch keiner mit dem Handy erwischt, ich würde es also später problemlos ausgehändigt bekommen, und bis dahin konnte Jojo das Teil auch mal entbehren.
Sie lächelte mich an, zeichnete ein Herz auf einen Zettel, schob ihn mir zu und flüsterte »Danke«.
»Ist doch klar«, wisperte ich fast lautlos. Sie hätte das auch für mich getan.
Ich sank in meinen Halbschlaf zurück und dachte weiter über Spanien nach.
Raus aus der Schublade, das war der eine Grund für meinen Reiseplan gewesen. Aber ich wollte noch etwas. Und das war noch viel wichtiger.
»Was willst du denn?«, fragte Jojo mich am Nachmittag, als ich ihr mein Herz ausschüttete. Sie saß neben mir auf meinem Bett, hatte ihren Laptop auf den Knien und betrachtete im Internet Bilder von spanischen Stränden. Wie immer fielen ihr dabei ihre langen, dunklen Haare ins Gesicht, und sie warf sie mit Schwung nach hinten. Ihre Augen waren grün wie das spanische Meer.
»Hmmm«, knurrte ich, um Zeit zu schinden, denn diese Frage beantwortete ich nicht gern, das ging mir echt nah. Aber Jojo konnte ich so was sagen. »Ich will mich mal wieder verlieben«, gab ich also zu.
»Das kannst du doch auch hier«, meinte sie und klickte ein Bild an, auf dem man Jungs auf Surfbrettern über glitzernde Wellen flitzen sah.
»Nein«, sagte ich. »Eben nicht.« Aber so richtig erklären konnte ich das nicht mal ihr, weil die Erklärung so unendlich kitschig klang. Ich wollte mich nämlich nicht so verlieben, wie man sich normalerweise verliebt. Also nach dem Motto: Wir gehen abends raus, meine Clique trifft seine Clique, wir albern rum und flirten, keiner weiß genau, wer jetzt eigentlich auf wen steht, und irgendwann finden sich dann Pärchen zusammen. Vielleicht knutscht man rum. Danach muss man dann nur noch rausfinden, ob das jetzt für einen Abend war oder für länger.
Ich wollte einen Jungen finden, der sich so benahm, wie er wirklich war, und ich wollte auch einfach ich sein dürfen. Er sollte mich genauso mögen wie ich war. Und dann wollte ich mit ihm reden und ihn ansehen und meine Stirn an seine lehnen und ihn küssen. Ja, und ich wollte solche Sachen machen wie händchenhaltend am Strand entlanglaufen, den Sonnenuntergang anschauen, unsere Schlafsäcke auf dem Sand ausbreiten, ein Lagerfeuer anzünden und nebeneinander beim Wellenrauschen einschlafen. Morgens wollte ich meine Augen aufschlagen und gleich in seine sehen. Also, im Grunde wollte ich die Basics, die man einfach mal erlebt haben sollte. Finde ich.
Aber das kann man ja nicht gut laut sagen, denn dann klingt es nicht so, wie es sich anfühlen würde, sondern künstlich und übertrieben romantisch und klebrig-süßlich-rosarot. Ist es aber nicht!
Jojo verstand natürlich nicht, worauf ich hinauswollte. Kein Wunder, ich hatte es ihr ja auch nicht erklärt. Sie knuffte mich in die Seite, um mich aufzumuntern. »Komm schon. So schlimm ist das alles doch gar nicht«, meinte sie. »Das mit dem Verlieben, das schaffen wir wirklich auch hier. Diese Stadt ist doch groß genug. Wir gehen einfach mal ins Freibad.«
»Ja. Können wir machen«, sagte ich lustlos. »Aber schlimm ist der Umzug trotzdem. Schon allein wegen der Großfamilie!« Ich schnaubte wütend. »Ich bin gern Einzelkind. Und außerdem bin ich vierzehn. Das ist das Alter, in dem man seine Familie so langsam hinter sich lässt. Da wohne ich doch nicht freiwillig mit noch mehr von denen zusammen. Ich! Will! Nicht!«
Jojo zuckte mit den Schultern und googelte das Wort »Großfamilie«. »Wenn du der Inder Zion Chana wärst, könnte ich deine Panik ja verstehen«, sagte sie und starrte erschrocken auf den Bildschirm. »Wahnsinn. Der Mann hat neununddreißig Ehefrauen, vierundneunzig Kinder, vierzehn Schwiegertöchter und dreizehn Enkel. Dass der über seine Großfamilie schimpft, ist klar. Für den wird ja schon eine ganz normale Abstimmung über Fragen wie ›Gehen wir am Sonntag ins Hallenbad oder in den Zoo?‹ zu einer stundenlangen Diskussion. Aber du und deine Familie, ihr seid doch gerade mal, warte …« Sie zählte uns an ihren Fingern ab. »Ihr seid elf Leute. Das sind auch nicht mehr als in anderen Mehrfamilienhäusern. Eher weniger. So schlimm werden die doch nicht sein.«
»Ja, könnte man denken«, sagte ich. »Und das dachte wohl auch der Restaurantbesitzer, der uns für die Feier von Opas Fünfundsiebzigstem neulich sein Nebenzimmer überlassen hat. Tja, und jetzt ist das Restaurant geschlossen, und der Mann ist seit sechs Wochen in Kur.«
Jojo schob sich ein Stück Schokolade in den Mund. Meine Schokolade. »Wie ift denn daf paffiert?«, fragte sie.
»Da war erst mal die Sache mit dem Krach.« Ich dachte mit Schaudern daran zurück. »Ich glaube, wir sind in das Lokal eingefallen wie eine Büffelherde. Aber dafür können wir nichts, das liegt an unseren Genen. Wir stammen eben alle von Urururururopa Ignatz Walter ab, und seine Charaktereigenschaften vererben sich äußerst dominant.«
»Waf war denn daf für einer?«, nuschelte Jojo mit vollem Mund.
»Uropa Ignatz lebte vor ungefähr zweihundert Jahren«, erzählte ich. »Sein Beruf war es, die Soldaten auf dem Schlachtfeld mit Trommeln anzuspornen und den Feind zu erschrecken, und das machte er gut. Weil ihm seine Trommeln dafür irgendwann zu leise waren – und er war der Einzige, der dieser Meinung war –, tauschte er sie gegen Zimbeln aus. Das sind große Becken aus Messing, die man scheppernd aneinanderschlägt. Tsching BUMM.«
»Echt jetzt?«, fragte Jojo.
Ich nickte. »Man sagt, dass sie jede Schlacht gewonnen haben, weil er und die von ihm angespornten Soldaten alles niederwalzten, was ihnen im Weg stand. Tja, und das mit dem Krach und dem Niederwalzen hat sich bis heute an seine Nachfahren vererbt.«
Jojo zuckte mit den Schultern. »Na, aber mit einer lauten Familiengesellschaft muss man in einem Restaurant doch klarkommen.«
Ich nickte. »Aber das war nicht alles. Mein jüngster Cousin Leo macht gerade eine Phase durch, in der er dauernd selbsterfundene Schimpfwörter schreit. Er kräht sie in allen passenden und unpassenden Momenten raus und lacht sich dann kaputt. Das fanden manche nicht so lustig. Ein paar Gäste sind gegangen, darunter auch ein Restaurantkritiker. Wobei das ein Glück war, denn wenn er geblieben wäre, dann hätte das Restaurant ganz dichtmachen können. Denn da war ja noch die Sache mit den Regenwürmern.«
»Regenwürmer?«, fragte Jojo.
Ich seufzte. »Als wir aufs Essen warteten, haben die Kinder draußen auf dem Parkplatz Regenwurmbabys gesammelt. Ganz kleine, dünne Würmchen waren das. Und weil die angeblich Hunger hatten, haben die Monsterkids ihnen aus dem Salatbüffet Blätter geklaut. In der kleinen Schale mit der Petersilie haben sie ihnen dann ein Würmchengehege gebaut. Tja, und das haben sie auf dem Büffet vergessen. Leider waren die anderen Gäste nicht so tierlieb.«
»Iiiih!« Jojo schob sich noch ein Stück Schokolade in den Mund, als Nervennahrung vermutlich.
Ich war zu sehr in meinen Gedanken versunken, um dagegen zu protestieren, dass sie meinen ganzen Vorrat vernichtete.
»Ja, sie sind anstrengend. Besonders die Kinder. Aber weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Umzugssache ist?«, fragte ich.
Jojo schüttelte den Kopf.
»Ich kann nichts daran ändern«, sagte ich. »Ich hatte einen Plan, meine Eltern durchkreuzen ihn einfach, und mir fällt überhaupt nichts ein, was ich dagegen tun könnte. Und sowas halte ich nur sehr schwer aus. Das kann doch nicht sein!«
Jojo nickte verständnisvoll.
»Oh.« Ich fuhr auf. »Beim Thema Ändern fällt mir was ein. Wir müssen noch einen Brief schreiben. Das mit den Handys in der Schule kann so nicht weitergehen. Und weil ich dich heute früh rausgehauen habe, hilfst du mir, okay?«
»Hmpf«, sagte Jojo.
Theresa Walter
Fichtenstraße 70
60322 Frankfurt
Herrn
Thomas Ballhoff
Direktor des Hölderlin-Gymnasiums
In den Höfen 17
60322 Frankfurt
28. Mai
Lieber Herr Ballhoff,
an unserer Schule gibt es ja die Regel, dass man keine Handys benutzen darf. Das gilt sowohl für das Schulgebäude als auch für den Pausenhof, und nicht nur während des Unterrichts, sondern auch in den Pausen und vor und nach der Schule. Wenn man mit dem Handy erwischt wird, sammeln es die Lehrer ein, und man muss es nach dem Unterricht bei der Schulleitung abholen. Wiederholungstelefonierer bekommen sogar einen Brief an die Eltern und eine Strafarbeit.
Das finde ich aus verschiedenen Gründen nicht gut. Erstens sehe ich nicht ein, warum das Handy auch in den Pausen verboten ist. Da stört es nun wirklich keinen, da muss man ja nicht aufpassen oder lernen. Zweitens verstehe ich nicht, warum das Verbot nicht nur in der Schule, sondern auf dem ganzen Schulgelände gilt. Inwiefern behindert es denn die Lehrer oder das Lernen oder das Schulklima oder so, wenn am Rande des Pausenhofs ein Schüler mal eben kurz telefoniert?
Und drittens verstehe ich nicht, warum man nicht auch mal im Unterricht kurz aufs Handy schauen sollte.
Ich sehe ja ein, dass Sie wollen, dass die Schüler im Unterricht ihre Aufmerksamkeit ganz auf den Lehrer richten. Aber mal ehrlich, ein unaufmerksamer Schüler ist ohne Handy genauso unaufmerksam. Dann malt er eben den Tisch an oder quatscht mit seinen Sitznachbarn, sodass auch die nicht aufpassen. Das ist ja auch nicht besser.
Eine erzieherische Funktion hat das Verbot auch nicht, so nach dem Motto, die Schüler sehen ein, dass man nicht immer nur am Handy rumhängen soll, oder so. Ganz im Gegenteil, dadurch erziehen Sie die Schüler eher dazu, Verbote zu hintergehen und alles heimlich zu machen.
Was ich von allem am unfairsten finde, ist, dass das Verbot nur für Schüler gilt und nicht für Lehrer.
Ich würde mich freuen, wenn Sie daran etwas ändern würden.
Mit freundlichen Grüßen
Theresa Walter, 9d
3
»Du, Jojo?«, fragte ich, als der Brief fertig war.
»Hmmm.«
»Sag mal, findest du eigentlich auch, dass ich Einzelkindmarotten habe? Bin ich wirklich schrullig? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen.«
Jojo kräuselte die Stirn. Das tut sie immer, wenn sie nachdenkt. Sie versucht eigentlich, ihre Stirn in würdige Falten zu legen, aber das funktioniert nicht. Sie bringt immer nur ein paar Runzeln zustande. »Ein bisschen schrullig bist du schon«, gab sie zu. »Aber ich liebe das sehr an dir.«
»Oh Mann!« Ich verdrehte die Augen. »Du hättest an dieser Stelle ›nein‹ sagen sollen.« Ich zögerte kurz, dann hakte ich nach: »Wieso findest du das?«
»Na, da ist erst mal die Sache mit den Briefen.«
»Die sind doch nicht schrullig. Sie sind sinnvoll. Wenn ich irgendwo ein Problem entdecke, setze ich mich dafür ein, es zu beseitigen. Jeder kann die Welt ein winziges bisschen besser machen. Und wenn das alle tun, wird sie irgendwann wirklich besser.«