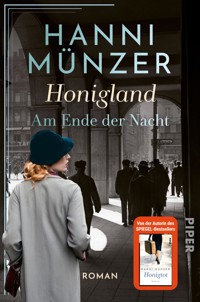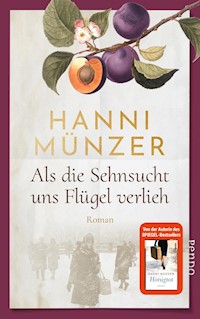12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Gina und Riccardo, die in Venedig das finden, wonach sie nie gesucht haben … die Liebe Was wäre, wenn dir der Richtige zur falschen Zeit begegnet? Weil dein Leben eine Lüge ist und du keine Komplikationen gebrauchen kannst? Du gehst der Liebe aus dem Weg. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit der temperamentvollen Studentin Gina. Was niemand weiß: Sie ist auf der Flucht vor einer dunklen Vergangenheit, und jeder Tag könnte ihr letzter sein. Riccardo ist Mitte dreißig, sieht blendend aus und hat im Leben alles erreicht. Erfolg, Geld, Frauen – nichts interessiert ihn mehr wirklich. Bis er in Venedig der mysteriösen Gina begegnet, und plötzlich ist alles anders. Doch Gina lässt ihn abblitzen. Fasziniert von dem Mädchen mit den traurigen Augen, heftet sich Riccardo auf ihre Fersen und kommt ihrem Geheimnis auf die Spur. Als Gina spurlos verschwindet und Riccardo ein ungeheuerliches Video zugespielt wird, riskiert er alles, um sie wiederzufinden – sogar sein Leben. Hinweis:Das Buch enthält Szenen mit sexuellen Inhalten sowie die Thematisierung von sexualisierter Gewalt. Die Neuausgabe von "Venedig Love Story" – umfangreich überarbeitet und ergänzt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Was wäre, wenn dir der Richtige zur falschen Zeit begegnet? Weil dein Leben eine Lüge ist und du keine Komplikationen gebrauchen kannst? Du gehst der Liebe aus dem Weg. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit der temperamentvollen Studentin Gina. Was niemand weiß: Sie ist auf der Flucht vor einer dunklen Vergangenheit, und jeder Tag könnte ihr letzter sein.
Riccardo ist Mitte dreißig, sieht blendend aus und hat im Leben alles erreicht. Erfolg, Geld, Frauen – nichts interessiert ihn mehr wirklich. Bis er in Venedig der mysteriösen Gina begegnet, und plötzlich ist alles anders. Doch Gina lässt ihn abblitzen. Fasziniert von dem Mädchen mit den traurigen Augen, heftet sich Riccardo auf ihre Fersen und kommt ihrem Geheimnis auf die Spur. Als Gina spurlos verschwindet und Riccardo ein ungeheuerliches Video zugespielt wird, riskiert er alles, um sie wiederzufinden – sogar sein Leben.
Die Autorin
HANNI MÜNZER ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Mit ihrer Honigtot-Saga erreichte sie ein Millionenpublikum. Auslandsrechte von Honigtot sind in zahlreiche Länder verkauft, es folgten die Bestseller Marlene, Honigland und zuletzt Honigstaat.
Im Eisele Verlag erschien ihr Roman Solange es Schmetterlinge gibt, ebenfalls ein Bestseller. Hanni Münzer lebt mit Mann und Hund in Mittelerde.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-253-6
Dieser Roman ist in einer früheren Version unter dem Titel Venedig Love Story – Das Mädchen hinter der Maske bereits erschienen.
Hinweis: Das Buch enthält Szenen mit sexuellen Inhalten sowie die Thematisierung von sexualisierter Gewalt.
© 2025 Julia Eisele Verlags GmbH,
Lilienstraße 73, 81669 München
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © red monkey, © Viktoriia_Patapova, © keisi_melcer / Shutterstock
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Prolog
Fünf Jahre zuvor
Riccardo
Gina
Gina
Gina
Riccardo
Gina
Riccardo
Gina
Riccardo
Gina
Riccardo
Gina
Riccardo
Gina
San Fernando Valley
Riccardo
Gina
Riccardo
New Haven, Connecticut
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Gina
Riccardo
Gina
Riccardo
Riccardo
Riccardo
Riccardo
Gina
Gina
New Haven, Connecticut
Gina
Gina
Zwei Jahre später
Happy …
… End
In eigener Sache – auch bekannt als Danksagung
Die magische Suppe
EMPFEHLUNGEN
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Für alle, die an die Magie der Liebe glauben.
»Das Herz hat Gründe, von denen der Verstand nichts weiß.«
Blaise Pascal
»Jeder hat ein(e) Happy End verdient.«
Marisol Esperanza
aus Wenn du mich findest
Prolog
Meine Großmutter hatte oft zu mir gesagt, dass das Leben ein Geschenk sei und man es jeden Tag neu auspacken müsse. Nicht immer finde man darin das vor, was man sich gewünscht habe, aber man solle stets versuchen, das Beste daraus zu machen. Ansonsten würde es den Geber beleidigen. Großmutter nannte ihn Gott.
Bis zu ihrem Tod empfand ich dies als eine wunderbare Vorstellung. Ich war ein Kind, begierig auf das Leben und seine Geschenke. Wenig später endete meine Kindheit abrupt, und ich lernte, dass dies zwar eine schöne Weisheit war, aber nur teilweise zutreffen konnte. Das Leben schuldet uns nichts und es geschehen Dinge auf der Welt, aus denen man nicht das Beste machen kann. Manche Geschenke sind nur grausam. Und die Geber sind immer die Menschen.
Für eines dieser Präsente des Lebens habe ich Rache geschworen – bis zum Tod.
Dies ist meine Geschichte.
Fünf Jahre zuvor
New York City
Seit einer Stunde saß sie jetzt in der Bar und behielt den Eingang im Auge. Wo blieb der Mann bloß?
Der Barbesitzer, der jede Viertelstunde mürrisch bei ihr nachgefragt hatte, ob sie noch etwas bestellen wolle, stand plötzlich vor ihr und verstellte ihr den Blick. »Sind Sie Rabea?«, fragte er.
»Ja. Wer will das wissen?«
»Eben rief ein Typ für Sie an. Ich soll Ihnen sagen, dass er es heute nicht schafft.«
Rabea seufzte. Ihr Informant hatte sie also erneut versetzt. Das gehörte zum Alltag eines Journalisten. In Gedanken war sie schon dabei, ihre Story so umzuformulieren, dass sie ohne die letzte Quellenbestätigung veröffentlicht werden konnte.
Sie zahlte, rückte kurz ihre Mütze zurecht und nahm ihre Tasche, als ein neuer Gast die Bar betrat und ihre Aufmerksamkeit erregte. Das Mädchen war blutjung, beinahe noch ein Teenager. Ihrer Kleidung haftete die unaufdringliche Eleganz teurer Designerware an. Eine Baseballkappe der New York Yankees verbarg ihr Haar, aber das schmale blasse Gesicht darunter wirkte auf Rabea seltsam gehetzt. Das Mädchen verharrte unschlüssig an der Tür und musterte die wenigen Anwesenden. Kurz glitt ihr Blick auch über Rabea hinweg. Die überlegte, ob sie sie schon einmal gesehen hatte, vor allem fragte sie sich jedoch, was das Mädchen in dieser Gegend zu suchen hatte. Die Bar lag im New Yorker Hafenviertel und war eine von der übleren Sorte. Die Hälfte der Gäste wirkte wie Gangster, was sie vermutlich auch waren, und der muskelbepackte Wirt sah aus wie ein griesgrämiger Popeye, der keiner Schlägerei aus dem Weg ging.
Die Gäste begannen sich nun ebenfalls für den Neuankömmling zu interessieren. Plötzlich machte das Mädchen auf dem Absatz kehrt und verließ das Lokal wieder.
Im Augenwinkel fing Rabea eine Bewegung auf. Ein Mann rutschte am Tresen vom Hocker und schickte sich ebenso an, das Lokal zu verlassen.
Rabeas Reporterinstinkte sprangen an wie ein gut geölter Motor. Der Typ war ihr bereits zuvor aufgefallen. Es lag etwas Lauerndes in seiner Haltung und er hatte sich eine geschlagene Stunde an einem einzigen Bier festgehalten.
Sie folgte den beiden nach draußen. Ihre Hand tastete dabei nach der 9-Millimeter, die sie stets mit sich trug, wenn sie sich zu später Stunde in verrufenen Spelunken allein mit einem Informanten verabredete.
Wenigstens hatte inzwischen der Regen ausgesetzt, der den ganzen Tag auf New York niedergeprasselt war, als wollte er die Stadt ertränken. Rabea blickte sich suchend um. Ein einsames Taxi fuhr vorüber, in seinem Scheinwerferlicht spiegelte sich der nasse Asphalt, ansonsten wirkte die Straße wie ausgestorben. Das Mädchen und der Mann schienen wie vom Erdboden verschluckt.
Plötzlich glaubte sie einen erstickten Schrei zu hören und rannte in die vermutete Richtung. Keine fünfzehn Meter entfernt entdeckte sie die beiden in einer der typischen New Yorker Hinterhofgassen, in der sich stählerne Feuertreppen hinabwanden, Müllsäcke stapelten, Obdachlose auf Kartonagen schliefen und die Ratten ihre Vermehrung vorantrieben. Die Straßenlaterne warf gerade so viel Licht hinein, dass sie erkennen konnte, wie der Mann das Mädchen von hinten bedrängte und ihr den Mund zupresste. Rabea zog ihre Pistole und schrie: »Lassen Sie sofort das Mädchen los!«
Der Mann reagierte augenblicklich und stieß es zu Boden. Rabea ahnte mehr, als dass sie es sah, wie er ebenfalls eine Waffe hochriss und das Feuer eröffnete. Sie warf sich zur Seite, wobei sich ungewollt ein Schuss aus ihrer Waffe löste. Blitzschnell rollte sie herum und fand eher dürftigen Schutz hinter einer Mülltonne. Verdammt, wo hatte sie sich da wieder hineinmanövriert? Was jetzt? Wo war der Kerl? Ihr kam eine Idee. Sie nahm ihre Mütze und hob sie gut sichtbar über den Mülltonnendeckel. Nichts. Sie horchte. Schlich er sich gerade an sie heran?
Unvermittelt durchschnitt eine Mädchenstimme die Stille: »Verschwinde, du Schwein, oder ich knall dich ab!«
Vorsichtig linste Rabea an der Mülltonne vorbei. Der Angreifer lehnte merkwürdig gekrümmt an der Hausmauer, die Hände um einen Oberschenkel geklammert, während das Mädchen ihn mit vorgehaltener Waffe in Schach hielt. Rabea stand auf und näherte sich den beiden mit gleichfalls vorgereckter Waffe.
Angesichts der doppelten Bedrohung wandte sich der Angreifer fluchend ab und flüchtete humpelnd tiefer in die Gasse hinein. Innerhalb von Sekunden hatte die Dunkelheit ihn verschluckt. Kurz darauf sprang ein Motor an und ein Wagen raste mit quietschenden Reifen davon.
Rabea begriff: Der Schuss, der sich aus ihrer Pistole gelöst hatte, musste den Mann getroffen haben! Manchmal war das Schicksal gerecht. Da drang ein leises Wimmern an ihr Ohr. Das Mädchen! Es kauerte kläglich auf dem Boden, die Hände um die Pistole des Ganoven gekrampft. Beim Zweikampf hatte es seine Kappe verloren und langes blondes Haar verdeckte sein Gesicht wie ein Vorhang. Rabea hockte sich vor sie. »Ist dir was passiert? Bist du verletzt?«, fragte sie besorgt.
Stumm schüttelte die Kleine den Kopf.
»Komm, ich nehme sie.« Sanft entwand sie ihr die Waffe und schob diese hinter sich. Darauf holte sie ihr Smartphone aus der Jeans. »Ich rufe die Polizei.«
»Nein, keine Polizei!« Unvermittelt erhielt Rabea einen kräftigen Schubs. Sie kippte nach hinten und verlor ihr Telefon, während das Mädchen hastig davonstolperte.
Rabea rappelte sich hoch, schnappte sich ihr Smartphone und sprintete ihr hinterher. Kurz vor der Straße holte sie das taumelnde Mädchen ein und griff nach ihrem Arm.
»Lassen Sie mich!«, rief es und versuchte, sich Rabea zu entwinden.
»Ich will dir doch nur helfen!« Rabea ließ sich nicht abschütteln.
»Ich brauche keine Hilfe. Bitte gehen Sie! Er tötet Sie sonst!«, stieß es verzweifelt hervor.
Sie standen jetzt direkt unter einer Straßenlaterne. Verblüfft erkannte Rabea nun ihr Gegenüber. Das war doch …? Gerade heute hatte sie sie noch in den Hauptnachrichten gesehen. Ihr Instinkt hatte sie also nicht getrogen. Rabea witterte eine Story. Doch weit mehr rührte sie die sichtbare Verzweiflung des Mädchens. Sie schien weniger von dem eben Erlebten zu stammen, es steckte noch mehr dahinter, etwas weit Bedrohlicheres. Ihre Augen glichen dem eines gehetzten Rehs auf der Flucht. Wovor hatte es solche Angst?
»Wen meinen Sie mit er? Etwa Ben Lawrence?«
»Sprechen Sie seinen Namen nicht aus!« Das Mädchen warf erschrockene Blicke um sich, als fürchtete sie, der Genannte könnte ihnen im unmittelbaren Schatten auflauern. »Verstehen Sie nicht? Er tötet jeden, der mir hilft!«
»Dann sollten wir schleunigst von hier verschwinden.« Rabea hakte das Mädchen energisch unter und zog es zu ihrem Wagen, den sie nahe der Bar geparkt hatte.
Die Kleine zitterte am ganzen Körper. Inzwischen hatte der Schock eingesetzt und sie ließ sich ohne weiteren Widerstand zu Rabeas Auto führen. In der Ferne waren die Sirenen eines näherkommenden Einsatzfahrzeugs zu hören. Rabea gab Gas.
Sie fuhr zu der Wohnung, die ihr ein befreundeter Journalist zeitweilig überlassen hatte, solange er sich im Nahen Osten aufhielt. Dort verfrachtete sie das verstörte Mädchen auf die Couch und versorgte es mit Decken und heißem Kakao.
Im Laufe der Nacht erfuhr Rabea ihre ganze erschütternde Geschichte. Das Mädchen, das gerade einmal siebzehn war, hatte sich jemandem anvertrauen müssen.
Gegen Morgen fasste Rabea einen Entschluss. In dieser Situation gab es nur eine Person, die ihr helfen konnte. Sie wählte eine Nummer in Deutschland.
Eine gut gelaunte männliche Stimme meldete sich: »Was verschafft mir das seltene Vergnügen deines Anrufs?«
»Hör zu, ich brauche deine Hilfe.«
Das Gespräch dauerte nicht lang, ihr alter Freund erfasste sofort die Ernsthaftigkeit der Situation. Rabea legte auf und stieß einen langen, tiefen Seufzer aus.
Sie hatte soeben die Story ihres Lebens in den Wind geschossen.
Riccardo
Los Angeles
Gegenwart
Riccardo West schaltete den Fernsehapparat ein und zappte bis zum staatlichen italienischen Sender RAI Uno, der einen Live-Bericht aus Florenz übertrug.
Unter Blitzlichtgewitter betrat eine elegante Frau in ihren Mittdreißigern das Podium. Die Bildunterschrift wies sie als Kuratorin der Gallerie degli Uffizi aus. Sichtlich bewegt begann sie ihre Rede:
»Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich in Florenz in der Gallerie degli Uffizi begrüßen. Sie fragen sich sicher, warum diese Pressekonferenz so kurzfristig anberaumt wurde, und ich möchte Sie auch gar nicht lange auf die Folter spannen.« Sie verhielt kurz, um sich dem Hintergrund zuzuwenden, wo drei verhüllte Staffeleien zu erkennen waren. Wie bestellt erhob sich ein Raunen im Saal. Die Kuratorin lächelte und fuhr fort: »Vor einem Monat wurde unserem Museum eine anonyme Stiftung zuteil. Es handelte sich hierbei um ein Konvolut aus mehreren Skizzen und eine farbige Portrait-Miniatur von der Größe 12 x 14 Zentimeter. Zwei unabhängige Expertisen haben nun einwandfrei ergeben, dass sowohl die Skizzen als auch die Miniatur Leonardo da Vinci zuzuordnen sind. Meine Damen und Herren, das größte Geheimnis der Malerei ist seit heute gelüftet!« Sie schritt feierlich zur ersten Staffelei und riss das Tuch herunter.
Riccardo stellte den Bildschirm in der gleichen Sekunde ab und griff nach dem Terminplan seiner bevorstehenden Europareise: Berlin, Paris, Rom, Venedig. Zusätzlich hatte er auch einige Tage auf seinem Weingut in der Toskana eingeplant – dem einzigen Ort, an dem er noch ein wenig Entspannung finden konnte. Vor allem freute er sich dort auf seine Hunde und Pferde.
Der Besuch in Venedig war zum Teil auch privater Natur. Seit er vor Jahren erstmals seinen Fuß in die dem Untergang geweihte Lagunenstadt gesetzt hatte, sofern man den gängigen Prognosen Glauben schenkte, fühlte er sich zu ihr hingezogen. Kurz schoss ihm durch den Kopf, was das über ihn selbst aussagte, aber er schüttelte den unliebsamen Gedanken ab. Er hielt sich von Selbstbetrachtungen fern, frei nach dem Philosophen Nietzsche: Blickst du in den Abgrund, so blickt er auch in dich hinein. Für seinen Geschmack hatte er ausreichend Abgründe gesehen, da brauchte er nicht den eigenen zu erforschen. Viel lieber lenkte er seine Aufmerksamkeit einem besonderen Objekt seiner Begierde zu – eine wundervolle Büste der Venus aus der frührömischen Periode, der er bereits seit geraumer Zeit nachstellte. Ihr Besitzer, ein venezianischer Graf, der in Kürze die neunzig überschreiten würde, hatte sich bisher partout nicht von ihr trennen wollen. Aber Riccardo ließ sich so schnell nicht entmutigen: Er wollte den Grafen persönlich davon überzeugen, sie ihm zu überlassen. Für einen guten Preis natürlich. Alles hatte seinen Preis. Die einzige Wahrheit, an die er glaubte und bisher hatte sie sich immer bestätigt.
Darüber hinaus standen in Rom die Abschlussverhandlungen mit einem japanischen Konsortium an, dessen Sprecher ihm unvorsichtigerweise verraten hatte, dass er sich einen Palazzo am Canal Grande zulegen wollte. Riccardo hatte sich die Unterlagen zum Objekt angesehen und es schien sich bei dem Gebäude um eine vielversprechende Investition zu handeln. Wer weiß, vielleicht würde er dem Mann das Geschäft vor der Nase wegschnappen? Dabei war ihm primär nicht der Besitz wichtig, sondern der Weg dorthin. Er war ein Jäger.
Trotzdem konnte er das wachsende Gefühl des Überdrusses, das ihn immer häufiger befiel, nicht länger ignorieren. Selbst die Jagd konnte ihm nicht mehr die gleiche Befriedigung verschaffen wie früher. Wurde er alt? Er war vierunddreißig, hatte alles erreicht und seine neueste Herausforderung war … Langeweile. Seinem Leben fehlte die Würze. Vermutlich war es wieder einmal an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Er griff zum Smartphone.
»Hey Rick!«, meldete sich am anderen Ende Dante, sein bester Freund und Geschäftsführer der exklusiven Agentur, die sie vor bald zehn Jahren gemeinsam gegründet hatten.
Zu Beginn war es nicht mehr als ein launiger Best-Buddys-Einfall in einer Bar gewesen – zusammen hatten sie es auf schätzungsweise fünf Promille gebracht. Heute warf die Agentur jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag ab, und Dante Lipsky, der ehemalige Quarterback der New England Patriots und fünffacher Gewinner des Super Bowls, hatte ein völlig neues Spielfeld gefunden. »Benötigst du mal wieder meine Dienste? Schon eine Weile her, oder? Was ist los mit dir, Rick? Zu wenig Druck im Ventil?«
»Gott sei Dank weniger als bei dir«, konterte Riccardo. Der Frauenverschleiß seines Freundes war legendär. Es verging kaum eine Woche, in der die Presse ihn nicht mit einem neuen Supermodel an der Seite ablichtete. West selbst mied die Medien und war dafür bekannt, keine Interviews zu geben. »Ich fliege nächste Woche nach Europa und plane einen Abstecher nach Venedig. Wie sieht’s aus, hättest du was vor Ort für mich?«
»Venedig? Warte einen Augenblick. Da war was …« Dante konsultierte seinen Computer: »Ja, ich habe da etwas absolut Exquisites für dich. Ein Super-Skript, eine Frau, wie du sie magst, aber ein wenig extrem. Selbst für deine Ansprüche.«
»Extrem? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ist alles rechtlich abgesichert?«
»Natürlich. Der Vertrag ist bombensicher.«
»Einverstanden, schick mir das Skript rüber.« West scrollte auf dem Laptop seine Termine durch und nannte seinem Freund die Zeit und den Ort.
Gina
Rom
Jemand rüttelte mich an der Schulter.
»Wach auf, Gina! Du hast einen Albtraum!«
Ich fuhr hoch. Mein Herz raste und für einen Augenblick wusste ich nicht, wo ich war. Alles um mich herum erschien mir fremd und bedrohlich. Noch immer erfüllte mich eine schreckliche Leere, das Gefühl zu fallen, tiefer und tiefer, während mir die Lunge zusammengepresst wurde. Ich wusste, dass ich nicht panisch werden durfte und gegen die schwarze Atemlosigkeit ankämpfen musste. Nur langsam fand ich mich wieder in der Gegenwart zurecht. Dabei blieb mein Blick auf dem besorgten Gesicht des jungen Mannes haften, der mich geweckt hatte. War das Pieter? Nein, Pieter war gestern gewesen, meinte ich. Ich durchforstete mein Gedächtnis nach dem Namen. Nicht Pieter. Sven?
Gerade standen meine skandinavischen Wochen an und ich vögelte mich durch eine Gruppe frischer Studenten aus Schweden. Das Sommersemester hatte im Vormonat begonnen und die Auswahl war entsprechend üppig. Ich blinzelte. Sven – falls es Sven war –, sah mich fragend an. Der Schatten des Albtraums lastete weiter auf mir und seine Nachwirkungen machten mir zu schaffen. Ich brauchte Ablenkung und griff entschlossen unter die Decke. Mein Partner war jung und es war früher Morgen. Er enttäuschte mich nicht. Ich packte fest zu und hangelte mich an seiner Morgenlatte zurück in die Realität. Sven stöhnte laut, aber bevor er sich auf mich rollen konnte, hatte ich mich schon rittlings auf ihn geschwungen. Ich war gern die Dominante und hatte die Dinge unter Kontrolle. Im Anschluss an das eher kurze Vergnügen zog ich mich in Windeseile an und verschwand ohne ein Wort. So, wie ich es immer tat.
Unten auf dem Gehsteig hatte ich die Wahl zwischen der nahen Bushaltestelle und einem flotten Spaziergang. Ich entschied mich für letzteres. Svens Studenten-WG lag mitten im Centro Storico nahe des Pantheons und der zwanzigminütige Trip zu Fuß durch Rom bis nach Hause würde mir den Kopf freipusten. Ich empfand die Stadt wie ein lebendiges Wesen, das mich vom ersten Tag an in seine Arme geschlossen hatte. Keine Beschreibung könnte der Faszination der ewigen Stadt jemals gerecht werden, man muss sie selbst erleben. Für mich verkörperte sie das Ewige, während alles andere nur das Vorübergehende war. Ich liebte Rom besonders am Morgen, wenn die Stadt kurz Atem holte, der Verkehr noch floss und die Touristen noch schliefen, wenn die Kellner Stühle und Tische auf den Bürgersteig rückten, es allerorten nach frischgemahlenen Kaffeebohnen und Cornetti aus den zahllosen Bars duftete, in die es die Römer mehrfach am Tag trieb, um einen raschen Caffè zu schlürfen.
Daheim in meiner Zweier-WG unweit Roms Hauptbahnhof Stazione Termini nahm ich eine schnelle Dusche, schlüpfte in Jeans und T-Shirt, ohne dabei die Uhr aus dem Auge zu verlieren. Wie üblich war ich verdammt spät dran. Auf der Suche nach meinem zweiten Sneaker turnte ich durch das Zimmer, dessen Zustand sowohl meinen schmalen Geldbeutel als auch meinen wenig ausgeprägten Sinn für Ordnung widerspiegelte. Die Vorlesung von Professor Fortunato wollte ich heute auf keinen Fall versäumen, zumal er eine besondere Vorführung im großen Hörsaal angekündigt hatte.
Ich studierte im dritten Jahr Informatik mit Studienschwerpunkt Bioinformatik und App-Entwicklung an der römischen Uni Sapienza. Auch wenn ich ein wenig über die Stränge schlug, mein Studium blieb mir das Wichtigste.
Ich bändigte meine noch feuchten dunklen Haare mit einem einfachen Gummi, schnappte mir meine Jacke und meinen knallroten Helm und fegte die Treppe hinab. Beinahe hätte ich den alten Herrn im Erdgeschoss, der bei uns im Haus Methusalix hieß, umgerannt, rief ihm ein Scusi zu, erhielt ein knorriges questa ragazza! zurück, erreichte den Bürgersteig, hetzte um die Ecke und schob die Garage auf, die ich mir mit meinen Nachbarn teilte. Ich schwang mich auf meine betagte Vespa und gab nichts auf das unheilvolle Scheppern beim Anlassen, sie klang nie anders und hatte mich bisher nie im Stich gelassen. Ich gab Gas. Der Verkehr rund um die Stazione Termini war wie immer extrem und nichts für Feiglinge. Der Trick war gar nicht erst lange nachzudenken, sondern sich kopfüber hineinzustürzen. Gleich im ersten Kreisverkehr kam ich einer schwarzen Protz-Limousine mit verspiegelten Scheiben ins Gehege. Die fuhr eindeutig zu schnell und ich hatte die Wahl, sie entweder zu schneiden oder mich zurückfallen zu lassen. Ich hatte es eilig, also Ersteres. Hätte ich das amerikanische Nummernschild bemerkt, hätte ich den Blödsinn gelassen. Aber wer rechnet denn mit sowas?
Der Fahrer musste jedenfalls hart in die Bremsen steigen und quittierte meine Aktion mit wildem Hupen. Er zog wieder an, brachte die Limo neben mich und zeigte mir durch das offene Fenster den Mittelfinger.
Ich verdrehte die Augen. Sollte sich doch dieser Bonze an die Regeln halten und nicht wie ein Gestörter im Kreisverkehr …! Ich ließ mich daher zurückfallen, schnitt ihn bei nächster Gelegenheit nochmals und zwang ihn wiederum scharf in die Bremse, dass die Reifen nur so qualmten. Ich war längst weggeschlängelt. Oh, wie ich den römischen Verkehr liebte! Nichts trieb mein Adrenalin derart auf die Spitze. Ich brauchte das, diese ständige Herausforderung, Grenzen auszuloten, Risiken einzugehen und Gefahren zu trotzen. Das Leben zu spüren, hielt mich am Leben. Ich weiß, dass das ziemlich verkorkst klingt, nach einer Dauerkarte beim Psychiater. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich kenne ja den Grund, warum ich bin, wie ich bin. Wer mit meiner Vergangenheit nicht verkorkst sein würde, der werfe den ersten Stein.
Es war ein schmaler Grat zwischen Leben und Wahnsinn, auf dem ich balancierte – vielleicht dem Zustand ähnlich, wenn man ein Glas Champagner auf nüchternen Magen getrunken hatte. Ein bisschen beschwipst, und man bekommt diese unbändige Lust, etwas Albernes zu tun, kann sich aber noch zügeln. Ich zügelte mich nicht. Ich lebte den Moment.
Meine Vespa begann inzwischen zu husten wie ein alter Asthmatiker. Zwei Straßen vor der Uni spuckte der Auspuff noch eine letzte dunkle Wolke aus, und den restlichen Weg durfte ich mein Mofa schieben. Vielleicht, dachte ich, könnte meine treue Gefährtin auch einen Lebensgeister weckenden Katalysator vertragen. Ich stellte es in den dichten Wald aus Zweirädern auf dem Campus, sprintete ins Gebäude, jagte über lange Flure durch die verschiedenen Fakultäten, nahm die letzte Biegung etwas zu flott und schlitterte beinahe kopfüber in den Gang hinein.
Gott sei Dank war ich nicht das Schlusslicht. Vor mir lief Franz, ein deutscher Student. Im vorigen Semester war er Bestandteil meiner teutonischen Speisekarte gewesen. Er hatte sich als ziemlich zupackend erwiesen, und obwohl ich das Heft beim Sex ungern aus der Hand gebe, fand ich es damals gar nicht übel, wie er die Initiative ergriffen hatte. Ich schweife ab.
Vor mir drängten noch einige weitere Spätankömmlinge auf die Tür des Hörsaals zu. Plötzlich stoppte ich im vollen Lauf ab.
Neben der Tür lehnte eine massige Gestalt im dunklen Anzug, eine Chauffeursmütze in der Hand. Ich erkannte in ihm einwandfrei meinen Straßenkontrahenten wieder. Ausgerechnet … Wie kommt der hierher?
Ich hatte Franz eingeholt, schnappte mir geistesgegenwärtig seinen Arm und drängte mich an ihn gepresst in den Saal. Leider hatte mich der Fahrer ebenso erkannt. Sein grimmiger Blick klebte auf meinem signalroten Helm mit dem weißen Kreuz auf der Stirnseite. Meine Freunde hatten ihn mir zu meinem 21. Geburtstag geschenkt. Erstens, weil meiner so verbeult und verschrammt gewesen war, dass er keiner Verkehrskontrolle mehr standgehalten hätte und zweitens, weil mein Spitzname Svizzera lautete, da ich, sobald es um politische Themen ging – das Brot der Studenten – mich neutral zurückhielt wie die Schweiz.
Drinnen löste ich mich sofort von Franz, der sich scheinbar Hoffnungen auf eine Wiederholung unserer Bettakrobatik gemacht hatte, und quetschte mich in den nächsten freien Sitz. Den Helm nahm ich zwischen die Füße. Nun erst fiel mir auf, dass etwas nicht stimmte. So brechend voll hatte ich den Hörsaal noch nie erlebt. In der Luft lag erwartungsvolles Stimmengemurmel wie vor einem Taylor Swift-Konzert. Hatte ich etwas verpasst? Und woher stammten die vielen Frauen im Saal? Informatik war noch immer eine männliche Domäne und der Anteil der weiblichen Studenten betrug weniger als zwanzig Prozent.
»Was ist denn los? Findet hier nicht die Vorlesung von Professor Fortunato statt?«, erkundigte ich mich bei der Studentin zu meiner Rechten.
»Nein, die wurde doch schon gestern abgesagt. Wegen Riccardo West.« Sie seufzte den Namen mehr, als dass sie ihn aussprach. Darum verstand ich sie im ersten Anlauf nicht sogleich.
»Wer zum Teufel soll das sein?«, zischte ich. Verdammt, und dafür hatte ich mich jetzt so beeilt!
Sie sah mich an, als wäre mir eben ein Geweih gewachsen. »Na, Riccardo West, der Internet-Tycoon!«
Scheiße! Der ist hier? Natürlich war mir sein Name ein Begriff. Jeder kannte den Typen, insbesondere die Informatikstudenten. Der Amerikaner galt in unseren Kreisen als Legende. Was wollte der hier? Etwa einen Vortrag halten? Ich hatte darauf keine Lust, schnappte mir meinen Helm und stand auf, um mich zu verdrücken. Vielleicht gelang es mir, in der Zwischenzeit mein Mofa wieder zum Laufen zu bringen. Den bulligen Chauffeur hatte ich kurzzeitig verdrängt. In dieser Sekunde schwang die untere Tür zum Hörsaal auf, zu spät für mich, um noch unauffällig zu verschwinden. Missmutig plumpste ich zurück auf den Sitz und machte mich so klein wie möglich, auch, weil hinter mir jemand ziemlich laut flüsterte: »Setzen, Svizzera!«
Der Dekan, der Vizedekan, Professor Fortunato und zusätzlich ein halbes Dutzend Hochschullehrer hielten feierlich Einzug. Das bekam ich aber nur am Rande mit, da ich kurz abgetaucht war, um den Helm wieder zu meinen Füßen zu platzieren.
Unvermittelt ging ein kollektiver Seufzer durch die weibliche Studentenschaft.
Ich kam wieder hoch und da sah ich ihn: Riccardo West. Okay, ein interessantes Exemplar von Mann. Kein Schönling, sondern eher von der männlich kantigen Sorte. Nicht mehr jung, soweit ich wusste, ging er schon auf die vierzig zu, aber ansonsten … Groß, breitschultrig, fast schwarze Haare und das verwegene Auftreten eines Piraten, der die sieben Weltmeere beherrscht. Kein Wunder, dachte ich ein wenig abschätzig, dass rundherum gerade eine Menge Höschen feucht wurden. Wests Aura der Macht und Selbstsicherheit schien nicht nur die weibliche Zuhörerschaft in seinen Bann gezogen haben, auch die Professoren hatten sich duckmäuserisch um ihn geschart, und selbst der Dekan machte sich für ihn krumm. Das alles nur wegen West’ sagenhaftem Vermögen. Ich kannte mich mit dieser Sorte reicher Narzissten aus: Sie waren der Pesthauch, der die Welt verseuchte, kannten weder Skrupel noch Menschlichkeit und wollten nur eins: über andere herrschen, und dafür war ihnen jedes Mittel recht.
Wohl oder übel musste ich mir nun die Lobhudelei des Dekans reinziehen, der Riccardo West ankündigte, als handele es sich bei ihm um den Messias persönlich, und im Anschluss noch Wests Vortrag.
Zugegeben, der war nicht einmal so übel. Wenigstens wusste der Mann, wovon er sprach und das Ganze in lupenreinem Italienisch. Trotzdem hoffte ich, dass die ganze Chose bald ein Ende fände. In der Eile hatte ich nicht einmal Zeit für einen Kaffee gehabt und inzwischen lechzte ich förmlich nach einem Latte macchiato.
Nach seinem Vortrag meinte West, wer Fragen habe, könne sie jetzt stellen, und wo sonst Ebbe herrschte, schossen plötzlich wie in einer einzigen La-Ola-Bewegung allerorts Arme in die Luft. Weibliche Arme.
Es entspann sich eine muntere Diskussion, während der ich West vor allem dafür bewunderte, dass er sein Sakko nicht ablegte. Im Saal herrschte eine Bullenhitze, und mir war selbst in Shorts und T-Shirt zu warm. Ich begann mich zu langweilen und überlegte, ob ich mich nicht doch davonmachen könnte. Dabei wurde ich seit geraumer Zeit das Gefühl nicht los, als würde ich beobachtet werden. Im Laufe der letzten Jahre hatte ich dafür einen sechsten Sinn entwickelt. Vorsichtig drehte ich mich ein wenig und bemerkte kaum zehn Meter hinter mir entfernt den Chauffeur. Er verharrte wie eine Schildwache beim Ausgang und der Ausdruck seiner Augen ließ nichts Gutes vermuten. Der wollte ein Hühnchen mit mir rupfen. Logisch, dass ich darauf gerne verzichtete. Ich war nicht feige, aber da der Mann zweifellos zu Wests Entourage gehörte …
Typen wie West ging ich schon aus Prinzip aus dem Weg, und Amerikanern im Allgemeinen sowieso. Da der nächste Ausgang für mich blockiert war, liebäugelte ich mit dem unteren, der eigentlich den Professoren vorbehalten war. In diesem Fall müsste ich mich durch den Strom der hinausstrebenden Studenten kämpfen.
Endlich verabschiedete sich der Amerikaner. Unter tosendem Applaus, der in Standing Ovations überging – wobei sich einige Studenten nicht entblödeten und um Zugabe riefen –, strebte er, gefolgt von der buckligen Professorenriege, aus dem Saal.
Die Gänge waren sofort verstopft und es würde ewig dauern, mich da hindurch zu boxen. Mir kam da eine bessere Idee. Ich kletterte über die Stuhlreihen hinweg nach unten, obwohl das eigentlich genauso verboten war. Nichts wie raus hier. Der volle Saal, die abgestandene Luft, die Hitze und die Enge, das alles machte mir zu schaffen. Auch wenn ich es mir ungern eingestand, laborierte ich noch an den Auswirkungen meines morgendlichen Albtraums, der gnadenlos das Tor zu einer Vergangenheit aufgestoßen hatte, an die ich nicht erinnert werden wollte.
Als ich über die vorderste Reihe stieg, fiel mir reichlich spät ein, dass die Professoren ihre Tür abgesperrt hielten, und konnte nur beten, dass sie es in der West’schen Euphorie einmal vergessen hatten. Ich drückte die Klinke, die Tür gab bereitwillig nach und ich stieß sie schwungvoll auf. Na bitte, Glück muss man haben! Oder auch nicht. Denn ich prallte gegen einen festen Körper, der eben zur Tür hereinwollte, und zu allem Überfluss ließ ich meinen Helm fallen. Mein Gegenüber zeigte Reaktion, bückte sich blitzschnell und fing ihn noch vor dem Boden ab. Sodann richtete er sich auf, aber anstatt mir den Helm zu geben, rief er auf Italienisch: »Sieh an, Sie sind das!«
Seine Worte erschreckten mich so sehr, dass alles Blut in meine Beine sackte und mein Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekam. Ich starrte Riccardo West nur an. Aus der Nähe war er noch eindrucksvoller und ich konnte seine kraftvolle Ausstrahlung spüren, als würde er feine elektrische Impulse aussenden. Tatsächlich fühlte es sich an, als sei ich in ein Spannungsfeld geraten. Sekundenlang war ich unfähig, mich daraus zu lösen, und schaute in seine unfassbar blauen Augen. Verdammt, was tat ich da? Stand blöd herum und glotzte kuhäugig – ich musste hier weg.
Hastig griff ich nach meinem Helm, um mich davonzumachen. Doch er hielt ihn unerbittlich fest. »Wohin so eilig?«, fragte er. »Sie sind mir einen Kaffee schuldig. Und ein Hemd …«
Wie bitte?Wovon, zum Teufel, schwafelte der Typ?
West stellte meinen Helm zwischen seinen Wildlederschuhen ab und begann, sein Sakko aufzuknöpfen.
Das lenkte meinen Blick von seinen verstörenden Augen automatisch auf seine Hände. Sie waren gutgeformt mit langen, kräftigen Fingern. Natürlich war das eine rein rationale Betrachtung. Eine Ist-Analyse. Immerhin war ich angehende Informatikerin.
West zog das Sakko aus, hakte seinen Zeigefinger in den Aufhänger und warf es sich mit Schwung über die rechte Schulter. Selbst einem Blinden würde der monströse Kaffeefleck auf dem ansonsten blütenweißen Hemd ins Auge stechen.
Es war nicht schwer, eins und eins zusammenzuzählen: Kaffee im Auto. Vollbremsung. Eine Mofafahrerin, die sich davonschlängelte. Der verflixte signalrote Helm! Schuldig … Trotzdem durchrieselte mich Erleichterung. Darum ging es also! Das hatte er vorhin gemeint mit Sieh an, Sie sind das!
Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich befürchtet, dass er mich erkannt hatte. »Könnte ich bitte meinen Helm zurückhaben?«, presste ich mit einer Stimme hervor, die mir selbst fremd klang. Ich bückte mich danach, aber dieser unverschämte Kerl stellte nun seinen Fuß darauf, als wäre er ein antiker Eroberer und mein Helm der Kopf des besiegten Feindes. Mir brannte bereits eine entsprechende Bemerkung auf der Zunge, als sich ein Mann, bis dato durch Wests breite Schultern abgeschirmt, näherte und sich beflissen erkundigte: »Haben Sie Ihr Etui gefunden, Signore West?«
Verflixt, der Dekan!
Der sah neugierig von West zu mir, bis seine Augen auf meinem roten Helm haften blieben. West nahm seinen Wildledermokassin herunter, beugte sich ganz nah an mein Ohr und raunte, nur für mich hörbar: »Glück gehabt.« Er drückte mir den Helm in die Hand.
Ich nickte dem Dekan zu, wandte mich ab und zwang mich, ruhig einen Fuß vor den anderen zu setzen. Der Flur war ungefähr so lang wie die Via Appia und ich spürte die Blicke der beiden Männer auf meinem Rücken brennen wie Laserstrahlen. Sobald ich um die Ecke war, nahm ich die Beine in die Hand.
Ich befürchtete, West würde den Dekan nach meinem Namen fragen, und konnte nur hoffen, dass der ihn nicht kannte.
Was für ein Scheißtag! Wütend pfefferte ich zuhause Helm und Tasche in die nächste Ecke. Erst laufe ich diesem Amerikaner über den Weg, und dann springt meine Vespa trotz aller Bemühungen nicht mehr an!
Im Resultat musste ich sie eine knappe Stunde bis zur Werkstatt schieben und danach musste ich noch einmal genauso lange bis nach Hause laufen, weil ich kein Geld mehr für den Bus übrighatte. Von meinen letzten zwei Euro hatte ich mir einen Latte macchiato gegönnt und die restliche Barschaft war schon gestern für Katzenfutter draufgegangen. Gemeinsam mit anderen Tierfreunden versorgte ich eine Schar herrenloser Katzen, die einen Teil des Largo Argentina bevölkerten, einem vorchristlichen Tempelbezirk. In der Werkstatt hatte mir mein Mechaniker Floriano mitgeteilt, dass meine Vespa einen neuen Vergaser benötige und der Auspuff so gut wie durchgerostet sei. Zwar würde mir Floriano alles gebraucht besorgen, aber mit hundertfünfzig Euro müsste ich schon rechnen. Das war ein Wochenlohn und verdammt viel Geld für mich.
Nachdem ich mir im Bad den Ruß von Händen und Gesicht geschrubbt hatte, stapfte ich in die Küche und durchstöberte den Kühlschrank. Der stammte noch von unseren Vormietern, die ihn vermutlich von deren Vormietern hatten, ein vorsintflutliches Monstrum, das sich durch den Tag rumpelte und pumpelte, als wohnte ein Geist im Eisfach, aber nebenbei auch der sauberste und ordentlichste der Welt war. Dieser Verdienst war keineswegs mir zuzuschreiben, sondern meiner spanischen Mitbewohnerin Marisol. Sie kochte einfach fantastisch und immer auf Vorrat. Ohne sie würde ich mich von Pizza und Sandwiches ernähren, mit ihr hatte ich den Tempel der feinen Genüsse betreten. Ich besaß keinerlei Draht zu Gott, aber Marisol musste mir damals der Himmel geschickt haben.
Ich ging die verpackten und akribisch beschrifteten Plastikbehälter durch und entschied mich für eine Paella, die ich kalt aus der Dose löffelte, weil ich gleich meine Schicht in der Trattoria antreten musste. Ich arbeitete dort jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 18 Uhr bis Mitternacht. Bei besonderen Anlässen half ich auch am Wochenende aus. Normalerweise aß ich in der Trattoria auch zu Abend, aber nach dem heutigen Tag musste ich meinen Bärenhunger sofort stillen. Ich kompensiere Anspannung grundsätzlich mit Essen, bevorzugt mit Marisols selbstgemachten Marzipanpralinen, und durchstöberte nun ihre diesbezüglichen Vorräte. Marisol war nicht nur eine unglaublich gute Köchin, sondern vor allem eine begnadete Konditorin. Es war ihr Beruf. Derzeit stand sie im letzten Jahr ihrer Ausbildung. Nur mit der italienischen Sprache haperte es hier und da. Auf diese Weise schnappte ich eine ganze Menge Spanisch von ihr auf.
Marisol und ich hatten uns bei der Wohnungsbesichtigung kennengelernt und waren beide begeistert von der charmanten Wohnung gewesen: zentrale Lage, zwei Zimmer, Küche, Bad.
Leider hatte sich keine von uns den Mietpreis allein leisten können und Marisol hatte vorgeschlagen, dass wir ihn halbieren könnten, in dem wir zusammenzogen. Außer dem antiken Kühlschrank hatten die Vormieter nur Sperrmüll und nikotingelbe Tapeten dagelassen, und dem Leistungsvermögen meines Geldbeutels angemessen, durchstöberte ich an zwei Sonntagen den Flohmarkt auf dem Porta Portese und führte stolz meine Schätze heim: ein quietschendes Eisenbett, eine klemmende Kommode, plus ein wackeliger Tisch mit Stuhl, eine Kleiderstange ersetzte mir den Schrank und eine Weinkiste den Nachttisch. Mehr brauchte ich nicht und mehr passte auch nicht auf meine zwölf Quadratmeter. Ich freute mich wie ein Schneekönig über meine ersten eigenen Möbel, brachte die Kommode auf Vordermann, spendierte dem Bett etwas Öl und dem Tisch und Stuhl ein paar zusätzliche Schrauben. Selbst ist die Frau! Marisol reagierte entsetzt auf meinen kärglichen Einrichtungsstil. Flohmarkt kam bei ihr nicht in die Tüte. Ein Anruf bei ihrer Madrecita in Roja, und alsbald rückten vor dem Haus zwei der vier Brüder Marisols per Lkw aus Katalonien an, mit Möbel beladen, die jeder mittelalterlichen Burg gut angestanden hätten, aber nun mit einer heruntergekommenen Mietskaserne im Bahnhofsviertel vorliebnehmen mussten. Ein massives braunes Möbelstück nach dem anderen wanderte auf den Schultern der Brüder über vier Stockwerke herauf in Marisols Zimmer, das gerade einmal zwei Quadratmeter größer war als meines. Und jedes, wirklich jedes dieser Teile besaß Klauenfüße, als seien sie dazu bestimmt, nachts umherzuwandern. Beim Anblick des schweren geschnitzten Kleiderschranks fragte ich Marisol: »Bist du sicher, unser Fußboden hält das aus?« Da hatte ich noch nicht ihr Doppelbett gesehen mit seinen vier gedrechselten Säulen, die einen plüschigen Himmel aus rotem Samt mit goldenen Posamenten trugen. Es war beinahe unmöglich, sich in ihrem Zimmer zu bewegen oder Schränke zu öffnen, aber das würde Marisol niemals eingestehen. Die Möbel stammten aus ihrem Zuhause, sie waren Heimat und besaßen damit jede Daseinsberechtigung.
Seit knapp drei Jahren wohnten wir nun zusammen und wir hätten kaum verschiedener sein können. Marisol liebte Ordnung, bei mir herrschte das Chaos, Marisol fand in ihrer leutseligen Art sofort Zugang zu den Menschen, ich reagierte eher mit Zurückhaltung auf neue Bekanntschaften, und was meine Technikbegeisterung anbetraf, hier blieb Marisol überaus skeptisch; sie besaß nicht einmal einen Computer, nur ein altes Handy, das noch mit Dampf betrieben wurde. Und dennoch oder gerade deswegen waren wir längst beste Freundinnen geworden. Ich wusste alles über Marisol. Sie wusste nichts über mich – nur das, was sie wissen durfte. Dass ich eine Waise war und als Stipendiatin in Rom Informatik studierte. In Marisols Gegenwart schränkte ich mich ihr zuliebe beim Fluchen ein, denn sie war sehr gläubig und besuchte jeden Sonntagmorgen den Gottesdienst. Ich hielt das alles für einen riesengroßen Budenzauber und glaubte nicht an eine höhere Kraft oder ein höheres gutes Wesen, aber ich wusste, es gab das Böse. Der Himmel hatte bisher keinen Finger für mich gerührt, doch in Sachen Hölle war ich Expertin. Ich trug sie in mir.
»Así! En flagrante! Hab ich dich, Gina!« Mit einem breiten Grinsen und zwei vollgepackten Einkaufstaschen betrat Marisol unsere winzige Küche. So war das bei uns. Sie kam von der Arbeit, ich ging in die Arbeit. Zeit füreinander hatten wir nur richtig am Sonntag und Montag, wenn Marisol frei hatte.
Eine der Tüten trug die Aufschrift DaClaudio, Marisols Arbeitgeber, Inhaber der ältesten und feinsten Pasticceria Roms und seit Kurzem auch Gastgeber seiner eigenen Fernsehsendung. Nach ihrer Abschlussprüfung im Spätsommer hatte Marisol vor, nach Spanien zurückzukehren und in ihrer Heimatstadt Roja bei Barcelona ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Mir graute schon vor dem Tag, an dem meine Freundin mich verlassen und fortgehen würde.
»Du musst nicht so auf Taschen schielen«, meinte Marisol in ihrem charmant gebrochenen Italienisch, während sie ihrerseits auf die Schale Pralinen schielte, die ich schon zur Hälfte weggeputzt hatte.
Ich drückte sie ihr mit einem schuldbewussten Lächeln in die Hand. »Und, hast du heute deinen Traummann getroffen?« Die Frage war der Running Gag zwischen uns, und gerade diente sie mir auch als Ablenkung.
»No!«, rief Marisol, der es schwerfiel, leise zu sprechen. »Aber ich habe eine ganz neue Liste gemacht.«
Marisols Traummann-Liste war ungefähr so realisierbar wie das italienische Antikorruptionsgesetz und hing an einem Magneten am Kühlschrank. Marisol verlor nämlich niemals ihr Ziel aus den Augen. Darin glichen wir uns. Vermutlich war das die einzige Gemeinsamkeit, die wir teilten, außer unserer Freundschaft natürlich und der Sucht nach Marzipan.
Marisol entfernte nun die alte Liste und brachte mit geradezu rührendem Eifer ein neues Blatt an. Damit ich auch etwas über die Eigenschaften lernte, die ein guter Ehemann mit sich bringen sollte, hatte sie sie extra in Italienisch verfasst. Paragraf 1–4 lauteten immer gleich: Paragraf 1: Es muss eine Spanier sein!!!
Paragraf 2: Katholisch
Paragraf 3: Gute Humor
Paragraf 4: Muss gut riechen
Paragraf 5 … – nun, der war nicht ganz neu, aber die zusätzliche Ergänzung verblüffte mich. Sie lautete: Konditor wäre fein oder eine Blumenhändler.
»Warum sollte dein Zukünftiger einen Blumenladen besitzen?«, fragte ich unvorsichtigerweise.
Marisols Augen blitzten. »Dios mío, ist doch Logik! Dann könnte ich Torten für Hochzeit machen und er die Decoración!«
»Du bist eine echte Romantikerin, was?«, sagte ich.
»Sí, und muy práctica!« Sie strahlte.
Gina
Und wann genau soll die Aktion steigen?« Ich sah von Gianni zu Manfredo. Die zwei Brüder hatten ihrer kleinen Gruppe von Zuhörern ihren Vorschlag abwechselnd und mit Leidenschaft vorgetragen. Unsere familiäre Gruppe traf sich einmal die Woche in unserem Lieblingslokal in der Via degli Annibaldi, unweit der Informatik-Fakultät.
Gianfranco, der Wirt, stellte uns sein Hinterzimmer für unsere wöchentlichen Treffen zur Verfügung. Er hielt uns für eine Bande vorlauter junger Leute, aber harmlos. Ich wagte zu bezweifeln, dass er uns dort dulden würde, wenn er wüsste, was wir da wirklich so ausheckten.
Unsere heutige Zusammenkunft fand auf Giannis Bitte hin außerplanmäßig statt. Wir, das waren die Brüder Gianni und Manfredo aus Venedig, Gabriella, Manfredos Freundin und gleichfalls Venezianerin, Pasquale aus Palermo, Tiziana, die einzige Römerin unter uns – was wir nie vergaßen, da sie uns fortwährend daran erinnerte –, Klara aus Österreich, Reto aus der Schweiz (den ich im Übrigen stark im Verdacht hatte, mir den Helm mit der Schweizer Nationalflagge eingebrockt zu haben), Nojus aus der litauischen Hafenstadt Klaipėda und noch einige mehr. Wir waren eine Gruppe, die kleine, aber feine Guerilla-Aktionen zum Schutz der Umwelt durchführte. Vor knapp zwei Jahren war ich auf dem Weg zur Trattoria durch puren Zufall auf sie gestoßen. Ich war von der Vespa gestiegen, als Gianni auf der Flucht vor Polizisten fast in mich hineinrannte. Er und seine Mitstreiter hatten die Fontana di Trevi mit Protestplakaten verhüllt, um auf ein Referendum zum Bau von zwei neuen Atom-Reaktoren aufmerksam zu machen. Ich half Gianni aus der Patsche, indem ich ihn in den Hinterhof der Trattoria lotste. Ich kannte ihn bereits von der Uni, aber an jenem Tag begann unsere Freundschaft.
Ich hatte nicht lange überlegt, ob ich mich der Gruppe anschließen sollte. Das, wofür sie stand, entsprach meiner eigenen Überzeugung. Für sie tätig zu sein, gab meinem Leben einen Sinn, jenseits meiner Bestimmung. Vielleicht schuf ich mir damit für eine Weile die Illusion, das Leben zu führen, das das meine hätte sein können, würde es ihn nicht geben. Eine Art parallele Realität.
Mit der aktiven Beteiligung hielt ich mich trotzdem zurück, das hieß, ich war nie direkt vor Ort an einer Aktion beteiligt. Das hatte ich mir ausbedungen, weil ich mir keinen Zusammenstoß mit der Polizei leisten konnte und mich stattdessen zum Kopf der Planung aufgeschwungen. Inzwischen verantwortete ich die gesamte Logistik, kalkulierte die Kosten, besorgte die benötigte Ausrüstung, organisierte die An- und Abreise – insofern wir außerhalb von Rom operierten –, und mir oblag es auch, die möglichen Fluchtrouten auszuarbeiten, falls die Gruppe auf frischer Tat ertappt wurde wie damals an der Fontana di Trevi.
»In drei Tagen«, antwortete Manfredo jetzt auf meine Frage. Damit erntete er reihum wenig Begeisterung. Vor allen Dingen war ich nicht begeistert.
»So bald? Seid ihr verrückt geworden?«, legte ich los. »Ich kann unmöglich in so kurzer Zeit eine derartige Aktion außerhalb Roms planen!«
»Sorry, Gina, ich habe selbst erst heute Morgen von dieser einmaligen Gelegenheit erfahren. Die Pride of the Ocean legt nur für einen Tag vor Venedig an. Die Kostümgala und das geplante Feuerwerk um Mitternacht sind die idealen Voraussetzungen für uns. Getarnt durch die Kostüme können wir uns völlig easy unter die Gäste mischen. Der gesamte Ablauf ist fertiggeplant, die Fluchtroute steht auch und vor Ort unterstützt uns ein Freund mit seinem Wassertaxi. Venedig ist unsere City!« Gianni liebte Anglizismen. Nun nickte er seinem Bruder Manfredo zu. Der zog einen Packen Papiere aus dem Rucksack und jeder von uns bekam einen Flyer in die Hand gedrückt.
»Lies das, Gina, und du wirst sehen, dass ich an alles gedacht habe. Dir bleibt fast nichts mehr zu tun«, meinte Gianni eindringlich. Er wollte mich unbedingt überzeugen. Unsere Satzung besagte eindeutig, dass wir keine Aktion durchführten, der nicht alle vierzehn Mitglieder zugestimmt hatten. Eine misslungene Operation gefährdete schließlich die gesamte Gruppe, und die war klein und ziemlich bankrott, Anwälte kosteten Geld und Schadenersatzforderungen erst recht … Aus diesem Grund eiferten wir auch nicht den Aktionen der Letzten Generation oder Extinction Rebellion nach. Erstens wollte niemand von der Universität verwiesen werden, weil wir daran glaubten, das System nur von innen ändern zu können und zweitens war es in Italien nicht die beste Idee, sich auf einer Hauptstraße festzukleben. Da kannten weder die Carabinieri noch die Fahrer Spaß und irgendwer vergaß dann, auf die Bremse zu drücken. Tot konnten wir nichts mehr bewirken.
Ich konnte sehr gut nachvollziehen, warum den beiden Brüdern diese Unternehmung so sehr am Herzen lag. In ihrem Blut floss praktisch das Wasser der Lagune. Schon im 13. Jahrhundert fand ihre Familie Erwähnung im Silbernen Buch von Venedig, ihre Vorfahren hatten die Serenissima mitaufgebaut und damit zu ihrer Schönheit und Blüte beigetragen. Aufgrund jahrzehntelanger Ignoranz, Profitgier und überbordendem Kreuzfahrttourismus drohte der Stadt nun die Zerstörung. Viel zu lange wurde weggesehen, wollte man die Probleme nicht wahrhaben, aber das hat die Dinge noch nie besser gemacht. Es ist das Wegsehen, das die Welt zerstört.
Selbst die Geschäftemacher konnten sich nicht mehr davor verschließen, dass der Verfall der Lagunenstadt kaum mehr aufzuhalten war. La Serenissima dämmerte ihrem Untergang entgegen, in jüngster Zeit stark beschleunigt durch den Schiffsverkehr der Ozeanriesen – Kreuzfahrt- und Containerschiffe, deren Wellen massiv gegen die Pfähle schlugen, auf denen die Stadt einst errichtet worden war. Das unterspülte das Holz, Venedig sackte nachweislich jedes Jahr um einige Millimeter ab, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der sandige Untergrund dem nicht mehr standhalten würde. Die beiden Brüder wie auch ihre Eltern hatten sich seit Jahren an Demonstrationen und Unterschriftensammlungen vor Ort beteiligt und für eine Aufhebung der Liege-Erlaubnis für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Venedig gekämpft und letztlich einen Teilerfolg errungen. Seit August 2021 durften mit einer Ausnahmegenehmigung nurmehr Schiffe unter hundertachtzig Meter Länge und mit vermindertem CO2-Ausstoß am Canale di San Marco ankern. Das ging den Brüdern nicht weit genug, sie wollten erreichen, dass auch diese Ausnahme außer Kraft gesetzt wurde, weil sie die Korruption förderte. Es kursierten Gerüchte, dass man sich mit ausreichend Geld eine Genehmigung erkaufen konnte. Das Thema Venedig war auch mir wichtig, aber abgesehen davon, dass zwischen Rom und der Lagunenstadt 500 Kilometer lagen und wir noch nie so weit außerhalb Roms operiert hatten, schmeckte mir die gesamte Aktion nicht. Sie weckte in mir ein vages Gefühl der Beunruhigung. Warum, konnte ich nicht begründen. Aber meine Vergangenheit hatte mich gelehrt, auf meinen Instinkt zu hören.
Ich meldete meine Zweifel an. »Ehrlich, Gianni, wie zweckmäßig kann es sein, Stinkbomben in den Schiffszwischendecks zu zünden, wenn es unser Ziel ist, in der Öffentlichkeit ernsthafte Aufmerksamkeit für Klimaschutz zu erregen? Kürzlich, bei unserer jüngsten Tierschutzaktion, machten die Farbbomben Sinn. Aber Stinkbomben? Das sind bloße Scherzartikel. Die Presse wird uns allenfalls als infantile Spätpubertierende bloßstellen.«
»Wir entrollen auch unsere Transparente entlang der Schiffswand und hinterlassen Flugblätter mit den Fakten zum Ausmaß der Zerstörung.« Gianni schwenkte demonstrativ den Flyer.
»Mir gefällt Giannis Idee«, näselte Tiziana und nieste kräftig. Ihre Parteiergreifung überraschte mich nicht, Tiziana erprobte seit geraumer Zeit ihre Reize an Gianni, der zu ihrem Leidwesen nicht darauf ansprang. Tiziana suchte nun direkt meinen Blick: »Aber ich stimme Gina zu, Stinkbomben sind nicht ausreichend effektiv.« Damit überraschte sie mich nun doch. Bis sie weiterredete: »Warum verwenden wir nicht Tränengas?«
Ich versteifte mich. »Das können wir nicht machen, das Zeug ist gefährlich. Tränengas verursacht schwere Reizungen an Augen, Haut und Lungen.«
»Daran habe ich gedacht. Einer von uns könnte sich als Darth Vader verkleiden und ein Atemschutzgerät tragen!«
»Nein«, konterte ich. »Es geht nicht allein um uns. In unserer Satzung steht, dass wir nie jemandem absichtlich Schaden zufügen werden.«
»Du bist doch nur feige und versteckst dich hinter Paragrafen!«, blitzte mich Tiziana an. »Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!«, zitierte sie.
»Den Spruch hast du fein geübt. Frage: Wer bestimmt Recht und Unrecht? Du vielleicht? Der Zweck heiligt nicht die Mittel, Tiziana. Wenn wir uns untreu werden, dann sind wir nichts als Heuchler.«
»Die Rede hast du fein geübt!«, keilte sie zurück. »Ich drücke mich wenigstens nicht so wie du!«
Bevor ihr Temperament völlig mit ihr durchging, legte Gianni ihr die Hand auf den Arm. »Lass gut sein, Tiziana. Tränengas ist Bullenscheiß, aber nicht der unsere.«