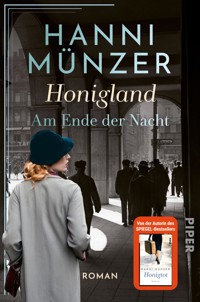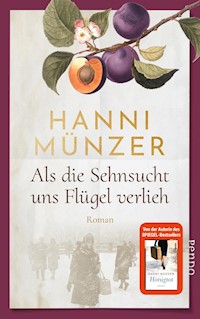
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Kathi und Franzi werden Ihr Herz brechen. Und es wieder reparieren.« Hanni Münzer über »Als die Sehnsucht uns Flügel verlieh« Wenn das Kriegsende zum aufwühlenden Anfang wird: ein großer historischer Roman über die Suche nach einem Ort zum Wurzelnschlagen Hanni Münzer begibt sich in der Fortsetzung ihrer Heimat-Saga erneut auf eine Zeitreise und erzählt eine mitreißende Geschichte über Heimatverlust, Frauenemanzipation und den Wettlauf ins All. Im Mai 1945 werden das junge Mathematikgenie Kathi Sadler und ihre Schwester Franzi nach Moskau verschleppt. Kathi soll den sowjetischen Machthabern bei der Entwicklung ihres Raumfahrtprogramms helfen, Franzi dient dabei als Druckmittel. Über Jahrzehnte kämpft Kathi gegen den Schmerz der Entwurzelung, für eine Gefühl von Heimat und um einen Funken Hoffnung in dunklen Zeiten. Münzers schillerndes Erzähltalent verleiht ihrem historischen Epos einen mitreißenden Sog, der Geschichte und Gefühl zu einem wunderbaren Schmöker vereint. Hanni Münzers Heimat-Saga – der fesselnde Generationenroman der Bestsellerautorin von »Honigtot« Familie, Heimat und Gefühl sind Hanni Münzers Herzensthemen. Schon über eine halbe Million Exemplare ihrer packenden Romanserien haben ihren Weg auf die Bücherstapel begeisterter Leser gefunden, die sich mit Haut und Haar auf ergreifende Schicksale einlassen wollen. Die aufwühlende Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers »Heimat ist ein Sehnsuchtsort« »Es geht um Liebe und Leidenschaft, um Historie, um Menschen, Geheimnisse, Hoffnung, Leid und Glück. Es ist wohl genau diese Mixtur, die Münzers Werke zu Bestsellern macht.« Fürther Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Als die Sehnsucht uns Flügel verlieh« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2020
Redaktion: Myriam Welschbillig
Karte: Marlise Kunkel, München
Covergestaltung: u1 berlin/Patrizia Di Stefano
Covermotiv: De Agostini Picture Library/Bridgeman Images; Aaron Foster/Getty Images; ullstein bild – SPUTNIK; privat
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karten
DRAMATIS PERSONAE
Die Bewohner des Sadlerhofs
Petersdorfer und andere Personen
Heilige
PROLOG
Über den Wolken, zwischen Gleiwitz und Moskau, im August 1945
1
2
3
4
5
6
7
8
DRAMATIS PERSONAE
(Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.)
Die Bewohner des Sadlerhofs
Katharina Sadler (geb. 1928), genannt Kathi, eine mathematische Ausnahmebegabung
Franziska Sadler (geb. 1935), Kathis Schwester, genannt Franzi; leidet an Sklerodermie, lebt in ihrer eigenen kleinen Welt
Laurenz Sadler (geb. 1901), Kathis Vater – ein Landwirt, der im Herzen Musiker ist
Annemarie Sadler (geb. 1899), Kathis Mutter, eine Frau mit bewegter Vergangenheit und einem Geheimnis
Charlotte Sadler (geb. 1873), Laurenz’ Mutter und Kathis Großmutter, eine Pferdenärrin und Zigarren rauchende Exzentrikerin
August Rudolf Sadler (geb. 1865), Mann von Charlotte und Kathis Großvater. Ein Kriegsversehrter
Paulina Sadler, geb. Köhler, Witwe von Kurt Sadler, Laurenz’ Sadlers älterem Bruder
Dorota Rajewski, Olegs Ziehmutter, Wirtschafterin auf dem Sadlerhof mit Vorliebe für italienische Küche. Lebensklug und stets gut gelaunt. Besitzt die Gabe des Zweiten Gesichts.
Oleg Rajewski, Dorotas Ziehsohn, Knecht, begnadeter Handwerker und Kathis guter Freund
Petersdorfer und andere Personen
Der wundersame Herr Levy. Ein Wanderhändler
Berthold Schmiedinger, Pfarrer von Petersdorf; im Herzen ein Rebell
Milosz Rajewski, Dorotas Neffe und Kathis Freund; polnischer Mathematiker, Kryptologe und Geheimdienstler
Dimitri Domratchev, Offizier des russischen Geheimdiensts NKWD
Wanja Domratcheva, seine Frau
General Gennadi Pchela, Chef des militärischen Geheimdiensts GRU
Ludmila Pchelava, seine Frau
Nikolaj Pchela (geb. 1923), Kommunist, genialer Ingenieur und Physiker, leitet eine eigene Forschungsgruppe, liebt die Mundharmonika
Kirill Merkulow, General Pchelas Bursche
Anatoli Kobulew, Astrophysiker, ein Mann, als sei er der Rübezahl-Sage aus dem Riesengebirge entsprungen
Pelageja Kobulewa, seine Schwester, kleinwüchsige, weise Frau, bewandert in den alten Künsten
Oberst Xenia Michailowna Liskowa, *Lawrenti Berijas Nichte
Semjon Jakowlewitsch Semjonowitsch, Leiter der SMERSCH, ein Spion
Pawel Pawlowitsch Sergejew, sowjetischer Chefkonstrukteur der Sputnik-Satelliten.
Konstantin Pawlowitsch Sokolow, russischer Spion, Tschekist
Grigorij Taubman, Testpilot, Nikolajs bester Freund
*Lawrenti Berija, Volkskommissar, Chef des sowjetischen Geheimdiensts NKWD bis 1953
*Wasili Blochin, Henker und Mörder von Katyn
*Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, Führer (Woschd) der Sowjetunion, Generalissimus, Kampfname: Stalin, der Stählerne; engste Freunde nannten ihn Koba
*Juri Gagarin, Kosmonaut, erster Mensch im All
*Oleg Gasenko, Wissenschaftler und Begründer der Raumfahrtmedizin
*Sir William Hayter, englischer Botschafter in Moskau
*Igor Wassiljewitsch Kurtschatow, führender Atomwissenschaftler der Sowjetunion
*Alexander Poskrebyschew, Stalins treuer Staatssekretär, ehemaliger Pfleger
*Laika, Belka und Strelka, die tapfersten Hunde der Welt
Heilige
Die Madonna von Tschenstochau
Für Papi, unvergessen …
Allen gewidmet:
den Liebenden
den Sehnenden
den Einsamen
den Gesunden
den Kranken, die hoffentlich schnell genesen,
den Mutigen
den Verzagten
den Träumenden
den Hoffenden
den Heimatlosen
jedem Lebewesen unseres Paradieses,
der Erde …
»Was ist Liebe? Was ist Schöpfung?
Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?«
– so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Friedrich Wilhelm Nietzsche»Also sprach Zarathustra«
PROLOG
Über den Wolken, zwischen Gleiwitz und Moskau, im August 1945
In der Kabine der Tupolew war es eiskalt, der Lärm ohrenbetäubend, die Sitzbank aus Metall unbequem, und der penetrante Benzingestank nahm einem die Luft zum Atmen. Kathi fand es herrlich. Sie flog! Das erste Mal in ihrem Leben sah sie die Welt von oben. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, zu fantastisch, um es in Worte zu fassen. Neben ihr festgeschnallt, saß ihre neunjährige Schwester Franzi. Sie hatte ihr kleines Gesicht gegen die Scheibe gepresst und summte: Ich bin eine Biene!
Für einen kurzen, leuchtenden Moment rückte das Erlittene in den Hintergrund: die Schrecken des Krieges, der bittere Verlust der Großeltern, das ungewisse Schicksal der in den Kriegswirren vermissten Eltern. Und auch das eigene Schicksal.
Denn mit jeder Sekunde in der Luft entfernten sich die beiden Schwestern weiter von ihrer Heimat, wurden sie in ein fremdes Land entführt. Als Kriegsbeute.
1
Nichts ist über Moskau als der Kreml,
und über dem Kreml ist nichts als der Himmel.
Russisches Sprichwort
Moskau. Moskwa. Seit Stunden rollte und holperte der Name der Hauptstadt Russlands durch Kathis Gedanken – wie ein Rad, das sich seinen Weg durch schwieriges Gelände sucht. Zu unwirklich war das, was ihr, Katharina Sadler aus dem winzigen schlesischen Petersdorf, passierte.
Im ersten Morgennebel hatte sie das Flugzeug in Gleiwitz bestiegen. Nein, korrigierte sich Kathi, nicht mehr Gleiwitz. Jene Stadt, in der sie bis zum vorigen Jahr die höhere Schule besucht hatte, in der sie mit ihrem Jugendfreund Anton im Wilhelmbad schwimmen war und im Café Haus Oberschlesien Kakao getrunken und Mohnstriezla gegessen hatte, gab es so nicht mehr. Gleiwitz hieß nun Gliwice, und seit März gehörte es zu Polen. Die Sowjetarmee hatte die Stadt im Januar ’45 eingenommen und die Verwaltung wenig später an Polen, ihren neuen Verbündeten, übergeben.
Längst hatte die kleine Tupolew das in Trümmern liegende Warschau hinter sich gelassen, war zum Auftanken kurz in Minsk gelandet, und nun überflogen sie bereits das Gebiet von Smolensk.
Immer wieder verirrten sich Kathis Augen in das Cockpit, zu Niklas. Von ihrer Position im Frachtraum aus sah sie nicht mehr von ihm als einen Teil seines Rückens. Uniform, Mütze, Brille und Kopfhörer machten ihn ohnehin völlig unkenntlich.
Der junge deutsche Kommunist und Physiker, der sich freiwillig der Roten Armee verpflichtet hatte, war erst vor Kurzem in Kathis Leben getreten. Doch seither war die Welt für sie eine andere. Er war der Grund, weshalb sie nicht in stiller Verzweiflung den Verlust ihrer Freiheit beklagte, sondern mit wachsamer Neugier der Dinge harrte, die die Zukunft für sie bereithielt. In Kathi vereinigten sich die guten Anlagen ihres seit der Schlacht von Leningrad vermissten Vaters Laurenz. Er hatte sie gelehrt, dass es noch niemals etwas geändert hatte, sich zu beklagen. Und es ging hier auch nicht um sie selbst: Ihr oblag die Verantwortung für ihre jüngere Schwester Franzi. Ihre Sorge um diesen geliebten Menschen verdrängte ihre eigenen. Zum wiederholten Male vergewisserte sich Kathi, dass Franzi nicht fror. Sie trug warme Winterkleidung, und zusätzlich hatte sie sie vor dem Abflug in eine Militärdecke gewickelt. Die zarte Franzi reagierte seit jeher empfindlich auf Kälte, darüber hinaus litt sie an einer unbekannten chronischen Krankheit, die sich bislang jeder Behandlungsform entzogen hatte. Ihr Körper wies schuppenartige Male auf, die Haut darüber war hart wie ein Panzer. Auch von ihrer Lippe bis zur Wange zog sich seit ihrer Geburt einer dieser auffälligen Flecken. Ihr Mund war deshalb winzig, kaum mehr als ein kleines O. Deshalb hatte Franzi auch nie richtig sprechen gelernt. Aber die Schwestern fanden früh ihre eigene Form der Verständigung: Sie summten die Buchstaben, aus Wörtern erwuchsen Tonfolgen, und daraus entstanden ganze Sätze.
Franzi war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Sie konnte verloren geglaubte Dinge überall aufspüren und verfügte auch über die Fähigkeit, sich nahezu unsichtbar zu machen. Was ihr gestattete zu verschwinden, wie und wann es ihr beliebte. Franzis größtes Geheimnis jedoch bestand in ihrer bemerkenswerten Beziehung zu Tieren, insbesondere zu Bienen. Sie umschwärmten Franzi, als wäre sie Teil ihres Stocks, ließen sich auf ihr nieder und hielten still, wenn Franzi sanft ihre pelzigen Rücken streichelte.
Berthold Schmiedinger, Pfarrer ihrer Heimat Petersdorf, war einmal Zeuge dieses ungewöhnlichen Schauspiels geworden und fand eine spirituelle Erklärung: Wie der heilige Franz von Assisi sei Franzi mit göttlichen Eigenschaften gesegnet. Der Pfarrer selbst hatte keinen Schutzpatron gehabt. Im Krieg war er von den Nazis verhaftet worden; sein weiteres Schicksal war ebenso ungewiss wie das so vieler guter Menschen. Kathi musste oft daran denken, was ihr Vater bei Kriegsbeginn gesagt hatte: Der Krieg ist ein Dieb, er stiehlt Hoffnung, er stiehlt Leben. So war es. Der Krieg hatte ihr beinahe alles genommen.
Kathis Gedanken kehrten erneut zu Niklas zurück, und wie sich ihre Wege in Petersdorf gekreuzt hatten.
Vor einem Jahr hatte sie die Dinge selbst ins Rollen gebracht, als sie, entgegen dem Rat ihrer früheren Grundschullehrerin, Fräulein Liebig, die eigene Klugheit zu verbergen, etwas sehr Dummes tat. Als Anfang 1944 die Nazis in den Schulen eine landesweite Mathematikolympiade ins Leben gerufen hatten, konnte sie der Herausforderung nicht widerstehen. Sie gewann den Wettbewerb und lenkte damit das Auge Berlins auf sich.
Dieser Sieg beim Mathematikwettbewerb weckte gegen Kriegsende auch das Interesse der Sowjets. So trat Niklas in ihr Leben. Der junge deutsche Wissenschaftler, der sich als überzeugter Kommunist der Roten Armee angeschlossen hatte, erhielt den Auftrag, Kathis außerordentliche Begabung einzuschätzen und somit ihren Nutzen für die russische Forschung. Wenn Kathi mit Niklas in die Geheimnisse von Physik und Mathematik eintauchte und das reale Universum gegen das imaginäre in ihrem Kopf eintauschte, verloren die Schrecken des Krieges und ihre Situation als Kriegsgefangene kurz an Bedeutung. Niklas und sie verbrachten viele Stunden zusammen, spürten dem tiefsten Wesen der Wissenschaft von Raum und Zeit nach, trotzdem blieb ihr der junge Mann ein Rätsel.
Einerseits trat Niklas ihr gegenüber zugänglich auf und ließ keinen Zweifel daran, dass er sie mochte. Andererseits spürte sie in ihm eine innere Grenze, die nicht überschritten werden durfte. Niklas kam ihr vor wie der Himmel, dessen Sterne des Nachts verführerisch glänzten und ihr zum Greifen nahe schienen – und dennoch unerreichbar blieben. Aber tief in ihrem Herzen wusste sie, dass sie eines Tages Antworten auf ihre Fragen erhalten würde.
2
Alles Böse kommt vom Menschen.
Das Gute bestimmt der Mächtige.
Annemarie Sadler
Die kleine Tupolew hatte die zugewiesene Halteposition noch nicht völlig erreicht, als ein offener Jeep auf sie zuraste. Im buchstäblich letzten Moment bremste der Fahrer ab, riss das Lenkrad herum, und der Wagen schlitterte in eine Halbkurve. Eine Frau in Uniform sprang heraus. Kurz fiel die Sonne auf einen ihrer zahlreichen Brustorden. Die Auszeichnungen erinnerten Kathi an ihren kriegsversehrten Großvater. Auch ihm waren einst Orden verliehen worden, ein lächerliches Pfand für die zeitlebens ruinierte Gesundheit.
Doch diese Frau sah mehr als gesund aus; sie verströmte eine geradezu aggressive Vitalität, als müsste jedes Hindernis ihr ausweichen und nicht umgekehrt. Durch das winzige Bullauge beobachtete Kathi, wie die Offizierin mit energischem Schritt auf das Flugzeug zueilte, um gleich darauf aus ihrem Blickfeld zu entschwinden.
Niklas überließ die abschließenden Handgriffe seinem Co-Piloten, nahm die Kopfhörer ab und öffnete den Gurt. In gebückter Haltung kam er auf Kathi zu und half ihr und Franzi, die eigenen Gurte zu lösen. »Alles in Ordnung mit euch beiden?«
Kathi nickte. Sie war von einem unwirklichen Gefühl beseelt, kam sich leicht und schwebend vor, beinahe benommen. »Es war wie im Traum«, sagte sie und wunderte sich, wie körperlos sich ihre Stimme anhörte.
»Achtet auf euer Gleichgewicht, wenn ihr aussteigt. Ihr seid mehrere Stunden gründlich durchgerüttelt worden. Der Boden dürfte euch zunächst ziemlich wackelig vorkommen.«
Niklas öffnete die Luke und hängte die Ausstiegsleiter ein. »Wir machen es wie beim Einsteigen. Ich zuerst, dann folgt Franzi und dann du, Katja.« Kathi mochte es, wenn er sie Katja nannte. Er selbst hatte sich ihr als Niklas vorgestellt, aber alle anderen sagten Nikolaj zu ihm. Das wollte sie von nun an auch tun.
Wie von Nikolaj angekündigt, fühlten sich die ersten Schritte höchst unsicher an, als wäre der Boden unter ihren Füßen zum Leben erwacht. Kathi griff nach Franzis Hand. Der Eindruck verflüchtigte sich jedoch schnell, die Erde rückte wieder an ihren angestammten Platz.
Zwischenzeitlich hatte die Offizierin Nikolaj beiseitegezogen. Kathi hätte ihr Gespräch gerne belauscht, aber der Lärm der unablässig startenden und landenden Maschinen verhinderte das. Kurz streifte der Blick der Fremden Kathi, zeigte jedoch kein besonderes Interesse an ihr.
Für Kathi galt das genaue Gegenteil. Ungeniert unterzog sie die fremde Frau einer Musterung. Die vielen Abzeichen an der Uniform deuteten auf einen höheren Offiziersrang hin. Als Kathi sie auf das Flugzeug hatte zueilen sehen, erfasste sie ein vertrautes Gefühl, ähnlich jenem, wenn die Lösung eines Mathematikrätsels zum Greifen nahe schien, um sich ihr im letzten Moment doch noch zu entziehen. Kathi ahnte, dass diese Frau eine Rolle in ihrem Leben spielen würde. Wer war sie? Was hatte sie mit Nikolaj zu tun?
Die Russin hatte ihre Kappe abgenommen und unter den Arm geklemmt. Während Nikolaj angespannt wirkte, verharrte die Frau in lässiger Pose. Ein Bein leicht angewinkelt, den Kopf ihm zugeneigt, sprach sie weiter auf ihn ein.
Schönheit, wusste Kathi, wurzelte in der Geometrie. Dennoch blieb sie eine subjektive Angelegenheit. Für ihren Vater Laurenz war ihre Mutter Annemarie die schönste Frau der Welt. Bei dieser Unbekannten hatte die Geometrie Gesicht und Körper in perfekter Harmonie zusammengefügt: eine schlanke Gestalt, fein gemeißelte Züge, hell schimmernde Haut und volles rotes Haar, das in der frühen Abendsonne wie geschmolzenes Kupfer leuchtete.
Zwei weitere Wagen kamen in Sicht und rollten auf das Vorfeld. Eine Limousine mit verdunkelten Scheiben und Standarte, gefolgt von einem offenen Militärjeep, bemannt mit vier Rotarmisten.
Die Limousine stoppte unmittelbar neben Nikolaj und der Unbekannten. Die hintere Tür schwang auf. Anstatt auszusteigen, begnügte sich der Insasse damit, den Arm herauszustrecken und die beiden mit herrischer Geste heranzuwinken. Es entwickelte sich eine kurze Diskussion zu dritt.
Kathi bemerkte den Unwillen auf Nikolajs Gesicht. Neugierig tat sie einen Schritt auf den Wagen zu. Weiter kam sie nicht, eine Hand senkte sich bleischwer auf ihre Schulter. Von ihr unbemerkt waren zwei Rotarmisten aus dem Jeep gestiegen. Während der eine sie hinderte weiterzugehen, half der andere dem Co-Piloten mit dem Gepäck aus der Tupolew. Viel war es nicht. Neben den schweren Militärtaschen der beiden Piloten standen nur ihre eigenen Rucksäcke, ein kleiner Koffer und ihr Akkordeon einsam auf dem Rollfeld.
Niklas löste sich nun aus dem Gespräch und näherte sich Kathi. Sofort gab der Rotarmist Kathi frei und trat zurück.
»Es tut mir leid, Katja. Ich muss fort«, sagte Nikolaj. »Es hat sich eine Situation ergeben.«
»Was soll das heißen, du musst fort?« Er würde sie doch jetzt nicht alleine hier stehen lassen? Sie hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass sie sich bereits auf dem Flughafen trennen würden. Die Enttäuschung schlug über ihr wie eine Woge zusammen.
Nikolaj schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Geh mit Xenia, Katja. Sie wird euch euer Quartier zeigen.« Er wies mit dem Kopf in Richtung der russischen Offizierin, die noch mit dem Unbekannten in der Limousine sprach.
»Xenia?«, hauchte Kathi. Sie glaubte, den Namen vor einiger Zeit schon einmal in einem anderen Zusammenhang gehört zu haben. Während sie noch ihr Gedächtnis danach durchwühlte, schlangen sich zwei kleine Hände um ihren Bauch, und ein Kopf presste sich gegen ihre Hüfte. Franzi! Die Kleine spürte die Verwirrung ihrer älteren Schwester.
Nun gesellte sich die Rothaarige zu ihnen und übernahm selbst die Vorstellung: »Guten Tag, ich bin Xenia«, sagte sie auf Deutsch. Aus unmittelbarer Nähe betrachtet, wirkte ihre Schönheit geradezu einschüchternd. Ihr sicheres Auftreten verriet, wie sehr sie es gewohnt sein musste, dass man ihr überall einen Platz in der ersten Reihe freiräumte. Dennoch gab es einen Makel, auch wenn Xenia ihn durch ihre leise und akzentuierte Art zu sprechen geschickt zu kaschieren wusste: Sie lispelte, und der eigene Name hörte sich aus ihrem Mund wie Fenia an.
Von der Limousine ertönte ein anhaltendes Hupen. Das Signal behauptete sich selbst gegen den infernalischen Fluglärm.
»Ich muss los, Katja. Xenia wird sich um euch kümmern.« Nikolaj strich Franzi, die sich weiter an ihre Schwester klammerte, kurz über den dunklen Schopf. Anschließend schulterte er seine Militärtasche. Kathi kämpfte vergeblich gegen das enge Gefühl in ihrer Kehle an, während sie zusah, wie sich Nikolaj von ihr entfernte.
»Wann kommst du wieder?«, schrie Kathi gegen ein startendes Flugzeug an. Hätte Franzi nicht an ihr gehangen wie ein verängstigtes Äffchen, sie wäre ihm womöglich nachgelaufen. Dabei wollte sie sich nicht benehmen wie ein Kind, nicht vor diesem perfekten Wunderwesen Xenia. Doch ihr flehendes Herz betete darum, dass sich Nikolaj nochmals zu ihr umwenden und ihr das Lächeln schenken würde, das nur ihnen beiden gehörte. Ein Lächeln, gewebt aus Mondlicht.
Nikolaj drehte sich tatsächlich um, legte die Hände wie einen Trichter vor den Mund und rief: »Bald. Ich melde mich!« Das erhoffte Lächeln blieb er ihr dabei schuldig.
Für einen kurzen Augenblick verwandelte sich Kathis Welt in Glas, wurde durchsichtig und zerbrechlich, drohte zu zersplittern.
Xenia musste ihre Anweisung wiederholen: »Nehmt euer Gepäck und kommt mit!« Erst jetzt reagierte Kathi auf die Russin.
Sie folgten ihr und kletterten vorne in den Jeep.
»Wohin fahren wir?«, erkundigte sich Kathi.
»In ein Krankenhaus.«
»Was sollen wir in einem Krankenhaus?«
»Ihr werdet dort ärztlich untersucht.«
»Was denn für Untersuchungen?« In Kathi schrillten Alarmglocken. Zwar beschränkten sich ihre eigenen Erfahrungen mit Ärzten auf ein Minimum, jedoch waren ihr die vielen Fehlschläge bei der Behandlung ihrer Schwester überaus präsent. Später hatten ihre Eltern nur knapp verhindern können, dass Naziärzte ihre Schwester euthanasierten.
»Fragst du immer so viel?«, wollte Xenia wissen.
»Wundert dich das?«, duzte Kathi sie zurück. In ihrer Erregung vergaß sie, dass ihr Instinkt sie erst vor wenigen Minuten gewarnt hatte, Vorsicht walten zu lassen. »Meine Schwester und ich sind Fremde in einem fremden Land. Warum sollte ich nicht wissen wollen, was weiter mit uns geschieht?«, schob sie als Erklärung nach.
Ein feines Lächeln umspielte Xenias Lippen. »Nikolaj hat mir bereits angedeutet, dass du dich nicht so leicht einschüchtern lässt. Ich gebe dir einen Rat: Fremde können sich keinen Stolz leisten.«
»Ich bedanke mich für den Rat, aber ich sehe keinen Sinn darin. Mein Interesse an unserem weiteren Schicksal hat keineswegs mit Stolz zu tun.«
»Nikolaj verriet mir auch, dass du gerne diskutierst.«
»Nur wenn die Diskussion zielführend ist«, konterte Kathi. Was sollte das? Was wollte Xenia? Warum erwähnte sie ständig Nikolaj?»Verrätst du mir, warum wir untersucht werden sollen? Bitte«, fügte sie hinzu.
»Wir müssen uns vergewissern, dass ihr uns nicht irgendwelche Krankheiten ins Land schleppt.«
»Ist das nicht ein wenig spät? Wir sind schon hier. Womöglich habe ich dich längst angesteckt?«
Für den Bruchteil einer Sekunde wirkte Xenia irritiert. Erst darauf lachte sie glockenhell auf. »Du bist sehr direkt. Ich weiß zwar nicht, ob mir das gefällt, aber amüsant ist es allemal.« Sie startete den Motor.
Franzi, die sich bislang ruhig verhalten hatte und sich eng an Kathis Seite gepresst hielt, rührte sich und stellte ihrer Schwester summend eine Frage. Kathi summte erklärend zurück, dass es jetzt wichtig sei, sich unauffällig und zurückhaltend zu verhalten, um Xenia bei Laune zu halten. Dann würde alles gut werden.
Franzi reagierte mit einem Unmutslaut. Sie summte erneut, höchst ungehalten und wenig melodiös.
»Was summt ihr da?«, wollte Xenia wissen und warf ihnen einen schnellen Blick zu. »Lasst das sein. Es klingt scheußlich.«
»Wir verständigen uns auf diese Art.«
»Wie bitte? Kann deine Schwester etwa nicht sprechen?«
»Sie hat es nie gelernt.«
»Und was fehlt ihr?«
»Das haben die Ärzte niemals richtig herausgefunden.«
»Pah, deutsche Ärzte!«, rief Xenia abschätzig. »Russische Ärzte werden es herausfinden!«
Die übrige Fahrt verlief schweigend. Kathi blieb stumm, und Franzi schmollte, da sie es nicht leiden mochte, wenn man in ihrer Gegenwart über ihren Defekt sprach. Xenia beachtete sie ohnehin nicht weiter.
Mittlerweile hatten sie den Militärflughafen hinter sich gelassen und fuhren in östlicher Richtung.
Es herrschte reger Verkehr. Neben Ochsen- und Pferdefuhrwerken bestimmten vor allem Militärfahrzeuge das Straßenbild. Auf beiden Seiten quälten sich ganze Kolonnen Lastwagen durch die karge, gerodete Landschaft. Pannen, ein Unfall und Unmengen am Straßenrand zurückgelassener Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Stadien des Zerfalls erschwerten zusätzlich den Verkehrsfluss. Xenia scherte sich jedoch weder um Hindernisse noch um Verkehrsregeln. Sie hupte und überholte riskant, ging kaum je vom Gaspedal, als gälte es, sämtliche Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Die drei Jeep-Insassen wurden tüchtig durchgerüttelt, und der offene Wagen sorgte dafür, dass sie eine Menge Staub schluckten. Mit einer Hand hielt Kathi Franzi fest, mit der anderen krallte sie sich an den harten Schalensitz, um zu verhindern, beim nächsten halsbrecherischen Manöver aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden.
An einer Weggabelung bog Xenia in beinahe voller Fahrt nach links ab. Kathi schloss in Panik die Augen, betete, dass die Fliehkraft sie nicht in den Graben befördern möge.
Kurz darauf kam das Ende einer Lkw-Kolonne in Sicht. Mit ungeminderter Geschwindigkeit raste Xenia darauf zu. Die schweren Fahrzeuge zu überholen stand außer Frage, zumal die Gegenseite gleichfalls durch Lkws blockiert wurde. Für Xenia noch lange kein Grund, ihr Tempo zu drosseln.
Warum bremste sie nicht endlich? Kathi schrie entsetzt auf, umfasste ihre Schwester noch fester und drückte deren Kopf schützend auf ihren Schoß. Gleichzeitig ließ sie den Sitz los, um sich mit der anderen Hand gegen das Armaturenbrett zu stemmen. In letzter Sekunde riss Xenia das Steuer herum und raste rechts an der stehenden Kolonne vorbei. Das Fahrzeug flog förmlich über die kurze Böschung hinweg, landete in einer Wiese und setzte die Fahrt mit aufjaulendem Motor fort.
Xenia warf den Kopf zurück und lachte, während ihr Haar wie eine rote Fahne hinter ihr herwehte.
Sie genoss es! Die Frau war verrückt! Kathi war fassungslos. Der Jeep rumpelte über die Wiese, von den Lastwagen erklang ein Hupkonzert. Übermütig winkte Xenia den Fahrern zu.
Als sie die Spitze des Staus passierten, sahen sie einen umgekippten Militärjeep auf der Straße liegen. Daneben, unter einer Decke verborgen, konnte man den Umriss eines Körpers erkennen.
Kathi bekreuzigte sich.
»Lass den Unsinn!«, zischte ihr Xenia darauf zu und trat das Gaspedal noch einmal tüchtig durch. Der Wagen schoss die niedrige Böschung hinauf und zurück auf die Straße, die nun frei vor ihnen lag.
Schließlich verließen sie die geteerte Straße und bogen in einen unbefestigten Weg. Ein Schlagbaum kam in Sicht. Zwei Uniformierte mit Maschinengewehren traten ihnen entgegen. Auch dies veranlasste Xenia nicht, ihr Tempo zu verlangsamen. Stattdessen legte sie eine Vollbremsung hin, die den Kontrollposten in eine dichte Staubwolke hüllte. Mit ausdrucksloser Miene salutierten die Rotarmisten. Xenia reichte ihnen den Passierschein, der Schlagbaum hob sich.
Hinter einer lang gezogenen Kurve tat sich vor ihnen eine schnurgerade Allee auf, von hohen Kastanien gesäumt, deren dichtes Blätterwerk sich über den Weg hinweg berührte wie Paare, die die Nähe des anderen suchten. Das üppige Grün ließ kaum Sonne durch, nur hier und da malte das Licht geheimnisvolle Zeichen in den Schatten. Zu beiden Seiten erstreckte sich schier endlos ein Park. Trotz seines verwahrlosten Zustands ahnte man die einstige Pracht und Kunstfertigkeit der Anlage.
Die Allee mündete in ein Rondell vor einem palastartigen rosafarbenen Gebäude. Zahllose Türmchen und Stuckverzierungen ließen es völlig überladen wirken. Ein Bau aus einer anderen, üppig-sorglosen Epoche. Und längst von der neuen Zeit in Besitz genommen. Auf seinem Dach wehte die scharlachrote Fahne der Revolution.
In der Mitte des Vorplatzes schraubte sich ein Marmorbrunnen dem Himmel entgegen, die trockenen Becken überwuchert von grünlichen Flechten. Kathi empfand Traurigkeit angesichts des wasserlosen Brunnens. Kaum minder berührte sie der Anblick der zerbrochenen Marmorfiguren, die überall verstreut im Gras lagen. Als hätte sie der Stiefel eines Riesen von ihren Sockeln getreten.
Xenia parkte den Jeep nahe am Gebäude. Aus der Nähe trat zutage, dass überall Stuck und Farbe abblätterten. Dabei war es weniger die Zeit, die der Fassade klaffende Wunden geschlagen hatte, sondern zahlreiche Einschusslöcher, stumme Zeugen eines vergangenen Dramas.
Vor dem ehemaligen Palast parkten bereits Dutzende anderer Fahrzeuge. Xenia hatte sich in eine schmale Lücke zwischen zwei Lastwagen gequetscht. Es wimmelte von Uniformierten. Soldaten, die mit unbekanntem Ziel umhereilten, Soldaten, die exerzierten, Soldaten, die Fracht aus Lkws entluden.
Xenia hüpfte aus dem Wagen wie ein munteres Reh. »Kommt mit, ihr beiden«, befahl sie knapp.
Kathi blieb es völlig schleierhaft, wie scheinbar unbeeinträchtigt sich Xenia nach dieser Höllenfahrt bewegte. Ihr schmerzte jeder Knochen im Leib. Gerne hätte sie Xenia gefragt, ob sie vorhabe, sie alle umzubringen. Angesichts ihrer Situation begnügte sie sich damit, einmal tief Luft zu holen. Vorsichtig hob sie Franzi aus dem Wagen und fragte leise summend: Wiegeht es dir, meine kleine Eidechse?
Ich will nicht mit der hässlichen Frau gehen, summte Franzi.
Es dauert nicht lange, mein Schatz. Wir besuchen nur kurz einen Doktor.
Ich will keinen Doktor! In Franzis Augen entzündete sich Panik, spiegelte sich eine ganze Welt erlittenen Leids. Das Wort Doktor bedeutete für Franzi fremde, grobe Hände, die ihren Körper abtasteten und sie zwangen, den Mund zu öffnen. Hände, die sie mit Nadeln und Skalpellen traktierten und Hautproben nahmen. Doktor, das bedeutete für Franzi Schmerz.
Kathi schalt sich eine Idiotin, weil sie den Arzt erwähnt hatte. Dadurch hatte sie Franzi noch mehr erschreckt. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun, meine Kl…
»Hört endlich mit dem weibischen Gesumme auf!« Xenia schob sich zwischen sie und packte Franzis Hand. »Kommt ihr jetzt freiwillig mit, oder muss ich nachhelfen?«
Franzi versuchte vergeblich, sich Xenias eisernem Griff zu entwinden. Kathi fasste schnell Franzis andere Hand. Franzi weinte, aber sie wehrte sich nicht weiter.
Sie betraten das Gebäude durch ein Nebenportal. Der Weg zog sich über zahllose Flure, er schien irgendwie kein Ende nehmen zu wollen. Auch im Haus herrschte viel Betrieb; einige Soldaten bewachten einzelne Räume, andere eilten geschäftig umher. Je weiter sie vordrangen, umso stiller wurde es, und umso weniger Personen begegneten ihnen.
Kathi fiel auf, wie ehrfurchtsvoll Xenia von jedermann gegrüßt wurde. Als brächte man ihr über ihren militärischen Rang hinaus einen besonderen Respekt entgegen.
Xenia führte sie zu einem Fahrstuhl. Davor standen zwei weitere Kontrollposten mit Maschinengewehren. Xenia zeigte ihren Passierschein vor. Darauf öffnete ein Rotarmist die Aufzugtür und trat gemeinsam mit ihnen in die Kabine.
Zu Kathis Verwunderung ging die Fahrt nicht nach oben, sondern führte hinab. Ein Krankenhaus unter der Erde?
Mit einem Ruck stoppte die Kabine. Von außen zog jemand die Türen auf, und sofort umfing sie der vertraute Spitalgeruch. Wochenlang hatte ihn Kathi beinahe täglich geatmet, als ihre Mutter im Gleiwitzer Frauenkrankenhaus um ihr Leben gerungen hatte. Auch Franzi erkannte den Geruch wieder. Erschrocken wich sie zurück, presste sich in die Ecke und weigerte sich, den Fahrstuhl zu verlassen.
Xenia zog die Kleine unerbittlich mit sich nach draußen. Da tat Franzi etwas Unvorstellbares: Sie grub ihre Zähne tief in Xenias Handrücken.
Die Russin schrie auf wie ein verwundetes Tier, ein hoher keuchender Laut, mehr Überraschung als Schmerz, und Franzi erreichte ihr Ziel: Xenia ließ ihre Hand los.
Eine Sekunde lang schien die Welt den Atem anzuhalten. Kurz sah es aus, als wollte Xenia Franzi schlagen. Mit einer raschen Bewegung schob sich Kathi zwischen sie und ihre Schwester.
Darauf kräuselte Xenia verächtlich ihre Lippen, als hätte sie dergleichen von den Geschwistern erwartet. Die Russin zog ein Taschentuch aus ihrer Tasche und wickelte es um ihren Handrücken, auf dem sich Franzis Zähne als blutender Halbmond abzeichneten. Den Rotarmisten, der seiner Offizierin hatte beispringen wollen, scheuchte sie mit einem einzigen Blick zurück.
Franzi summte: Jetzt muss die hässliche Frau auch zum Doktor.
Xenia befestigte ihren provisorischen Verband. »Was spricht das kleine, tollwütige Biest?«, fauchte sie.
»Sie sagt, es tut ihr leid. Sie schäme sich.«
»Ach ja? Du lügst schlecht, Katja. Sei froh, dass deine Schwester kaum größer ist als eine Kanalratte!« Xenia rief dem Rotarmisten einen Befehl auf Russisch zu, und der schnappte sich daraufhin Franzi und hielt sie fest. Bevor Kathi gegen diese Behandlung ihrer Schwester einschreiten konnte, wurde sie von Xenia gepackt und ihr Arm nach hinten gerissen. Ein glühender Schmerz bohrte sich in ihren Rücken und zwang sie hilflos zu Boden. Schon einmal war sie auf diese Weise niedergerungen worden – von Sonia Petrowa, der russischen Politkommissarin, der sie ihre Gefangenschaft zu verdanken hatte.
Xenia verstärkte ihren Griff und entlockte Kathi damit einen erstickten Laut.
Mit einer Stimme, die klang, als würde ein Degen über Stein schaben, wandte sich Xenia Franzi zu: »Hör zu, Miststück. Ich weiß, dass du mich verstehst. Wenn du dich nicht benimmst und das tust, was ich dir sage, dann werde ich nicht dir wehtun, sondern deiner großen Schwester. Ist das klar? Dann nicke einmal, du Kretin.«
Langsam senkte Franzi den Kopf. Aber Kathi bemerkte den Ausdruck, der zuvor über Franzis Gesicht gehuscht war. Es lag keine Furcht darin, sondern Trotz.
Nie zuvor hatte Franzi einen Menschen wissentlich verletzt. Es passte nicht zu diesem süßen, sanften Kind, das das allerwinzigste Lebewesen wie eine Kostbarkeit behandelte und selbst Dorotas klebrige Fliegenfallen in der Küche sabotierte, indem sie sie stibitzte. Die Angst musste Franzi völlig überwältigt haben.
Sobald sie mit ihrer Schwester allein wäre, würde sie sich ernsthaft mit ihr unterhalten müssen. Xenia war keine Person, die man ungestraft demütigte.
Aufgewühlt strich Kathi über Franzis dunklen Schopf. Nachdem der Rotarmist sie endlich freigegeben hatte, flüchtete sich Franzi sofort in die schützenden Arme ihrer Schwester. Kathi fragte sich, wie sie Xenia und die untersuchenden Ärzte davon überzeugen konnte, dass es sich bei Franzi um eine friedliche Neunjährige handle, der Biss lediglich Folge und Ausdruck eines völlig verängstigten, elternlosen Kindes gewesen sei, das man aus der vertrauten Umgebung gerissen hatte.
Der Soldat schubste sie unerbittlich weiter und stieß sie in einen Behandlungsraum.
Xenia entfernte sich ohne ein Wort, während der Rotarmist zu ihrer Bewachung zurückblieb. Bevor er die Tür schloss und davor Posten bezog, bemerkte Kathi die Schweißperlen auf seinem jungen, geröteten Gesicht. Weshalb schwitzte er so stark, obwohl im Untergeschoss angenehme Kühle herrschte?
Franzis Hand verkrampfte sich in ihrer, und die Nägel bohrten sich schmerzhaft in Kathis Haut. Sie hörte, wie Franzis Atem zunehmend hektisch wurde, während sie auf die monströse technische Apparatur stierte, die den halben Raum einnahm. Ein Röntgengerät! Kathi entzifferte den Hersteller: Siemens & Halske. Bei Franzi weckte der Anblick des Geräts schlimme Erinnerungen. Aufgrund ihrer seltenen Hautkrankheit war sie bereits mehrmals von Ärzten auf einen Röntgentisch gezwungen worden.
Der jämmerliche Laut, der nun ihrer Kehle entstieg, fuhr Kathi in alle Glieder. Sie wollte Franzi erneut schützend an sich ziehen, doch ihre Schwester riss sich jäh von ihr los. Wie eine wild gewordene Furie begann sie gegen das Tischgestell zu treten. Gleichzeitig stimmte sie ein wildes Geheul an.
Der Rotarmist riss die Tür auf. Ihm drängte ein Mann mit Kittel und Mundschutz hinterher. Kathi gelang es schließlich, ihre Schwester mit beiden Armen zu umfangen und von dem Gestell wegzuziehen. Franzi gebärdete sich weiter wie von Sinnen, stieß hohe, wimmernde Laute aus und trat um sich. Kathi begann leise in ihr Ohr zu summen. Ich bin ja da. Es ist gut, meine kleine Eidechse. Alles wird gut. Alles wird gut.
Nichts war gut. Ein scharfer Befehl ertönte an der Tür. Xenia! Eine scheußliche Dissonanz zu Kathis sanftem Summen.
Der Soldat entriss Kathi Franzi, klemmte sie sich wie ein Paket unter den Arm und trug die Strampelnde hinaus.
»Nein!«, schrie Kathi. »Lasst sie hier. Ich kann sie beruhigen!« Sie wollte losrennen, dem Soldaten hinterher. Aber Xenia hielt sie zurück. Kathi kugelte sich durch den Schwung beinahe den Arm aus.
»Hiergeblieben!«, bellte die Russin.
»Was macht ihr mit Franzi? Wo bringt ihr sie hin? Franzi!«, brüllte Kathi. Ihr Herz hämmerte wie von Sinnen.
Statt einer Antwort gab Xenia sie unvermittelt frei und schubste sie in Richtung des Arztes. »Sie gehört Ihnen, Genosse. Sie wissen, was zu tun ist.« Sie verließ den Raum.
»Zieh dich aus«, sagte der Arzt barsch. »Alles.«
3
»Früher sind sie noch mit Säbeln aufeinander losgegangen. Jetzt werfen sie Gas und Bomben! Das kann der Herr sicher nicht gewollt haben, als er den Menschen Verstand eingehaucht hat.«
Dorota Rajewski
Am Kreml, entlang der Moskwa
»Dein Ausflug mit den deutschen Mädchen war nicht genehmigt, Genosse Oberleutnant«, blaffte der Mann in Generalsuniform, kaum dass Nikolaj neben ihm in der Limousine Platz genommen hatte.
»Genossin Oberst Petrowa wies mich an, das Vertrauen der Älteren zu gewinnen …«
Der General winkte ab. Stimmungsschwankungen dieser Art waren beispielhaft für ihn und Nikolaj hinreichend mit ihnen vertraut.
»Was ist geschehen? Warum werde ich abgeholt?«, lenkte Nikolaj das Gespräch auf die Frage, die ihm auf der Zunge brannte. Wegen einer Lappalie würde sich General Pchela, der Chef der militärischen Spionage GRU, sicher nicht persönlich zum Flughafen begeben.
»Die Amerikaner haben eine Atombombe über Japan abgeworfen. Genosse Stalin ist in höchster Weise erzürnt. Er fragt, warum hat die Sowjetunion keine Atombombe?«
Also doch! Sie hatten es wirklich getan!, schoss es Nikolaj durch den Kopf. Nun rächte es sich, dass sich Josef Stalin seit Jahren den Berichten des Geheimdiensts GRU ebenso verweigert hatte wie den Wortmeldungen der russischen Atomwissenschaftler. Selbst der führende sowjetische Kernforscher Igor Kurtschatow konnte sich bei ihm kaum Gehör verschaffen. Dabei war spätestens seit 1943, als Klaus Fuchs, ihr Spion in Übersee, sie erstmals über das amerikanische Manhattan-Projekt in Kenntnis gesetzt hatte, mit der Bombe zu rechnen.
Aber der große Führer der Sowjetunion zeigte wenig Interesse an der Nukleartechnik. Was auch daran lag, dass er Wissenschaftlern grundsätzlich misstraute. Jetzt, da die Amerikaner über die Bombe verfügten, tobte er. Und dies bedeutete, dass es wieder zu willkürlichen Verhaftungen kommen würde, zu Folter und Erschießungen. Ob schuldig oder unschuldig, jemand musste für den Triumph der Amerikaner bestraft werden. Vermutlich arbeitete Genosse Berija, Stalins Henker und gefürchteter Leiter des Geheimdienstes NKWD, in ebendiesem Moment an einer Liste mit Namen, um den Zorn seines Herrn zu besänftigen.
Wie Stalin ging Lawrenti Berija jegliche Vorstellung von den Möglichkeiten der Kernspaltung ab, deshalb befeuerte er dessen Argwohn. Beide Männer folgten hier einer simplen Gleichung: Wissenschaft bedeutete Intelligenz, und Intelligenz bedeutete, die Dinge infrage zu stellen. Berijas und Stalins Paranoia ging so weit, dass ein nicht unerheblicher Teil der brillantesten sowjetischen Denker sein Dasein in sibirischen Lagern fristete. Am Ende verdankten es diese Männer und Frauen allein dem Krieg, dass sie nicht ihre gesamte ungerechte Strafe absitzen mussten, sondern vorzeitig, unter strengen Auflagen, in den Dienst Mütterchen Russlands zurückkehren durften. Viele Wissenschaftler überlebten die unmenschlichen Lagerbedingungen nicht, andere kehrten krank und schwer gezeichnet zurück.
Nikolaj scheute sich nicht, seinen Grimm offen zu zeigen. »Wir wären ein ganzes Stück weiter, wenn Berija unsere klügsten Köpfe nicht in Lager gesperrt hätte! Leute wie Tupolew oder Sergejew!«
»Der Genosse Berija macht nur seine Arbeit.« Der Satz klang einstudiert.
»Seit wann gilt willkürliches Morden als Arbeit? Berija geht es weder um Wahrheit noch um Fakten, er rechnet mit Wahrscheinlichkeiten. Sein Universum ist derart beschränkt, dass er in jedem intelligenten Menschen einen Konterrevolutionär sieht.«
»Ja, ja, es lebt sich gefährlich in diesen Zeiten, und niemand kann sich sicher fühlen.« Der General tat das Gesagte mit einer verächtlichen Geste ab. »Was willst du? Soll sich unser Generalissimus etwa mit jedem Detail beschäftigen? Hat er nicht eben erst den Großen Vaterländischen Krieg gewonnen? Genosse Stalin hat die Bombe nun zur Aufgabe Nummer eins erklärt, und er fordert sofortige Ergebnisse. Er hat Genosse Berija diese Aufgabe übertragen.«
»Berija wird das Projekt leiten? Das wird ja immer besser.« Nikolaj knirschte hörbar mit den Zähnen.
»Hüte deine Zunge, Genosse Oberleutnant! Außer dich gelüstet es nach Sibirien.«
Die Drohung veranlasste Nikolaj zu einem weiteren Unmutslaut. Der Abwurf der amerikanischen Bombe würde tief greifende Auswirkungen auf Russland haben. Schon seit Wochen beförderte die transsibirische Eisenbahn russische Soldaten in Richtung Osten, um die japanischen Truppen in der Mandschurei und China anzugreifen. »Das bedeutet, die Sowjetunion wird nun endgültig in den Krieg mit Japan eintreten«, sagte er düster.
»Genosse Stalin bleibt keine Wahl, wenn unser Land noch etwas von der japanischen Kriegsbeute abbekommen will. Unsere Vereinbarung mit den Amerikanern ist unmissverständlich: Spätestens neunzig Tage nach der deutschen Kapitulation müssen wir den Gelbnasen den Krieg erklärt haben.« Der General setzte zu weiteren politischen Erläuterungen an, sein liebstes und einziges Steckenpferd.
Nikolaj hörte ihm nicht zu. Als Forscher galt sein Interesse der Atombombe. Der Abwurf hatte eine seltsame Erregung in ihm ausgelöst, eine Mischung aus Schrecken und Faszination. Als der General sich zwischen zwei Sätzen einen Schluck aus der allzeit griffbereiten Wodkaflasche gönnte, nutzte er die Pause für eine Frage: »Liegen uns weitere Informationen über die Wirkkraft der Bombe vor?«
»Bisher wurde nur das bekannt, was Truman Stunden nach dem Abwurf in seiner Radioansprache vortrug. Du kannst dir die Aufzeichnung später anhören. Angeblich verfügte die Bombe über eine Sprengkraft von zwanzigtausend Tonnen TNT.«
»Das ist mindestens das Zweitausendfache der bisher größten bekannten Bombe!« Ein Schauer durchlief Nikolaj. »Wo hat man sie gezündet?«
»Die Stadt heißt Hiroshima.«
»Wurden Opferzahlen genannt?«
Der General zuckte die knochigen Schultern. »Ersten Schätzungen nach angeblich zehntausend. Ach ja, es gibt Hinweise auf eine zweite Bombe.«
»Die Amerikaner haben noch eine abgeworfen?« Nikolaj spürte eine Schwäche in den Gliedern. Jäh entstanden vor seinem inneren Auge Bilder glutheißer Feuerstürme. Plötzlich schien die Luft zu heiß zum Atmen.
»Noch nicht. Aber ich bin sicher, sie werden sie zünden.«
Nikolaj schüttelte unwillig den Kopf. »Das gefällt mir nicht.«
»Ach so? Was passt dem jungen Genossen denn nicht?«
»Japan steht ohnehin mit dem Rücken zur Wand. Seit Wochen sieht es sowjetische Truppen an seinen Grenzen aufmarschieren. Es weiß, es kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Spätestens, wenn Russland dem Kaiserreich den Krieg erklärt, wird Japans Kapitulation unvermeidlich. Die Amerikaner wissen das. Und trotzdem werfen sie jetzt noch ihre Bombe ab.«
Ein scharfer Blick durchbohrte Nikolaj. »Skrupel? Leg sie ab, Genosse Oberleutnant. Sonst wirst du nicht weiter für mich arbeiten.«
»Ich dachte, ich arbeite für Mütterchen Russland?«
Der General stieß ein kurzes, meckerndes Lachen aus. »Hör zu. Diese bornierten Japaner hatten mehr als einmal die Gelegenheit zur Kapitulation. Sie lehnten ab. Statt an die zehntausend toten Japsen solltest du an unsere tapferen vierzig Divisionen an der Grenze denken, die jetzt nicht mehr in den Krieg ziehen, sondern zu ihren Familien heimkehren dürfen. Die Japsen haben ihre Lage selbst verschuldet. Die Amerikaner haben seit Pearl Harbor ein Recht auf ihre Rache.«
»Möglich. Meiner Meinung nach haben die Amerikaner die Bombe aus einem einzigen Grund abgeworfen: Sie wollten der Kapitulation Japans zuvorkommen.«
»Niemand fragt nach deiner Meinung«, wies ihn der General geradezu milde zurecht, um sich Nikolajs Aussage anschließend selbst anzueignen. »Fraglos bestätigt diese Vorgehensweise die Raffgier der amerikanischen Imperialisten. Sie gönnen unserer glorreichen Sowjetunion keinen Anteil an der japanischen Kriegsbeute und werfen die Bombe, um Japans Kapitulation vor unserem Kriegseintritt zu erzwingen. Gleichzeitig testen die Amerikaner damit die Wirkkraft ihrer neuen Waffe. Das geht nur im Krieg. Eine Tat, zwei Fliegen!«, erläuterte der General ungerührt.
Nikolaj sah aus dem Fenster. 1939, kurz vor Kriegsbeginn, hatte er das Phänomen des spontanen radioaktiven Zerfalls entdeckt und erstmals die Möglichkeiten der Kernspaltung erkannt. Damals las er einen geheimen Bericht, in dem es um eine Entdeckung der Physiker Otto Hahn und Fritz Straßmann aus dem Vorjahr ging. Seit 1938 publizierte kein deutscher Physiker mehr in den einschlägigen Wissenschaftsmedien. Allgemein wurde es als alarmierendes Signal gewertet, dass die Deutschen sich mit Kernphysik befassten. Unter anderem schilderte der Geheimbericht, die beiden deutschen Wissenschaftler hätten Uran 38 mit Neutronen bestrahlt und durch die Spaltung Unmengen an Energie freigesetzt. Der Bericht durchfuhr Nikolaj damals wie ein Stromstoß; etwas in ihm entzündete sich, ließ ihn nicht mehr los. Von nun an stürzte er sich auf jede Publikation, die sich je mit Kernspaltung beschäftigt hatte, sichtete die Veröffentlichungen von Albert Einstein, Enrico Fermi, Lise Meitner bis hin zu Leo Szilárd, und fand seine eigenen Ansätze bestätigt. Atomkraft barg eine Vielzahl an Möglichkeiten. Warum sie nicht zum Wohle der gesamten Menschheit nutzbar machen? Atomkraft, das war reinste Energie! Eine Energie, die eines Tages vielleicht auch Reisen in den Kosmos ermöglichen würde …
Aber er hatte niemals eine zerstörerische Bombe bauen wollen. Die Amerikaner, in Kollaboration mit den Briten und Kanadiern, schienen da von weniger Skrupeln geplagt. Sie hatten eine Atombombe gebaut. Eine monströse Waffe von unvorstellbarer Zerstörungskraft.
Er hatte den Drachen nur gekitzelt, die Amerikaner hingegen hatten sein tödliches Feuer entfacht. Erneut schauderte es Nikolaj. Er ahnte, dass die Welt nie wieder dieselbe sein würde …
Der General an seiner Seite strahlte in etwa die Menschlichkeit eines Felsens aus, als er konstatierte: »Das ist der Krieg. Es geht darum, den Gegner entscheidend zu schwächen. Bau die Bombe! Das ist dein Auftrag. Ich wiederhole: Genosse Stalin erwartet schnelle Ergebnisse, und ich habe ihm diese versprochen. Ansonsten kann das unser Ende sein. Also streng dich an!«
Nikolaj verscheuchte die trüben Gedanken und beschloss, sich in das Spiel einzubringen. Vorerst und nach seinen Regeln. »Gerne. Wenn du mir verrätst, wie ich das mit dem kümmerlichen Material, das mir zur Verfügung steht, bewerkstelligen soll? Ich kann die Bombe nicht aus Schlamm formen. Uns stehen weder ausreichend qualifizierte Wissenschaftler noch die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Seit Jahren müssen wir um jede Schraube betteln. Was wir vor allen Dingen benötigen, ist mehr Uran. Ohne Uran kein Reaktor.«
Der General strich sich über das großflächige dunkle Mal auf seiner Wange. »Mit dem Betteln ist es vorbei. Der gewonnene Krieg setzt die nötigen Ressourcen frei. Genosse Stalin hat jede Hilfe zugesagt. Zweihundertfünfzig Kilogramm Uranmetalle, zwei Tonnen Uranoxid und zwanzig Liter schweres Wasser sind bereits nach Moskau unterwegs. Wir haben es den Amerikanern im Keller des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts direkt unter dem Hintern weggeschnappt.«
»Woher stammt das Uran? Das aus Johannistal ist weitgehend nutzlos.«
»Es kommt aus Belgisch-Kongo. Dort haben es die Deutschen gestohlen. Nun gehört es uns.«
Nikolaj lehnte sich zurück. Formeln fügten sich vor seinem inneren Auge zusammen. Von fiebriger Spannung erfüllt, sah er sich bereits in seinem Forschungsbüro in der Akademie der Wissenschaften vor einer Wandtafel mit der Kreide hantieren und Berechnungen anstellen.
Die roten Kremlmauern kamen nun in Sicht. Moskaus frühe Verteidiger hatten die gesamte Mauer mit an die zwanzig Türmen bestückt und damit ein mächtiges Bollwerk gegen seine Feinde geschaffen. Auch der Umriss des Kreml zeichnete sich nun ab, der Prachtbau schien wie ein Himmelsschiff über Moskau zu wachen. Hitler hatte alles auf eine Karte gesetzt, um den Kreml in die Hand zu bekommen. Doch der Kreml trotzte seiner Eroberung.
Seit Jahrhunderten hatte über dem Kreml die weiße Fahne der Romanows geweht. Nun sah Nikolaj dort Hammer und Sichel flattern. Serp i Molot. Wahrzeichen und Symbol der Arbeiter. Auch wenn sie nicht die wahren Herrscher Moskaus waren …
Unvermittelt geriet eine Frau in Nikolajs Blickfeld. Sie verharrte in völliger Versunkenheit an einem der Zugänge zum Roten Platz. Kleidung und Kopftuch verrieten ihre Zugehörigkeit zum einfachen Volk. Was ihn irritierte, war ihre absolut aufrechte Haltung. Der kerzengerade Rücken verriet Stolz. Nun wandte sie sich um – und augenblicklich fiel ihre Körperspannung in sich zusammen.
Verblüfft registrierte Nikolaj die Verwandlung. Beim Vorbeifahren erhaschte er einen flüchtigen Blick auf ihr Gesicht. Es rief eine vage Erinnerung in ihm hervor. In dem Moment traf ihn ein schmerzhafter Ellbogenstoß in die Seite.
»Träumst du, Genosse Oberleutnant? Hör mir gefälligst zu«, zürnte der General. Die folgende Information verdrängte die Frau vor dem Kreml aus Nikolajs Gedanken, und er legte sie als merkwürdige Episode in einem entfernten Winkel seines Gehirns ab. »Genosse Kurtschatow und Genosse Sergejew haben dich jeweils für ihre Forschungsgruppe angefordert.«
Ein Leuchten zog über Nikolajs Gesicht. Kurtschatow baute als Chefphysiker die Bombe, aber Sergejew war der Chefkonstrukteur für die Rakete und den Antrieb, die sie befördern sollte. Der Technik, die es eines Tages auch erlauben würde, zum Mond zu fliegen. Sein Lebenstraum. »Ich will zu Sergejew!«, äußerte er spontan.
»Das hast nicht du zu entscheiden. Das ist Genosse Berijas Aufgabe.«
Die Enttäuschung durchfuhr Nikolaj wie ein heißer Stich. Den General und Lawrenti Berija verband eine innige Feindschaft. Irgendein lang zurückliegender Vorfall, in dessen Zentrum Genosse Stalin stand. Der Generalissimus fand diebisches Vergnügen daran, die beiden Rivalen fortwährend gegeneinander auszuspielen – wie ein Schiedsrichter, der die Regeln nach Lust und Laune festlegte.
Da er, Nikolaj, als Sergejews Protegé galt und General Pchela den Chefkonstrukteur seit Längerem förderte, brauchte es nicht viel Fantasie, um sich Berijas Entscheidung auszurechnen. Er würde bei Kurtschatow landen. Vielen Dank auch!
Aber der General überraschte ihn: »Unsere Würfel sind noch im Spiel. Genosse Stalin schickt eine Abordnung Wissenschaftler zwecks Studiums deutscher Beutewaffen nach Berlin. Der Genosse Chefkonstrukteur Sergejew leitet eine der Gruppen und reist ebenfalls nach Deutschland. Vielleicht ist er interessiert, dich mitzunehmen. Das würde dich vorerst aus Berijas Schusslinie befördern.«
Die Limousine verlor an Tempo, bog ab und näherte sich dem nordwestlichen Spasski-Tor, der üblichen Zufahrt für Kremlbesucher.
»Bist du im Kreml verabredet?«, fragte Nikolaj.
»Erwähnte ich das nicht? Wir treffen gleich den Genossen Stalin. Er hat Kunzewo verlassen und wegen der Bombe eine Dringlichkeitssitzung des Politbüros einberufen. Alle werden da sein.«
»Wieso wir?« Nikolaj glaubte, sich verhört zu haben.
»Du wirst mich begleiten.«
4
Die bitterste Frucht des Krieges ist der Hass.
Annemarie Sadler
Der Arzt kniff und zerrte an Kathis Haut, als wäre es ein Gummiband, stieß Nadeln in sie, entnahm Blut, spritzte Undefinierbares in ihren Körper. Er riss ihren Mund auf und musterte ihre Zähne, er verlangte Kniebeugen und hieß sie bücken, inspizierte jede einzelne Körperöffnung. Zuletzt ließ er sie auf einen Stuhl klettern. Er untersuchte sie gynäkologisch und stieß seine Finger tief in sie hinein.
Klaglos ließ Kathi alles mit sich geschehen. Sie litt andere Schmerzen. Man hatte sie von Franzi getrennt! Tat man ihr das Gleiche an wie ihr? Wie viel Angst musste ihre kleine Schwester gerade ausstehen! Sie wollte bei Franzi sein, sie in ihre Arme nehmen und trösten. Sie hatte ihrer Mutter versprochen, Franzi zu schützen, und bei der ersten Gelegenheit versagt. Innerlich glühte sie vor Wut, wollte toben, wollte schreien.
Auch wenn sie keine andere Wahl gehabt hatte, so war sie dennoch aus freien Stücken in Nikolajs Flugzeug gestiegen, hatte sich dafür gute Gründe eingeredet. Die Politkommissarin Oberst Sonia Petrowa hatte ihr in Aussicht gestellt, sie könne ihren in Russland gefangenen Vater wiedersehen. Und sie bot ihr ein Studium ihrer Wahl in Moskau an, während im Nachkriegsdeutschland die Universitäten auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben würden. Aber erst als Sonia ihr noch Nikolaj vorstellte, hatte sie sich endgültig einlullen lassen, sich in absurden Träumereien verloren; sich wie eine Idiotin benommen. Nicht einen Deut unterschied sie sich von den albernen Gänsen im Lyzeum, die mit leuchtenden Augen über Kriegshelden getuschelt hatten.
Nach der Untersuchung wurde Kathi wieder dem Rotarmisten übergeben. Sie bestürmte ihn sogleich mit Fragen nach ihrer Schwester und Xenia. Aber er wies sie barsch zurück.
Der Soldat führte sie durch ellenlange, schlecht beleuchtete Flure und sperrte sie schließlich in einen engen, vom Boden bis zur Decke gefliesten Raum. Es gab keinen Tisch, keinen Stuhl, nur eine Lampe an der Decke, die alles in grelles Licht tauchte. Der Anblick der Fliesen genügte, um in Kathi ein dumpfes Gefühl der Beklemmung hervorzurufen. Eine Weile schrie und hämmerte sie gegen die Tür, in der Hoffnung, damit Xenias Erscheinen herbeizuführen. Am Ende erreichte sie lediglich, dass ihr Hände und Kehle schmerzten. Erschöpft ließ sie sich zu Boden sinken.
Die vorangegangenen Ereignisse hatten ihr ihre Rechtlosigkeit unmissverständlich vor Augen geführt. Die grobe Behandlung des Arztes, seine Kniffe, jeder seiner Blicke zeigten ihr, was er für sie empfand: Verachtung. Der Mann hasste sie, eine Fremde, der er nie zuvor begegnet war. Er hasste sie allein für das, was sie war: eine Deutsche.
Kathi erkannte darin die nachhaltigste Wirkung des Krieges. Den unversöhnlichen Hass der Menschen. Und als öffneten sich die Schleier der Zukunft vor ihr, wurde ihr ein seltener Moment der Klarheit zuteil: Dieser Hass würde nicht verschwinden, sondern seine Saat würde in den Herzen der Menschen weiter keimen und ausschlagen.
Ein eisiger Hauch legte sich über Kathi. Sie schlang die Arme um sich, im instinktiven Versuch, sich an der eigenen Wärme festzuhalten. Unwillkürlich drängte sich Dorota in ihren Verstand. Ach, sie vermisste die herzensgute Polin, die über vierzig Jahre dem Sadlerhof als Wirtschafterin treu gedient hatte und ein Teil der Familie geworden war. Dorota war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, sie besaß das Zweite Gesicht. Der Sinn ihrer Prophezeiungen offenbarte sich allerdings meist erst dann, wenn sie eintrafen. Und das taten sie stets. Manche früher, manche später. Mit elf Jahren war Kathi selbst Gegenstand einer Prophezeiung Dorotas geworden. Damals hatte sie gerade erst Anton, ihren Freund und Kameraden, verloren und war untröstlich in ihrem Schmerz. Weinend war sie auf den Hügel geflüchtet und hatte Schutz an ihrem Lieblingsplatz unter dem alten Apfelbaum gesucht.
Dorota fand sie und leistete ihr Gesellschaft. Plötzlich kam Wind auf, er rüttelte an Ästen und Zweigen, zerrte an ihren Haaren und Kleidern.
Dorota sprang auf, breitete die Arme aus, als wollte sie die Elemente umfangen, und rief: »Das Dunkel, du wirst es sehen! Das Einhorn ist fort, aber der Sternenmann wird kommen und dich mitnehmen! Doch hüte dich vor der falschen Biene! Hüte dich vor der falschen Biene!«
Dorotas damalige Weissagung hatte sich in Teilen bewahrheitet. Anton, das Einhorn, war fort, und der Sternenmann, Nikolaj, hatte sie mit nach Moskau genommen. Was es mit der falschen Biene auf sich hatte, darüber grübelte Kathi bis heute nach.
Nikolaj, der Sternenmann. Der Gedanke an ihn entfachte neuen Zorn. Bei der ersten Gelegenheit hatte er sie an Xenia weitergereicht! Wenn er Xenia kannte, weshalb wusste er dann nicht, was für eine Person sie war? Diese Frau zeichnete sich durch unnachgiebige Härte aus. Kathi fasste einen Entschluss, straffte ihr kleines Kinn. Wenn sie überleben und Franzi schützen wollte, musste sie sich ihrer Umgebung anpassen. Von nun würde auch sie sich mit Härte wappnen.
5
Eine Kirche ohne Glocken ist wie ein Mann ohne …
Semjon Semjonow
Unweit von Moskau, in der kleinen Gemeinde Terjochowo, hatte sich das gesamte Dorf in der kleinen Kapelle zur Heiligen Jungfrau eingefunden, um von Olga Fedorowna Semjonowa Abschied zu nehmen.
Der alte Pope sparte nicht an Worten und noch weniger an Weihrauch. Olgas Witwer Semjon Jakowlewitsch Semjonow kniete in der ersten Reihe und fühlte sich von dem brennenden Kraut schon völlig benebelt. Äußerlich entsprach er vollkommen dem Bild eines trauernden Witwers: Die Schultern gramgebeugt, die Hände gefaltet, suchte sein Blick immer wieder den einfachen Holzsarg, als könne er nicht begreifen, dass seine Frau nun zwischen diesen Brettern ruhte.
In Wahrheit erging sich Semjon Jakowlewitsch gerade in höchst unheiligen Gedanken. Er bedauerte, dass man eine Seele nicht sezieren konnte. Seit ihm die ganze Wahrheit über seine Frau offenbar geworden war, fragte er sich, was eine pathologische Untersuchung von Olgas Seele zutage fördern würde. Es wunderte ihn ohnehin, dass die Kälte ihrer Seele nicht sämtliche Kerzen in der Kirche zum Erlöschen brachte.
Über seine eigene Seele machte sich Semjon wenig Illusionen. Vermutlich war sie so schwarz wie die Lungen der Bergarbeiter am Donbass. Und mit reichlich Wodka konserviert. Der Gedanke erheiterte ihn und weckte seine Gelüste nach einem Glas. Oder zwei. Aber er riss sich zusammen, blieb in seiner Rolle. Wahrte Anstand, wahrte Lüge.
Genauso hielt es auch das gesamte Dorf. Olga Fedorowna Semjonowa war tot, und das war das Beste, was man über sie sagen konnte. Mörderisch wie Medea und geifernd wie Xanthippe, hatte sie Semjon die Hölle auf Erden bereitet. Und jeder im Dorf wusste darüber Bescheid.
Verstohlen behielt Semjon die Uhr im Auge. Er musste dringend nach Moskau. Sein Versuch, die Beisetzung um einen Tag zu verschieben, war nicht nur am Willen des Popen, sondern auch am Wetter gescheitert. Die anhaltende Sommerhitze machte eine rasche Beisetzung unumgänglich.
Sobald der Pope den letzten Segen gesprochen und Semjon die Beileidswünsche der Dorfbewohner entgegengenommen hatte, lotste er die Trauergemeinde in die Dorfschenke. Dort orderte er Wodka und Essen für alle, überließ sie dem Trinken und Schmausen und machte sich durch den Hinterausgang davon. Ihn trieb eine Mischung aus alter Gewohnheit und einer Hoffnung, die er sich niemals erlaubte aufzugeben. Weil der Tod von so vielen Tapferen, die sich für ihre Sache geopfert hatten, dann völlig umsonst gewesen wäre.
***
Wie ein einfacher Bauer vom Land gekleidet, die lange Gestalt gekrümmt und sein auffällig rotes Haar unter einer derben Kappe verborgen, näherte sich Semjon dem nordwestlichen Zugang zum Roten Platz. Einst hatte sich dort das Auferstehungstor befunden. Deshalb war es in den Anfängen der Revolution von seinen Mitstreitern als Treffpunkt auserkoren worden: weil sie eines Tages auferstehen und die alte Ordnung wiederherstellen würden.
Stattdessen gab es das im Jahr 1680 erbaute Tor nicht mehr. 1931 war es auf Geheiß der Bolschewiki-Regierung abgerissen worden, um Platz zu schaffen für die Panzer, die an den Paraden zur Feier des Jahrestags der Machtergreifung teilnahmen. Auch die kleine Kapelle, in der er als junger Mann vor der Gottesmutter-Ikone von Iviron gebetet hatte, war den roten Barbaren zum Opfer gefallen.
Mangels Erlösertor und Kapelle blieb ihm nichts anderes übrig, als über den Platz zu marschieren, als strebte er einem festen Ziel zu. Mit der Miene eines Besuchers, der die Wunder Moskaus das erste Mal erblickte, behielt er seine Umgebung im Auge, achtete auf mögliche Beschatter oder Auffälligkeiten und schlenderte bis zur prachtvollen Basiliuskirche. Mit ihren pittoresken Zwiebeltürmen und dem farbenfrohen Anstrich erweckte sie den Eindruck, als wäre sie aus Zuckerwerk modelliert.
Der Anblick der Kathedrale stimmte ihn stets melancholisch. Auch dieses Wahrzeichen Moskaus hatte der Bann des Politbüros getroffen: Sie erschossen den Priester, aber ihr Versuch, die Kathedrale in ein Museum umzuwandeln, schlug fehl. Die Moskauer sahen darin weiter ihre Kirche und betraten das Museum zum Gebet.
1929 wurde die Kathedrale deshalb für alle Gläubigen geschlossen, ihre Glocken abgebaut und teilweise eingeschmolzen.
Zwei Männer erregten nun seine Aufmerksamkeit. Sie näherten sich aus verschiedenen Richtungen einer hundert Meter vor ihm ausschreitenden Frau in bäuerlicher Kleidung. Offenbar wollten sie sie in die Zange nehmen.
Er beschleunigte seinen Schritt.
6
Erinnerungen haben ihre eigene Sicht der Dinge.
Aus »Honigtot«
Moskau! Endlich … Zum ersten Mal seit siebenundzwanzig Jahren setzte sie ihren Fuß wieder auf den Roten Platz.
Gott, wie sehr sie diese wunderbare Stadt vermisst, sich in all den Jahren nach ihr gesehnt hatte, der Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen war, in der sie ihre Kindheit und Schulzeit verbracht und in der sie ihre erste Liebe erlebt hatte. In dieser Stadt hatte sie Glück und Freude erfahren, bis sich alles in Tod und Trauer verwandelt hatte. Sie allein war noch von ihrer Familie übrig.
Aber sie war nicht hier, um alte Geschichten aufzuwärmen oder um die Toten zu betrauern. Das hatte sie bereits vor langer Zeit getan. Sie besaß nun eine eigene Familie. Einen Mann und zwei Töchter. Ihre Töchter wusste sie in Sicherheit. Sie hatte sie noch rechtzeitig nach London schicken können.
Nun ging es um ihren geliebten Mann Laurenz. Um seinetwillen war sie hier. Er war im März 1944, nur wenige Wochen nach seiner Einberufung, in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Der Gedanke, dass der Vater ihrer Kinder fern von ihr sterben könnte, war ihr unerträglich, und das hatte einen verrückten Plan in ihr reifen lassen: ihren Mann zu retten.
In Moskau hoffte sie in Erfahrung zu bringen, in welches Lager man ihn gebracht hatte. Sie würde ihn befreien und nach Hause bringen. Nicht mehr und nicht weniger.
Sie nahm den Kreml in Augenschein, musterte verächtlich die roten Fahnen, die sich über seinen Dächern im Wind blähten. Getränkt mit dem Blut eines betrogenen Volkes. Mochte die Farbe der Fahne dort oben auch gewechselt haben, dieses Gebäude bestand seit Jahrhunderten, und seine Mauern wurzelten tiefer als die Saat eines Marx, Lenin oder Trotzki. Weil es mit dem Blut und dem Schweiß des gesamten russischen Volkes erbaut worden war. Die neuen Herren mochten es noch so sehr leugnen, aber jeder Moskauer, der den Kreml ansah, erblickte darin die Glorie vergangener Zeiten. Eines Tages, und diese Überzeugung wurzelte ebenso tief in ihr wie das Fundament, auf dem der Kreml ruhte, würde man sich mit Stolz erneut der russischen Geschichte zuwenden. Eines Tages würde wieder der weißgoldene Zarenadler über den Mauern wehen.
Sie wandte sich ab. Mochte sie auch ihre Familie und Freunde verloren haben, so gab es dennoch Verbündete. Menschen, die den Romanows weiterhin treu ergeben waren. Menschen, die sie bei ihrem Vorhaben unterstützen würden. Und dieses Mal würde sie nicht scheitern!
Lange Zeit war es ihr gelungen, die schrecklichen Ereignisse von 1918 zu verdrängen, wie auch die folgenden Jahre ihrer erniedrigenden Gefangenschaft. Mit dem Betreten ihrer Heimatstadt kam alles wieder hoch.
1918, dieses furchtbare Jahr, in dem alles verloren ging, ihre Eltern und Geschwister gemeinsam mit Zehntausenden niedergemetzelt wurden, weil Lenin und Tschekisten wie Latsis die Parole ausgaben: »Wir beenden die Bourgeoisie als Klasse. Darin liegt der Sinn des roten Terrors.« Die Bolschewiki ermordeten jeden »Klassenfeind«, Adlige, Bürgerliche, Offiziere, Priester und Nonnen genauso wie streikende Arbeiter und protestierende Bauern, die sich gegen Zwangsarbeit und Zwangskollektivierung wehrten. Selbst die jungen Kadetten der Militärschulen wurden ermordet, darunter auch ihr dreizehnjähriger Bruder Ilja. Später hatte sie oft über die unfassbare Ironie des Schicksals gegrübelt, das sie ausgerechnet in Deutschland Zuflucht finden ließ, nur um dort auf dieselben Fanatiker zu treffen, diesmal im braunen Gewand.
Sie selbst befand sich in jenem verhängnisvollen Sommer 1918 mit einigen Mitstreitern auf dem Weg nach Jekaterinburg, um den letzten Auftrag ihres Vaters zu erfüllen: die Zarenfamilie aus den Händen der Bolschewiken zu befreien.
Ihr Vater Boris, Chef der zaristischen Geheimpolizei, hatte alles akribisch geplant, die entsprechenden Reisedokumente besorgt und die Fluchtroute bis ins letzte Detail vorgezeichnet. Selbst für ein mögliches Scheitern war Vorsorge getroffen worden. Sie mussten Parolen auswendig lernen und sich Kontaktpunkte in Moskau, Sankt Petersburg und Breslau einprägen.
Allerdings hatten sich heute, siebenundzwanzig Jahre später, zwei der von ihrem Vater verfügten Kontaktpunkte bereits als Sackgasse erwiesen.
Sie näherte sich den Kremlmauern aus nordwestlicher Richtung, als sie irritiert innehielt. Das Wiederauferstehungstor, es war verschwunden! Auch die kleine Kapelle der Muttergottes suchte sie vergeblich. Sie hatten beides niedergerissen! Oh, diesen Barbaren war nichts heilig! Wenigstens die Basilius-Kathedrale stand noch. Ihre Zwiebeltürme ragten seltsam tröstlich in den Himmel, und ein Seufzer entwich ihrer Brust, als sie ihren Weg in Richtung der Kathedrale fortsetzte. Zu ihrem Entsetzen bemerkte sie aus dem Augenwinkel, wie sich ein Mann von der Mauer eines angrenzenden Verwaltungsgebäudes löste und sich an ihre Fersen heftete. Sie hätte es vorgezogen, wenn er schnurstracks auf sie zugekommen wäre und sie nach ihren Papieren gefragt hätte, anstatt ihr heimlich zu folgen. Sie behielt ihren Schlendergang bei. Verdammt, sie hatte sich wie eine Anfängerin benommen! Anstatt in ihrer Rolle zu bleiben, hatte sie sich, als sie begriff, dass das Wiederauferstehungstor und die Muttergottes-Kapelle niedergerissen worden waren, von ihren Gefühlen leiten lassen. Vorsichtig tastete ihre Hand nach dem Messer in ihrem Rock. Wenn sie den Mann töten musste, um ihn loszuwerden, würde sie keine Sekunde zögern. Vorsorglich steckten auch eine Zwiebel und etwas Brot in ihrer Tasche, um für den Fall der Fälle eine Erklärung für das Messer vorweisen zu können. Fände man das zweite Messer in ihrem Stiefel, erübrigte sich ohnehin jede weitere Ausflucht.
Mit jedem Schritt wuchs die Basilius-Kathedrale vor ihr weiter in die Höhe. Plötzlich hatte sie eine Eingebung, wie sie ihren Verfolger loswerden konnte. Sie rief sich alles ins Gedächtnis, was sie über die Kirche des seligen Basilius wusste. Vor allem ihre unterirdische Beschaffenheit und die Nekropole, durch die ihr Vater sie einst geführt hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war. Damals konnte sie seinen Stolz deutlich fühlen, weil sie keinerlei Furcht zeigte, als sie in die Stadt der Toten hinabstiegen. Von dort führte sie ihr Vater über geheime Stollen wieder nach draußen. Sie musste in die Kathedrale gelangen und den Geheimgang wiederfinden! Sie angelte die Zwiebel hervor und ließ sie scheinbar ungeschickt fallen. Während sie sie auflas, bemerkte sie einen zweiten Verfolger, der sich ihr von der anderen Seite des Platzes näherte. Zwei Fluchtwege waren ihr damit bereits versperrt. Sie glaubte nicht an einen Zufall, die Männer mussten sie bereits erwartet haben. Wie war dies möglich? Sie hatte jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergriffen, bevor sie die zwei Kontaktstellen aufgesucht hatte.
Unmerklich beschleunigte sie ihren Schritt. Noch fünfzig Meter, noch vierzig, noch dreißig.
»Stoj!«, erklang hinter ihr der scharfe Ruf.
Sie gab ihre Tarnung auf, begann zu rennen, warf sich dem Portal der Basilika entgegen. Doch es war verschlossen!
Sie rannte links um die Kathedrale herum, hielt ihr Messer bereit. Ein Blick zurück zeigte ihr, dass nur einer der Männer sie unmittelbar verfolgte. Wo war der andere hin? Egal, jetzt, da sie nur noch einen Gegner hatte, schlüpfte sie in eine der Nischen, die sich rund um die Kathedrale auftaten, und stellte sich ihrem Verfolger mit gezückter Klinge. Ihr Herz pumpte vom schnellen Lauf.