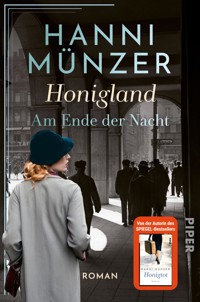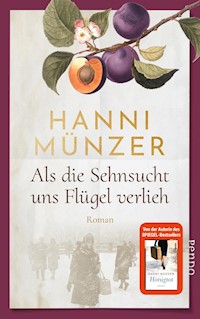7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das größte Abenteuer ist die Liebe … In ihrem Roman »Unter Wasser kann man nicht weinen« erzählt Bestseller-Autorin Hanni Münzer die ebenso emotionale wie faszinierende Geschichte von Jason Samuel aus »Solange es Schmetterlinge gibt« fort. Das Geheimnis des Ozeans, eine schicksalhafte Liebe und eine Reise, die das Leben von drei Freunden für immer verändern wird. Sie kennen sich seit gemeinsamen Kindertagen: Jason, Stephen und seine kleine Schwester Emily. Diese unbeschwerten Tage sind lange vorbei, als Jason zu Stephens Hochzeit nach Los Angeles fliegt. Doch sein Freund erscheint nicht am Flughafen; Stephen ist wie vom Erdboden verschluckt. An welcher bahnbrechenden Entdeckung hatte der Wissenschaftler zuletzt gearbeitet? Wie weit sind seine Gegner bereit zu gehen? Bald muss sich Jason nicht nur um Stephen sorgen, sondern auch um die junge und impulsive Emily. Die kleine Rebellin und Klimaaktivistin steckt schon wieder kopfüber in Schwierigkeiten. Seit sie als kleines Mädchen miterlebte, wie ein Delphin qualvoll an Plastikmüll verendete, hat sie eine Mission: die Rettung der Welt. Ihre Aktionen sind mutig, und sie gefallen nicht jedem. Die jüngste kostet sie ihr Stipendium, keine andere Universität ist mehr bereit, sie aufzunehmen. Wenig später verschwindet auch sie spurlos. Während Jason bei seinen Nachforschungen in ein Wespennest aus Intrigen und Profitgier sticht und erkennt, mit welch mächtigem Gegner er es zu tun hat, muss er sich eingestehen, dass er mehr als nur freundschaftliche Gefühle für seine Kindheitsgefährtin Emily hegt … Münzers Bücher haben eine Botschaft.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
In Gedenken an X. Ich hoffe, du hast die bessere Welt gefunden, nach der du so gesucht hast!
© Piper Verlag GmbH, München 2018 Covergestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano Covermotiv: Mark Owen/Trevillion Images; nazarethman/Getty Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhaltsverzeichnis
Cover & Impressum
Prolog
TEIL 1: Vergangenheit
1999, Kalifornien / USA: Mooncave-Bucht
2011, San Diego: Mission Bay
2012: Homer
2013
2014
2015
Henoch
Emily
2017
Emily
TEIL 2: Gegenwart
Emily
Fritz
Stephen
Jason: München/Deutschland
Emily: South (Central) Los Angeles/Kalifornien/USA
Jason: München → Los Angeles/Kalifornien/USA
Emily
Fritz
Emily
Citizen
Emily
Henoch
Emily
Ryan: Washington, D.C. / Zentrale der DIA
Emily
Jason
Emily
Jason
Raffaella
Jason
Die Harpers
Homer
Jason
Rückblick: Vor drei Jahren
Emily
Jason
Emily
Rabea
Jason
Emily
Stephen
Ryan
Homer
Jason
Ryan
Jason
Emily
Jason
Ryan
Jason
Stephen
Jason
Emily
Rabea
Homer
Jason
Emily
Fritz
Jason
Epilog
Nachwort
Zeit, Danke zu sagen
Literaturnachweise/Links
Quellenhinweis
Ein paar Fakten (nur für Interessierte)
»Tränen kann man trocknen, aber das Herz – niemals.«
Margarete von Valois (1553 – 1615)
»Delfine sind intelligente Tiere. Was man von ihren Jägern nicht behaupten kann.«
Emily Harper aus »Unter Wasser kann man nicht weinen«
Prolog
»Warum liebst du mich?«, fragte sie. »Wie viel Zeit hast du?«, fragte er.
TEIL 1
Vergangenheit
»Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons.«
»Der kleine Prinz« Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944)
Frei übersetzt: Um einen Schmetterling lieben zu können, müssen wir auch ein paar Raupen mögen.«
1999, Kalifornien / USA
Mooncave-Bucht
»Wer zuerst an der Boje ist!«, rief Stephen. Er war bereits aufgesprungen und schnappte sich sein Board.
Jason stieß einen unwilligen Seufzer aus. Das Salz auf seiner Haut war kaum getrocknet und die Haare noch feucht. Sein Freund schien mehr Fisch als Mensch zu sein, hielt es kaum eine halbe Stunde an Land aus. So gern sich Jason selbst im Element Wasser aufhielt, gerade hätte er es vorgezogen, noch eine Weile am Strand zu dösen – um seinen Tagtraum mit der knackigen Surflehrerin weiterzuspinnen. Denn ein Traum würde es bleiben, er war dreizehn, die Frau mindestens doppelt so alt, und damit für ihn genauso unerreichbar wie der Mond. Er gab sich ein paar Sekunden, bevor er sich herumrollte und ebenfalls auf die Beine kam. »Willst du etwa schon wieder verlieren?«, grinste er, fischte sein eigenes Board aus dem Sand und klemmte es sich unter den Arm.
»Angeber!«, rief Stephen und spurtete der Brandung entgegen. Jason wollte hinterher, als ihn eine piepsige Mädchenstimme ausbremste: »Ich auch! Ich auch!«
Stephens kaum vierjährige Schwester Emily kämpfte sich auf ihren pummeligen Beinen durch den Sand, dicht gefolgt von ihrem tapsigen Hundewelpen Homer. Himmel, dachte Jason, wo kommt sie denn jetzt her? … Die findige Kleine musste es erneut bewerkstelligt haben, ihrer überfürsorglichen Mutter zu entwischen.
Emily sah aus wie ein paniertes Schnitzel – ihre Mutter schmierte sie jeden Morgen dick mit Sonnenschutzcreme ein, und Emily, die das nur unter Protest über sich ergehen ließ, wälzte sich danach sofort im Sand. Wie ältere, pubertierende Brüder nun einmal sind, nannte Stephen Emily deshalb »kleines Schweinchen«. Jason hingegen hatte einen anderen Spitznamen für Emily. Er sah sich nach seinem Freund um, doch Stephen hatte sich längst mit blindem Wettkampfeifer in die Wellen gestürzt.
»Wo ist deine Mutter, Seepferdchen?«, fragte Jason und beugte sich zu ihr herab.
»Friseur«, antwortete Emily und strahlte ihn an. Jason war ihr erklärter Liebling.
»Und dein Vater?«
Diese Frage entlockte Emily ein freundliches Blinzeln, was Jason vermuten ließ, dass Emily für dieses Mal nicht ihrer Mutter, sondern dem Vater entwischt sein musste.
Emily hängte sich an seinen Arm. »Schwimmen!«, sagte sie und zog ihn energisch in Richtung Meer. Inzwischen hatte ihr großer Bruder das Fehlen seines Freundes bemerkt. Mit verdrießlichem Gesicht watete Stephen aus dem Wasser.
»Was machst du hier, kleines Schweinchen?«, rief er unwillig schon von Weitem.
»Schwimmen!«, forderte die Kleine lautstark.
»Kommt nicht infrage! Wo sind Mama und Papa?« Er sah sich suchend um.
»Mama ist beim Friseur, und Papa hat gesagt, du sollst auf mich aufpassen. Er muss etwas … äh … exprepedieren.«
Stephen rollte mit den Augen. Ihr Vater war Physiker, und wenn er sich in eines seiner Experimente vertiefte, hörte die Welt um ihn herum auf zu existieren.
»Also gut.« Stephen hob den Hundewelpen auf, der um seine Beine zappelte und eifrig dabei war, das Salz von seiner Haut zu lecken. Mit dem anderen Arm nahm er Emily hoch. Er platzierte Emily auf seinem Handtuch und setzte ihr den kleinen Hund auf den Schoß. »Du und Homer«, sagte er mit seiner strengsten Großer-Bruder-Stimme, »rührt euch nicht einen Zentimeter vom Fleck, bis Jason und ich zurück sind! Wir paddeln nur kurz zur Boje raus. Wenn du brav bist, Emily, und hier auf uns wartest, bekommst du danach ein Eis. Einverstanden?«
Emily schob die Unterlippe vor, wägte Schwimmen gegen Eis ab und nickte dann. Ihrem trotzigen Ausdruck nach fügte sie sich nur widerwillig der höheren brüderlichen Instanz – selbst mit der Aussicht auf Belohnung.
»Braves Schweinchen«, grinste Stephen. »Los, Jason, die Wette gilt!« Und flitzte los.
Jason warf einen zögerlichen Blick auf Emily, doch die Kleine war mit Homer beschäftigt. Er spurtete seinem Freund hinterher.
Die Jungen erreichten die Boje gleichzeitig und stritten sich darüber, wer sie zuerst berührt hatte, als Jason bemerkte: »Wo ist Emily?« Ihre kleine Gestalt war weder auf dem Handtuch noch irgendwo sonst am Strandabschnitt zu sehen. Nur Homer tobte wie verrückt über den nassen Sandstreifen, der das Meer vom Strand trennte. Der Wind hatte zwischenzeitlich aufgefrischt, und die hohen, der kleinen Bucht zueilenden Wellen nahmen Jason immer wieder für einige Sekunden die Sicht auf ihren Strandplatz.
»Verdammt!«, fluchte Stephen, dem schlagartig alles Blut aus dem Gesicht gewichen war. Mit fliegenden Armen paddelten die beiden Freunde los.
»Ich sehe sie! Sie ist im Wasser!«, schrie Jason, der Stephen eine halbe Länge voraus war.
»Emily!«, brüllten die Jungen. »Wir kommen! Halte durch!«
Als sie nahe genug heran waren, sahen sie, warum Emily ihr Verbot missachtet hatte: Die Kleine saß im flachen Wasser und hielt ein Delfinbaby auf den Knien. Die Schnauze des Tieres steckte in einer Plastikschlinge – der Namenszug einer handelsüblichen Getränkemarke war noch zu erkennen. Beim vergeblichen Versuch, sich davon zu befreien, hatte sich das Tierbaby immer weiter in der Schlinge verheddert, die sich dadurch tief ins Fleisch geschnitten hatte.
Der kleine Delfin schlug nur noch schwach mit der Flosse und in seinen Augen spiegelten sich Panik und Schmerz. Dicke Tränen liefen über Emilys Wangen, ihre Stimme war ein einziges Flehen. »Hilf ihm, Stephie, bitte, bitte, hilf ihm!«
Stephen spurtete zu seinem Rucksack, kehrte mit seinem Taschenmesser zurück und durchtrennte das Plastik vorsichtig. Doch es war zu spät. Die Flosse zuckte ein letztes Mal; der kleine Delfin starb in Emilys Armen.
Emily heulte auf, hielt das Tier an sich gepresst, küsste immer wieder seine Stirn und rief: »Wach auf, kleiner Delfin, wach auf!«
Die Verzweiflung des kleinen Mädchens zerriss Jason das Herz, und er schämte sich seiner eigenen Tränen nicht. Auch Stephen wischte sich verstohlen die Augen. Er kniete neben seiner Schwester, und da sie das Tier nicht loslassen wollte, trug er sie zusammen mit dem Delfinbaby nach Hause.
2011, San Diego
Mission Bay
Sie wusste alles über Delfine. Aufzucht, Nahrung, Verhaltensweisen in Freiheit und in Gefangenschaft. Doch das interessierte hier niemanden. Stattdessen ließ man sie die Seehundscheiße vom Felsen kratzen!
Entsprechend wütend turnte Emily auf der künstlichen Klippenlandschaft im Sea Adventure Park umher, fuhrwerkte und klapperte mit den Gerätschaften, dass selbst Murmeltiere davon wach würden. Wut und Putzen jedoch waren eine tückische Kombination … Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit wurde ihr zum Verhängnis: Sie stieß mit dem Ende ihres Schrubbers gegen den mit Hinterlassenschaften inzwischen reich gefüllten Eimer. Er kippte prompt um, kullerte über die nahe Kante und entließ die mühsam erarbeitete Ladung wieder in die Freiheit.
Emily fluchte.
»Das sagt man nicht, sonst straft einen Gott!«, meldete sich hinter ihr eine seltsam dumpfe Stimme zu Wort – als spreche jemand direkt aus den Felsen zu ihr.
Emily wirbelte herum und verlor dabei das Gleichgewicht. Wild rudernd konnte sie eben noch verhindern, selbst von der Kante zu purzeln. Stattdessen landete sie mit dem Hosenboden in einem schönen dicken Haufen Seehundscheiße. Frisch aus dem Eimer.
Sie linste über den Rand des Felsens und erblickte an seinem Fuß einen Dreikäsehoch, dessen Kopf in einem viel zu großen Astronautenhelm steckte. Sein Anblick erinnerte Emily an ein vom Himmel gefallenes Rieseninsekt. Zumindest wusste sie nun, warum die Stimme derart dumpf geklungen hatte. Das Alter des Jungen vermochte sie schwer einzuschätzen, der Statur nach konnte er kaum älter als sechs oder sieben sein.
Der Junge schob das Visier hoch. Darunter kam eine jener dicken Brillen zum Vorschein, die die Augen grotesk vergrößerten. Emily war nicht erfreut über die unerwartete Störung. Sie arbeitete lieber allein, so wie sie überhaupt gerne allein mit sich war. »Musst du dich so anschleichen?«
»Ich habe mich nicht angeschlichen, aber ich entschuldige mich dafür, dass ich dich erschreckt habe«, erwiderte er feierlich.
Emily seufzte. Der musste wirklich vom Himmel gefallen sein. Sicher war sein Vater eine Art Pastor. Oder Lehrer. Beides Berufsgattungen, zu denen sie ein eher gestörtes Verhältnis pflegte. Andererseits war gegen höfliche Kinder grundsätzlich nichts einzuwenden. Ihre Mutter jedenfalls hätte ihre helle Freude an dem Jungen gehabt. »Du hast mich nicht erschreckt«, erteilte sie ihm großzügig Absolution.
»Warum bist du dann vom Felsen gefallen?«
»Ich bin nicht vom Felsen gefallen«, erwiderte Emily hoheitsvoll und kletterte von der Klippe. Unten angekommen, klopfte sie sich die Tierkacke eher nachlässig von ihrem Overall.
»Was hast du denn ausgefressen?«, fragte der Junge weiter. Er stieß mit der Fußspitze gegen einen der Kotballen.
»Wie kommst du darauf?«
»Weil mein Vater mich immer die Schafscheiße zusammenrechen lässt, wenn ich etwas ausgefressen habe.«
»Und? Stellst du viel an?« Emily fand zunehmend Gefallen an dem kleinen Kerl.
»Och, eigentlich nicht«, sagte er gedehnt. »Aber du weißt, wie Eltern sind. Die finden immer was, was sie einem anhängen können. Und? Was war es bei dir?«, beharrte er auf einer Antwort.
»Du bist ganz schön neugierig.«
»Ich betreibe Konversation.«
»Wie bitte?« Verblüfft sah Emily ihn an.
»Vater sagt, Konversation sei wichtig, weil es Interesse zeige. Und Interesse führe zu Verständigung und Verständnis.«
»Aha.« Emily kratzte sich am Kopf. Was für ein komischer kleiner Kauz. Aber sie fand, er hatte die Wahrheit verdient: »Ich bin kurz vor Thanksgiving in eine Farm eingebrochen und habe die Truthähne befreit.«
»Krass!« Die überdimensionalen Augen hinter der dicken Brille leuchteten auf.
Emily sonnte sich in seiner Aufmerksamkeit. Der kleine Professor war der Erste, der sie deshalb nicht gleich mit Vorwürfen überhäufte.
»Und warum hast du das getan?«
»Damit die Leute die Truthähne nicht essen.«
»Und? Wurden sie nicht gegessen?«
Tja, dachte Emily, das war der wunde Punkt in ihrem Plan, sie hatte nämlich die Rechnung ohne die Truthähne gemacht.
Tagelang hatte sie die Farm ausspioniert und sich dabei mit den beiden Wachhunden angefreundet. An besagtem Abend hatte sie sie mit zwei sauriergroßen Kauknochen in einen Schuppen gelockt und eingesperrt. Dann hatte sie die Truthähne befreien wollen, doch die blöden Viecher hatten das Konzept der Freiheit nicht begriffen.
Fett und bequem im Stall liegend, ließen sie sich partout nicht von ihrem warmen Strohplätzchen vertreiben, geschweige denn durch das Gatter in eine unbekannte Dunkelheit hinausscheuchen. Mehr noch: Sie hatten lautstark gegen ihre Befreiung protestiert! Emily hätte niemals geglaubt, dass dieses Federvieh zu einem derartigen Höllenlärm fähig wäre.
Natürlich hatte das den Bauern auf den Plan gerufen, mitsamt drei Söhnen und ihren Flinten! Als zögen sie in den Krieg!
Am Ende hatten die beiden befreiten Hunde mit ihrem wilden Gebell mehr Truthähne aufgescheucht als sie, die eine Freifahrt in einem Polizeiwagen bekam.
Da sie noch keine sechzehn war, war die Strafe relativ mild ausgefallen: Der Jugendrichter hatte sie zu vierzig Sozialstunden im Sea-Adventure-Park verdonnert.
Das Urteil kam ihr sehr entgegen. Sie hing sowieso die meiste Zeit in der Mission Bay ab.
Gut, Scheißeschaufeln war kein Vergnügen, aber es gab definitiv Schlimmeres. Ungerecht war die zusätzliche Strafe, die sich der Richter für sie ausgedacht hatte. Irgendwer musste ihm gesteckt haben, wie gern sie sich um die Delfine kümmerte: Seit Truthahn-Gate durfte sie sich bis auf Weiteres dem Delfinarium nicht mehr nähern. Und das war es, was sie so rasend machte! Sie ließ es ungerechterweise an dem kleinen Professor aus: »Was hast du eigentlich an Thanksgiving gegessen?«
Der Kleine blinzelte sie an. Er verstand sehr wohl, dass er sich plötzlich auf unsicherem Terrain bewegte. Das Seehund-Mädchen war schmal und klein, und er hatte deshalb angenommen, sie stünde auf seiner Seite des Planeten. Doch nun benahm sie sich, als gehöre sie bereits der Erwachsenenwelt an. Außerdem hatte er so eine Ahnung, dass ihr seine Antwort nicht gefallen würde. Doch sein Vater hatte ihm früh beigebracht, dass Lügen die Dinge stets nur verschlimmerten: »Burger und Pommes«, sagte er tapfer und hielt ihrem Blick stand.
»Keinen Truthahn?« Das überraschte Emily. In ihrem Umfeld kannte sie keine Familie, die an Thanksgiving nicht über wehrlose Truthähne herfiel.
»Vater kann nicht kochen.«
Unvermittelt fühlte sich Emily verlegen. Sie hätte eigentlich jetzt nach seiner Mutter fragen sollen, aber sie war zu feige dazu, fürchtete sich vor einer traurigen Geschichte. Die Welt quoll über davon, Ungerechtigkeiten, wohin man schaute. Menschen töteten Menschen, töteten Tiere, zerstörten ihren Lebensraum, das Artensterben war in vollem Gange, die Ozeane vergiftet. Ihr gesamtes Leben bestand in einer Anhäufung trauriger Geschichten, als ziehe sie sie an. Und ihr einziger Schutzwall vor noch mehr Unglück war ihre Wut; vor vielen Jahren hatte sie ihr Inneres damit gepanzert.
Emily merkte, wie sie begann, um sich selbst zu kreiseln. Sie wusste, wenn sie den Kreis nicht durchbrach, würde auch ihr Verstand irgendwann in einen rotierenden schwarzen Mahlstrom geraten, bis sie erneut hinter einer inneren Wand säße, einer Mauer, Stein für Stein aus Angst und Entsetzen erbaut. Sie selbst erinnerte sich nicht an ihr Kindheitstrauma, jedoch hatte man es ihr auf Anraten eines Therapeuten erzählt. Besser, sie hätte es nicht erfahren. Ihr Unterbewusstsein hatte vermutlich gute Gründe gehabt, das Erlebnis aus ihrer Erinnerung zu löschen.
Emily musste sich anstrengen, um sich wieder in der unmittelbaren Gegenwart zurechtzufinden; der Zwerg war schließlich immer noch da. Etwas anderes geriet in ihren Fokus. Der Adventure Park öffnete erst um neun Uhr für den Publikumsverkehr, und es war noch keine acht! Wo kam der Junge so früh her?
»Wie bist du eigentlich hereingekommen? Der Zoo ist doch noch gar nicht geöffnet!« Sie hoffte, dass der Kleine nicht die Schwachstelle gefunden hatte, durch die sie außerhalb der Öffnungszeiten in die Anlage hinein- und hinausspazierte. Überdies war der Weg nicht ganz ungefährlich: Er führte mitten durch das Flamingogehege mit seinen Tümpeln.
»Mit Vater.«
»Arbeitet er hier?«, fragte Emily, nun ihrerseits neugierig geworden.
»Nein. Onkel Jeb hat es erlaubt.«
»Wer ist Onkel Jeb?«
»Na, sein Bruder!« Der Junge klang erstmals ein wenig ungeduldig, nach: Warum muss man Älteren immer das Offensichtliche erklären?
Emily wollte eben nachhaken, als ein weiterer früher Besucher ihre Aufmerksamkeit auf sich zog: Ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid und roten Gummistiefeln. Es saß hinter der Wegbegrenzung im Gras und rupfte büschelweise Halme methodisch aus. Dabei wiegte es seinen Oberkörper rhythmisch vor und zurück.
Der Junge war ihrem Blick gefolgt. »Das ist meine jüngere Schwester Maddie. Sie ist eine Zählerin.«
»Was ist eine Zählerin?« Unwillkürlich war Emily einen Schritt zurückgewichen – ein unbewusster Reflex, ausgelöst durch das jähe Gefühl, in eine fremde Anziehungskraft geraten zu sein. Der Begegnung mit dem Jungen und seiner Schwester haftete zunehmend etwas Unwirkliches an. Fast schien es ihr, als würde sie mit jedem weiteren Dialog mehr in deren Leben hineingezogen werden. Sie wollte das nicht! Tief in ihrem Inneren aktivierte sich ihr Selbstschutzprogramm, das den bewährten Befehl ausgab: Renn weg, Emily!
Als ahne der Junge ihren inneren Zwiespalt, ergriff er ihre Hand. »Komm, ich zeig es dir!«, rief er eifrig und zog sie energisch zu seiner Schwester hinüber.
»Maddie, das ist … oh! Wie heißt du eigentlich?«, wandte er sich an seine Begleiterin.
»Emily. Und du?«
»Ich heiße Fritz«, stellte sich der Junge vor, und zu Maddie: »Das ist Emily, Maddie. E M I L Y«, buchstabierte er. »Sie möchte dich gerne kennenlernen.«
»Nein!«, stieß Maddie mit einem atemlosen Laut aus, ohne Emily eines Blickes zu würdigen.
Emily fragte sich, ob das Mädchen die Begegnung generell ablehnte oder intuitiv erraten hatte, dass sie selbst nur ihre Ruhe wollte. Sie ergriff die Gelegenheit beim Schopf: »Lass gut sein, Fritz. Ich muss sowieso weiterarbeiten. War nett, euch zwei kennenzulernen.« Sie drehte sich weg.
»Warte! Bitte, Emily!« Seine Stimme klang so flehend, dass sie sich mit einem Seufzer umwandte. Fritz war wie ein Welpe, der um Aufmerksamkeit bettelte, und einem Welpen hatte sie noch nie widerstehen können.
»Maddie liebt Blumen«, sagte Fritz. Er bückte sich rasch, wobei er sich fast den Kopf an dem Schild Blumen pflücken verboten stieß, und rupfte eine Geranie aus dem Begrenzungsbeet. Anschließend überreichte er sie Maddie mit der Feierlichkeit einer Opfergabe.
Sie nahm sein Geschenk ungerührt entgegen, steckte die Blüte in den Mund, kaute konzentriert und schluckte sie sodann mit einem hörbaren Gulp hinunter.
Fritz wiederholte die Vorstellungszeremonie, und Maddie hob endlich den Kopf.
Emily sah in riesige Augen von einem verträumten Grau. Sie waren direkt auf Emily gerichtet, dennoch glaubte sie nicht, dass seine Schwester sie tatsächlich wahrnahm. Maddie sah durch sie hindurch, weilte weit weg von hier in einer Welt, die nur für sie selbst sichtbar war.
Es war fast ein bisschen unheimlich, und für einen kurzen Moment glaubte Emily in einen Spiegel zu blicken, in dem sie selbst gefangen war. Doch von einer Sekunde auf die andere veränderte sich Maddies Ausdruck, das Verträumte in ihren Augen verblasste, als hätte das Mädchen einen Schalter betätigt, der die Linse scharf stellte. Und dann ratterte sie plötzlich Zahlen herunter. »Zwei, zwei, eins, eins, zwei, fünf, fünf, zwei, acht, zwei …«
»Was tut sie da?«, flüsterte Emily, der der heilige Ernst imponierte, mit dem Maddie die Zahlen von sich gab.
»Sie zählt dich.«
»Sie tut was?«
»Ich erklär es dir später. Da kommt Onkel Jeb.«
Emily erstarrte. Onkel Jeb war niemand anderes als Jeremy B. Silversteen, der Geschäftsführer des Sea Adventures Park.
2012
Homer
Seit jeher mochte er Wochenenden.
Jeder hatte mehr Zeit, vor allem die Kinder – für Spaziergänge, fürs Herumtoben und Spielen; es gab Besucher und Ausflüge, und er konnte das eine oder andere zusätzliche Leckerli für sich herausschlagen.
Das Einzige, was er nicht mochte, war, dass Emily am Wochenende immer einfiel, ihn zu bürsten. Manchmal musste er auch baden. Emily nannte es Hygiene. Die Bürste war nicht unangenehm, aber er hasste es, wie ein Dandy auszusehen, pflegte lieber sein Straßenköterimage – er war nun einmal Promenade pur. Jetzt gerade war Wochenende, und als er Emily mit der Bürste um die Ecke biegen sah, wusste er: Er war wieder fällig. Verflixt, und das Shampoo hatte sie auch mitgebracht! Dabei war er vollkommen sauber, er hatte am Morgen ein ausgiebiges Bad im Meer genommen und anschließend ein zweites im Sand. Und sich mindestens sechsmal geschüttelt. Er war so hygienisch rein, wie man nur sein konnte!
»Was seufzt du denn, du alter Halunke?«
Das weißt du ganz genau. Ergeben setzte er sich vor Emily hin, Kopf und Ohren hingen.
»Meine Güte, Homer«, lachte Emily, »du tust ja wieder so, als ginge es aufs Schafott.«
Er fand das nicht lustig, und Fritz schien das genauso zu sehen. Der Junge war Emily gefolgt, und er sah ernst aus. Fritz kam seit einem Jahr mit seiner Schwester am Wochenende oft zu Besuch, mit ihm war prima zu scherzen, und Maddie war auch sehr lieb. Er mochte es, dass sie immer so still war, und er fand die sperrige Dose interessant, die sie meistens auf dem Kopf trug. Manchmal setzte auch Fritz sie auf.
»Glaubst du, dass Gott sauer auf meinen Dad ist? Oder auf mich?«, hörte er Fritz Emily fragen.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Na ja, er hat meine Schwester Maddie anders gemacht, und deshalb ist Mum weggegangen.«
»Deine Mum ist gestorben, das wolltest du doch sagen, oder?«
Fritz schüttelte energisch den Kopf, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben.
Emily ließ die Bürste sinken.
Deine Gelegenheit, Homer, dachte er. Er nutzte sie und brachte zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen sich und die Bürste. Kurz erwog er, ganz zu verschwinden, aber dann würde er etwas verpassen, denn seine Nase verriet ihm, dass hier gerade etwas Wichtiges zugange war. Meist verschwendeten die Menschen ihre Zeit mit Belanglosem, machten sich Sorgen über das Unabwendbare und vergaßen dabei das Ist. Jeder Tag ist neu, jeder Augenblick ist neu, jeder Knochen ist neu. Er genoss jede einzelne Mahlzeit, egal, wie viele er schon hatte. Das Glück ist ein gefüllter Napf.
Emily sah sich um. »Wo ist Maddie, Fritz?«
»Sie hilft deiner Mum im Garten.«
»Sollen wir in die Bucht runtergehen, und du erzählst mir, was du auf dem Herzen hast?«
Hurra, freute sich Homer und wedelte mit dem Schwanz. Meer, Sand und Gerüche!
»Warum glaubst du, dass Gott auf deinen Vater oder dich sauer ist?«, begann Emily, als sie unten am Strand angekommen waren.
»Ich habe nicht gesagt, dass ich das glaube, sondern ich habe dich gefragt, ob du das glaubst«, stellte Fritz richtig.
Da hat er recht, dachte Homer. Manchmal denkt Emily nicht daran, wie klug der Junge ist.
»Das kann ich dir aber nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was und wen du wieder belauscht hast, Fritz.«
Fritz bekam augenblicklich rote Ohren.
Er, Homer, bekam nie rote Ohren, obwohl er, wenn er nicht gerade ein Nickerchen machte, ständig lauschte. Deshalb wusste er, worauf Emily bei Fritz gerade anspielte. Heute war Sonntag, und Fritz hatte seinen Vater Walther, Pastor einer nahen Gemeinde, in den Gottesdienst begleitet. Davor und danach standen die Leute in Grüppchen beisammen, tauschten Neuigkeiten aus, und Fritz lauschte. Später berichtete er Emily alles Interessante. Offenbar hatte Fritz heute etwas erfahren, das er besser nicht hätte hören sollen.
Mit Fistelstimme imitierte Fritz nun zwei Frauenstimmen: »Der arme Reverend, was hat er nur verbrochen, dass Gott ihn so straft? Das eine Kind nicht richtig im Kopf und das andere noch ein Baby, als ihn seine Frau sitzen ließ!«
Und die andere Stimme, noch eine Nuance schriller: »Und der Junge ist so ernsthaft, und wie rührend er sich um seine Schwester sorgt! Er ist doch viel zu jung für so viel Verantwortung! Das ist einfach nicht recht.«
Und wieder die erste Fistelstimme: »Ja, seine Frau wäre besser gestorben und nicht mit dem Chorleiter durchgebrannt! Dann könnte unser Reverend wieder heiraten.
Ja, ich weiß schon, dass du ein Auge auf unseren guten Reverend geworfen hast, Orgasta …« Fritz verstummte.
»Auweia«, sagte Emily.
»Und, was glaubst du?«
»Dass das böse Zungen sind. Ich würde diese blöden Weiber aus der Kirche jagen.«
»Das würde mein Dad nie tun. Und es ändert auch nichts daran, dass ich es gehört habe, oder?«
»Auch wieder wahr. Erzähl deinem Vater von den beiden Klatschweibern, Fritz. Vielleicht fällt ihm dazu für nächsten Sonntag eine nette Predigt ein – über üble Nachrede und ihre Auswirkungen.«
»Emily, lenk nicht ab! Ich bin nicht doof. Vater hat wegen Mutter gelogen. Sie ist nicht gestorben, sie hat uns verlassen. Weil sie Maddie und mich nicht wollte! Und überhaupt, Maddie ist richtig, so wie sie ist! Weißt du was? Mir ist es völlig egal, ob Gott sauer auf Dad ist! Ich bin sauer auf Gott!« Seine Stimme brach, und er fing an zu weinen.
Emily legte einen Arm um ihn. »Wenn du magst, gehen wir zusammen zu deinem Dad und sprechen mit ihm.«
»Danke, Emily. Mir ist ganz komisch im Kopf. Dad lehrt uns ständig, dass wir immer die Wahrheit sagen müssen. Und dann lügt er selber.«
»Ich glaube, euer Vater wollte dich und Maddie damit nur schützen, Fritz. Die Wahrheit kann sehr wehtun.«
Fritz wischte sich die Augen. »Es tut wirklich weh.«
»Ich weiß.« Sie drückte ihn nochmals. »Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ich kenne eine über die Sterne.«
Oh! Homer horchte auf. Er liebte Emilys Geschichten. Ihre Stimme wurde dann immer so sanft wie ein Streicheln, und er konnte spüren, dass alles Schwere von ihr abfiel, Vergangenes an Bedeutung verlor, das Morgen in weite Ferne rückte, Emily im Ist war.
»Sieh hinauf zum Himmel, Fritz«, begann Emily. »Und jetzt schließ die Augen, und stell dir vor, es ist schon Nacht und der ganze Himmel voller leuchtender Sterne. Kannst du sie sehen?«
»Ja!«
»Wenn es dunkel wird, wird das Universum zum Spiegel, und dann kann sich jeder Mensch selbst darin sehen – als Stern, der sein Licht zurück auf die Erde wirft. Und selbst wenn ein Mensch gegangen ist, so leuchtet sein Stern für immer weiter.«
»Können wir uns das heute Abend zusammen ansehen?«
»Natürlich!«
»Zeigst du mir dann unsere Sterne?«
»Ja, nur Maddies Stern kann ich dir nicht zeigen.«
»Was? Aber … warum?«
»Weil Maddie etwas ganz Besonderes ist, Fritz. Sie durfte ihren Stern mit zur Erde nehmen. Das geschieht nur sehr selten. Manchmal braucht die Erde Menschen, die von innen heraus leuchten. So wie Maddie.«
Homer seufzte.
Am Abend schrieb Fritz einen Brief an Gott.
Hallo, lieber Gott!
Also, ich wollte Dir sagen, dass ich Dir wegen Maddie nicht mehr böse bin. Meine Freundin Emily hat mir alles erklärt.
Nichts für ungut!
Dein Fritz
PS: Und sag meiner Mum, ich bin ihr auch nicht mehr böse. Ich weiß jetzt, dass es manchmal einfach etwas länger dauert, bis man das Licht sehen kann.
2013
Der Wirt des Steakhouse hatte wenig zu tun. Die letzten Mittagsgäste hatten sich vor knapp zwei Stunden verabschiedet. Bis auf die beiden jungen Mädchen am Fenster war sein Laden wie leer gefegt. Davon abgesehen, dass die zwei nichts zum Essen bestellt hatten und sich seit geraumer Zeit an einer Tasse Tee festhielten – den sie gleich bezahlt hatten –, sahen die Mädchen aus wie Vogelscheuchen. So würden die ihm auch noch den letzten Gast vertreiben. Es war ihm ein Rätsel, was heutzutage in den Köpfen der jungen Menschen vorging, die sich ohne Not derart verunstalteten. Was brachte diese jungen Dinger in Gottes Namen auf die Idee, ihre Lippen schwarz und ihre Haare grün und lila zu färben? Und erst das ganze Metall in ihren Gesichtern? Das war ja mehr, als sein Bruder Ted auf seinem Schrottplatz herumliegen hatte! Aber natürlich war er tolerant, und solange sie nichts anstellten … Aber wenn das seine Töchter wären, dann würde er ihnen mal so richtig den … Die Türglocke unterbrach den unpädagogischen Gedanken. Fünf kräftige Männer drängten herein, alles Lkw-Fahrer, und sie sahen hungrig aus. Der Wirt freute sich auf den Umsatz.
Doch noch bevor alle richtig Platz genommen hatten, sprang der Erste schon wieder auf. »Frechheit! Das müssen wir uns nicht bieten lassen!« Lärmend stand der restliche Trupp auf und strebte der Tür entgegen. Der Wirt preschte hinter seinem Tresen hervor. »Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung?«, rief er.
»Das ist los«, rief einer der Männer und hielt dem Besitzer ein Blatt Papier unter die Nase. »Wollen Sie uns verarschen?«
»Was ist das?«, fragte der Wirt verdattert und las:
»Happy-Meat! Fleisch ist nicht nur Fleisch – es ist das verwesende Fleisch von Tierkadavern. Ein Kilo Fleisch kostet den Planeten 15 000 Liter Wasser – Täglich verdursten 10 000 Menschen, die meisten davon sind Kinder – Mit jedem Bissen Fleisch vernichten SIE den Planeten – Mit jedem Bissen Fleisch rauben SIE Ihren Kindern die Zukunft! Wer Fleisch isst, TÖTET! Happy Meat!!!«
Im Augenwinkel bemerkte der Wirt, wie die beiden Mädchen ihre Sachen packten. Ihm kam ein Verdacht. Misstrauisch stellte er sich ihnen in den Weg und fuchtelte mit dem Blatt vor ihren Gesichtern herum: »Wart ihr das?«
»Happy Meal!«, sagte die mit den grünen Haaren und war an ihm vorbeigewischt, bevor er reagieren konnte. Die andere erwies sich als genauso flink.
Er fluchte böse. »Verdammtes Gesindel! Lasst euch hier bloß nicht mehr blicken«, drohte er ihnen wütend, als sie zur Tür hinausrannten und dort noch mehr Flugblätter durch die Luft wirbeln ließen.
2014
»Finito! Das war’s!« Raffaella klatschte sich selbst Beifall. Soeben hatte sie die letzte Kiste mit Flugblättern gefüllt und zu den anderen gestellt. Nun gesellte sie sich zu Emily, die malend auf dem Boden lag. »Hey, Ragazza, wie weit bist du mit den Spruchbändern?«
Ohne von ihrer Arbeit aufzublicken, antwortete Emily: »Fünf sind fertig, am sechsten bin ich noch dran.« Eben war sie dabei, einer Robbe den letzten Schliff zu verleihen. Die Augen des Tieres blickten den Betrachter anklagend an – passend zu der abgebildeten Sprechblase: Die Children’s-Pool-Bucht gehört uns! Lasst uns unseren Lebensraum!
»Die sehen wieder fantastico aus!«, jubelte Raffaella.
Emily war sich da nicht so sicher. Ihre Freundin Raffaella fand schnell etwas fantastico. »Danke«, sagte sie trotzdem und beendete die Arbeit mit einem letzten Pinselstrich. Sie sprang auf und streckte sich ausgiebig. Seit dem frühen Morgen hatte sie Plakate gezeichnet und Spruchbänder beschriftet, darüber war es Mittag geworden. Manchmal beneidete sie Raffaella um ihre unverwüstliche Energie und Begeisterungsfähigkeit. Sie selbst fand selten etwas fantastico, ihr ständiger Begleiter war der Zweifel.
Emily sah sich um. Nach und nach trudelten auch ihre Mitstreiter ein, und die Scheune begann sich zu füllen. Emily zählte zufrieden zwei Dutzend, vor Ort würden noch mehr zu ihnen stoßen. »Wo steckt eigentlich Denise?«, fragte sie Raffaella, nachdem sie ihre gemeinsame Freundin nirgendwo entdecken konnte.
Raffaella verzog das Gesicht: »Denise hat mal wieder den Blues.«
Das war in der Tat weniger fantastico. Es bedeutete, dass Denise wieder in irgendeiner Ecke hockte und sich die Seele aus dem Leib heulte, als wolle sie die gesamte Welt im Alleingang von deren Sünden reinwaschen. In den letzten Monaten suchte der Blues ihre Freundin ziemlich häufig heim, und Emily bereitete diese Entwicklung zunehmend Sorge. Sie fragte sich, wie es dazu hatte kommen können, dass ausgerechnet ihre früher so mutig wie entschlossen auftretende Freundin immer wieder Phasen der Resignation durchlebte.
»Wo ist sie?«
»Beim Bienenhaus.«
Auch das noch … Die Stöcke gehörten ihrem Bruder Stephen. Er wäre nicht erfreut, ihre Freundin dort anzutreffen. Lärm störte die sensiblen Tiere, und aus Erfahrung wusste sie, dass Denise eher zu sirenenartigem Heulen als zu stillen Schluchzern tendierte. Stephen liebte seine Bienen wie Familienmitglieder, doch in letzter Zeit machte er noch mehr Gewese um sie. Das hing mit einer geheimnisvollen Entdeckung zusammen, die er ihnen zu verdanken hatte. Seitdem schloss er sich in jeder freien Minute in seinem Labor ein, so wie heute. Aber er hatte ihr versprochen, zur Demo an der Children’s Bay mitzukommen, und in der Regel hielt er seine Versprechen. Mit Sicherheit würde er jedoch vor der Abfahrt einen Abstecher zu seinen geliebten Bienen machen, darum sollte sie besser dafür sorgen, dass Denise bis dahin von dort verschwunden war.
Davon abgesehen, war es sowieso nicht gut, ihre Freundin in dieser Phase zu lange sich selbst zu überlassen. »Ich hole sie«, sagte sie zu Raffaella.
Neben der Mooncave-Bucht war die Wiese mit dem Bienenhaus Emilys liebster Ort.
Stephen, leidenschaftlicher Biologe und Wissenschaftler, hatte hier mit den Jahren das vollkommene Insektenparadies geschaffen. Überall zwischen den bunten Blumenkelchen summte und brummte es geschäftig. Auch wenn Emily es eilig hatte, verlangsamte sie ihren Schritt, gönnte sich einen kurzen Augenblick des Innehaltens, weil Hast in dieser Idylle nichts zu suchen hatte. Ihr Vater Joseph sagte immer, Eile sei von den Menschen erfunden, in der Natur käme sie nicht vor. Mit ihrem Blick folgte Emily dem taumelnden Flug eines orange leuchtenden Schmetterlings, der scheinbar Schwierigkeiten hatte, seine Wahl unter den farbenprächtigen Blüten zu treffen. Es war ein Ort der Unschuld und der Unbeschwertheit – ein Ort voll natürlicher Schönheit, der jedes Herz leichter machte.
Nur nicht das von Denise.
Emily traf ihre Freundin hinter dem Schuppen an, wo sie zusammengesunken an der Rückwand kauerte. Wie schon befürchtet, vergoss Denise Krokodilstränen und schluchzte dabei nicht eben leise vor sich hin. Sie reagierte erst, als ihr Emily die Hand auf die bebende Schulter legte.
Mit verquollenen Augen sah Denise auf. Emily reichte ihr wortlos ein Taschentuch und hockte sich neben sie. Sie kannte das Prozedere schon. Ihre Freundin würde sich jetzt geräuschvoll schnäuzen, anschließend verlegen lächeln und behaupten, sie sei ein Riesenschaf, weil sie sich so habe gehen lassen. Danach würde sie aufspringen und kämpferisch ausrufen: »Lass uns ihnen Saures geben!«
Denise nahm zwar das Taschentuch entgegen, benutzte es jedoch nicht. Stattdessen sagte sie mit erstickter Stimme: »Ich kann nicht mehr, Emily.«
»Was soll das heißen? Was kannst du nicht mehr?«
»Das hier.« Denise machte eine vage Geste, die alles bedeuten konnte.
»Erklär es mir, ich verstehe nämlich nur Bahnhof.«
Kurz sah es so aus, als wolle Denise ihr tatsächlich das Herz ausschütten. »Ach, vergiss es!«, stieß sie schließlich hervor. »Ist doch sowieso egal. Alles ist egal …«
Nicht ihre Worte, sondern die Art, wie sie sie sagte, erschreckte Emily. Sie begriff, dass hinter Denises Verhalten mehr steckte als nur eine ihrer üblichen Stimmungsschwankungen.
»Mir ist es nicht egal, Denise«, sagte sie leise. »Bitte sprich mit mir.« Sie griff nach ihrer Hand, wollte ihr zeigen, dass sie nicht allein war.
Denise knetete das Taschentuch in ihrer Faust, sie zitterte inzwischen am ganzen Körper. »Alles, was wir tun, ist doch sowieso für die Katz! Es wird nicht besser, es wird schlimmer! Die Leute scheren sich einen Dreck um die Welt, in der sie leben! Wir rennen permanent gegen eine Betonwand. Wozu überhaupt noch kämpfen?«
»Weil es sich immer lohnt, für eine gute Sache zu kämpfen! Kinder haften für ihre Eltern! Lass uns ihnen Saures geben!Deine Worte, Denise!«, erinnerte Emily sie. »Außerdem stimmt es nicht, wir hätten nichts erreicht.« Mithilfe ihrer Finger zählte Emily rasch einige ihrer Erfolge auf und endete mit der heutigen Aktion in der Children’s Bay. »Wir haben es doch so gut wie geschafft, dass die Robben dortbleiben können! Ist das nichts?«
»Es ist lächerlich wenig, wir sind viel zu wenige! Und es ist einfach so, dass …« Denise stockte. Das Eingeständnis fiel ihr sichtlich nicht leicht, doch sie war tapfer genug, um fortzufahren, »… dass es die ganze Kraft aus mir raussaugt. Wenn du heute Morgen nicht angerufen und mich aus dem Bett gejagt hättest, hätte ich mich unter der Decke verkrochen. Ich habe gedacht … gedacht, dass …« Denise schluckte erst und zog dann ziemlich unfein den Rotz hoch.
»Was hast du gedacht?«, fragte Emily atemlos.
»Dass es besser wäre, wenn es mich gar nicht gäbe«, stieß Denise hervor.
»Was soll das heißen, besser, es gäbe dich gar nicht? Was redest du denn da?«, fragte Emily entsetzt.
»Ach, vergiss es«, wiederholte Denise.
»Nein, das werde ich ganz sicher nicht! Sag mir, was mit dir los ist, Denise!«
»Wieso? Du hast mich doch verstanden«, schaltete Denise plötzlich auf trotzig und ließ Emilys Hand los. »Vielleicht bringe ich mich einfach um. Es gibt sowieso zu viele Menschen auf der Erde. Ohne uns wäre sie besser dran. Das wäre doch mal ein echtes Opfer für die Umwelt, oder?«
»Du hast doch ’nen Knall!«, entfuhr es Emily ehrlich.
»Nicht mehr als andere! Ich kann die dummen Menschen nicht mehr ertragen! Keine Maus der Welt würde eine Mausefalle bauen, bloß der Mensch baut Atombomben! Hoffentlich drückt bald einer auf den Knopf! Yeah!« Denise rappelte sich auf und stapfte davon, jeder Schritt ein Ausdruck ihres Zorns.
Emily folgte ihr. »Was hast du jetzt vor?«
»Ich fahr nach Hause und leg mich wieder ins Bett. Da habe ich wenigstens meine Ruhe.«
So leicht gab Emily nicht auf. »Komm schon. Fahr mit uns mit. Das wird heute groß. Sogar das Fernsehen kommt!«
»Diese Aasgeier! Die warten doch nur darauf, dass sich die Demonstranten wieder gegenseitig in die Haare kriegen, und dann stellen sie uns als subversive Schlägertruppe hin.«
»Mann, du bist heute aber wirklich mies drauf.«
»Dann sei froh, wenn du mich für heute los bist«, erwiderte Denise spitz.
Emily atmete vorsichtig auf. So gefiel ihr ihre Freundin schon besser. Angriffslust und Zynismus waren Traurigkeit und Resignation allemal vorzuziehen. »Ich komme später noch bei dir vorbei, okay? Okay?«, drängte sie Denise zu einer Antwort.
»Ja, okay.«
Sie hatten die große Scheune erreicht, vor der sich inzwischen noch mehr Leute versammelt hatten. Emily und Denise, die beiden Hauptorganisatorinnen, wurden von ihnen stürmisch begrüßt, und Emily hegte bereits die Hoffnung, dass der Eifer ihrer Mitstreiter Denise zum Bleiben bewegen könne. Doch Denise blieb stur bei ihrem Entschluss, raunte Emily ein kurzes »Wir sehen uns« zu und mogelte sich durch die Menge davon.
Emily hätte vielleicht noch einen letzten Überredungsversuch gestartet, wenn nicht im selben Moment ihre Mutter und Fritz erschienen wären und ofenwarme Brownies verteilt hätten. Alle stürzten sich sofort auf die Kuchen, und die beiden Platten waren im Nu leer gefegt. Manchmal hatte Emily den Verdacht, einige fänden nur wegen der guten Bewirtung den Weg hier raus.
Sie trollte sich zurück in die Scheune und unterzog die Spruchbänder einer letzten Prüfung, während Raffaella auf einer Kiste saß und mit einem Handspiegel ihr makelloses Gesicht nach Makeln absuchte. Kurz darauf gesellte sich Fritz zu Emily. Er hatte einen Brownie für sie gerettet. Während Emily genüsslich kaute, begutachtete Fritz die Transparente.
Emily schätzte das Urteil ihres kleinen Freundes, Fritz zeichnete sich stets durch gnadenlose Ehrlichkeit aus.
»Krass!«, sagte er nun bewundernd, »deine Robben sehen genauso lebensecht aus wie die Delfine der letzten Woche! Du solltest Malerin werden«, schlug ihr der Neunjährige nicht zum ersten Mal vor. »Die muss Maddie unbedingt sehen! Können wir sie ihr zeigen?«
»Klaro«, sagte Emily und half Fritz beim Einrollen des Banners. Die Stöcke, mit denen sie es bei der Demonstration über ihren Köpfen hochhalten konnten, waren schon daran befestigt.
Wie stets, wenn Emily, Raffaella und Denise ihre Wochenend-Aktionen organisierten und Hof und Scheune voller Menschen waren, zog sich seine jüngere Schwester in einen Schaukelstuhl auf die Veranda zurück, um das bunte Treiben aus sicherer Entfernung zu betrachten – verborgen unter Fritz’ Astronautenhelm. Damit und solange sie ihren Bruder in der Nähe wusste, konnte Maddie eine Gruppe Fremder relativ gut ertragen.
Freunde und Mitstreiter hatten sich an den Anblick des kleinen Mädchens mit dem zu großen Helm gewöhnt.
Gerade als Emily mit Fritz die Scheune verließ, fuhr ein verbeulter Van in den Hof. Ein ihr unbekannter Mann in Lederkluft sprang heraus. Auf unbestimmte Art fand Emily ihn verwegen, auch wenn der Kerl schon mindestens 30 war. Er würde sich gut in einer ihrer Graphic Novels machen. Vielleicht als Pirat? In Gedanken war sie bereits dabei, ihn zu skizzieren.
Ein zweiter Mann, mit auffallend blauschwarzen Haaren, stieg aus dem Wagen und sah sich sofort prüfend um. Wie ein Kaufinteressent, dachte Emily und entwickelte auf Anhieb eine Abneigung gegen ihn. Hinter Emily nahten schnelle Trippelschritte. Schon schoss Raffaella an ihr vorbei und hatte dabei ihr schönstes Lächeln angeknipst. Emily nannte es »Raffaellas Produzentengesicht«.
Ihre um ein Jahr ältere Freundin versuchte sich seit geraumer Zeit als Schauspielerin, hatte es aber bisher zu nicht mehr als ein paar kleineren Werbespots in regionalen Sendern gebracht. Seit der gemeinsamen Highschoolzeit erzählte sie jedem, der es hören wollte (oder auch nicht), dass sie mit achtzehn nach Los Angeles ziehen würde. Jetzt war sie zwanzig und wohnte noch immer bei ihren Eltern in La Jolla.
Raffaellas Ziel war eindeutig der Neuankömmling im schwarzen Leder, und sie wiegte sich auffällig in den Hüften. Ihr Balztanz trieb Emily ein Grinsen ins Gesicht. Was für ein Glück, dachte sie, dass sie damit so gar nichts am Hut hatte. Mit ihrem eigenen Aussehen befand sie sich außerhalb jeder Konkurrenz; kein männliches Wesen hatte sich je für Emily Harper interessiert. Unvermittelt dämmerte es ihr. Das musste der Typ sein, mit dem ihr Raffaella den gesamten Vormittag in den Ohren gelegen hatte! Der angeblich so aussehen würde wie der junge Harrison Ford im ersten Starwars-Film. Emily hatte Raffaellas Geplapper über ihre neueste fantastico Männerbekanntschaft wenig Gehör geschenkt. Raffaella verliebte sich mit der Regelmäßigkeit der Gezeiten, und ihre Schwärmereien hatten sich für Emily längst abgenutzt.
Raffaella warf sich dem Piraten in die Arme, gerade als Emily und Fritz für Maddie auf der Veranda das Banner mit den aufgemalten Robben entrollte. Maddie belohnte sie mit Lauten des Entzückens.
Nach der Begutachtung blieb Fritz bei Maddie, um ihr ein paar Worte Deutsch beizubringen. Er hatte sein Sprachwissen von Emily, die wiederum über ihren Freund Jason Deutsch gelernt hatte.
Als Emily von der Veranda stieg, hörte sie noch, wie Fritz seiner Schwester erklärte, dass Los Angeles die Engel hieß. Emily bewunderte die unerschütterliche Geduld des Jungen. Maddie hatte zwar Lesen gelernt, weigerte sich jedoch, außer Zahlen irgendetwas anderes zu schreiben, dafür konnte sie sich ausgezeichnet Dinge merken.
Kurz darauf rief Emily alle Mitstreiter, die sich hauptsächlich aus ihren Mitstudenten am San Diego College rekrutierten, im Hof zusammen und hielt vor der Abfahrt zur Children’s-Pool-Bucht ein kurzes Briefing ab – was eigentlich zu Denises Aufgaben gehörte. Nachfragen zu Denise beschied Emily mit einem knappen »sie ist erkältet«.
Die Fahrgemeinschaften fanden zusammen. Raffaella und sie würden zusammen mit Stephen fahren, aber weder ihr Bruder noch ihre Freundin waren derzeit irgendwo zu sehen. Vermutlich bemutterte Stephen noch seine Bienen, und Raffaella hing weiter am Hals des Piraten.
Emily ging in die Scheune, um die restlichen Spruchbänder einzusammeln, und traf dort auf Raffaella, die, Überraschung, ihre neueste Errungenschaft bezirzte. Raffaella zeigte ihm und dessen Begleiter gerade die Spruchbänder. »Da ist ja Emily«, rief Raffaella, als sie Emily in der Tür erblickte. »Sie hat sie gemacht.«
Emily schlenderte auf die drei zu.
»Emily«, stellte Raffaella ihre Begleitung stolz vor, »das ist Citizen Kane, der Gründer von Greenwar! Und das ist sein Freund Carlos.«
Nun war Emily doch ein klein wenig beeindruckt. Selbst sie, die Medien weitgehend mied, hatte bereits von Citizen Kane und Greenwar gehört, eine junge, lokale Organisation, die bereits national mit einigen spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hatte – im Gegensatz zu ihrer kleinen Studententruppe, die sich mit Demonstrationen, Strandsäuberungsaktionen, Plakateschwenken und Flugblätterverteilen begnügte.
Citizen Kane reichte ihr die Hand und sagte mit einem gewinnenden Lächeln: »Freut mich, Emily.« Er deutete auf die Plakate. »Die sind richtig gut! Jemanden wie dich könnten wir bei Greenwar gut gebrauchen.«
Nicht Emily, sondern Raffaella errötete bei dem Lob. »Emily gestaltet alle Flugblätter selbst und sie zeichnet superspannende Graphic Novels. Du musst dir ihre Geschichten unbedingt ansehen, C.K.! Sie sind fantastico!«, pries Raffaella ihre Freundin an, als sei sie Gegenstand eines Verkaufsgesprächs. »Emily, warum holst du nicht dein Skizzenbuch und zeigst es C.K.?«
Emilys Miene verschloss sich. »Nein. Meine Geschichten sind privat.«
»Aber mir hast du sie doch gezeigt? Deine Illustrationen sind viel zu gut, um sie zu verstecken! Komm schon, Ragazza!« Sie lächelte Citizen von der Seite an.
»Ich verstecke sie nicht, sie sind privat«, sagte Emily in einem Ton, der keinen Zweifel daran ließ, dass sich dazu jede weitere Diskussion erübrigte. Sie verstand nicht, weshalb Raffaella derart darauf beharrte.
Doch als sie Raffaellas Hollywood-Schmollmund sah, tat es ihr schon wieder leid, so schroff gewesen zu sein. Sie hatte Raffaella vor ihrem Freund nicht gut dastehen lassen, wo sie doch eine bella figura abgeben wollte.
Emily setzte zu einem versöhnlichen Grinsen an, um zu erklären, dass »privat« nur für ihre engsten Freunde galt, als Citizen sagte: »Ich verstehe dich gut, Emily. Ich zeige meine Tattoos auch nur meinen engsten Freunden. Oder meiner Freundin.« Er strich über Raffaellas Arm, sah dabei jedoch nicht Raffaella, sondern Emily an. Und dieser Blick bestätigte Emilys ersten Eindruck: Citizen Kane war ein Pirat!
* * *
Wenn Emily später an die Ereignisse jenen Tages zurückdachte, hatte sie einen Satz im Kopf: »Niemand hat ahnen können, dass die Sache derart aus dem Ruder laufen würde …« Irgendwer hatte sie danach damit trösten wollen, aber die Worte hatten sie wütend gemacht. Damals war zum ersten Mal die Kugel in ihrem Bauch erwacht. Sie wusste selbst, dass die Geschehnisse nicht ihre Schuld gewesen waren, aber das änderte nichts daran, dass man sie für alles verantwortlich machte.
Als ihr Fahrzeug am vereinbarten Sammelpunkt für ihren Marsch, einem riesigen Supermarktparkplatz in der Draper Avenue, in unmittelbarer Nähe zur La Jolla Cove, hielt, meinte ihr Bruder Stephen am Steuer erstaunt: »Das sind heute aber eine Menge Mitstreiter, Emily. Wie habt ihr es geschafft, diesmal so viele Leute zu mobilisieren?«
Emily stieg aus und sah sich ungläubig um. »Ehrlich gesagt, habe ich keinen blassen Schimmer. Wir haben nicht mehr dafür getrommelt als sonst auch.«
Auf ihre übliche Kerngruppe von ungefähr fünfzig kam mindestens die vierfache Menge Unbekannter und der Strom von Fahrzeugen riss nicht ab. Sogar ein Bus war eben im Begriff einzuparken. Wo kommen die bloß alle her? Am Rand des Supermarktgeländes entdeckte Emily zwei Übertragungswagen, ein dritter traf gerade ein. Zwei Krankenwagen schienen ebenfalls einsatzbereit, leider auch die gleiche Menge Polizeifahrzeuge. Die Officer lehnten an ihren Fahrzeugen und behielten alles im Auge. Diese geballte Aufmerksamkeit war zwar ungewohnt, aber es ließ ihre Erfolgschancen steigen!
Raffaella schien ihre Meinung nicht zu teilen. »Verflixte Denise!«, murmelte sie neben ihr. »Und jetzt ist sie nicht einmal da!«
»Wir schaffen das auch ohne sie«, antwortete Emily und öffnete die erste Schachtel mit Flugblättern, die Stephen aus dem Kofferraum geholt hatte.
»Das meinte ich nicht.« Raffaella zog Emily zur Seite. »Denise hat mir gesagt, sie wolle in einschlägigen Internetforen für unsere Aktion werben. Ich habe ihr ernsthaft davon abgeraten.«
»Warum denn? So viele Demonstranten sind doch bisher noch nie zu einer unserer Veranstaltungen gekommen!«
»Ja, aber sieh dich um, Emily!« Raffaella zeigte auf eine dunkel gekleidete Gruppe neben der Überdachung mit den Einkaufswagen. »Die tragen Rucksäcke. Und sie sind nicht die Einzigen.«
»Na ja, Rucksacktragen ist im Staat Kalifornien in der Öffentlichkeit nicht verboten.« Emily wühlte im Kofferraum.
»Mamma mia, Ragazza! Manchmal bist du einfach nur naiv. Du …« Weiter kam sie nicht, da ihre Ankunft nicht unbemerkt geblieben war. Im Nu waren sie von ihren engsten Mitstreitern umringt.
Emily und Raffaella versammelten den Rest ihrer Leute um sich, Spruchbänder und Flugblätter wurden verteilt, und irgendjemand drückte Emily ein Megafon in die Hand. Sie gab nochmals die Marschroute durch. Erste Station wäre das Haus des Bürgermeisters, da Lokalpolitiker nichts mehr fürchteten, als ihr Haus im Hintergrund einer politischen Demonstration zu sehen. Dort würden sie eine Viertelstunde lang Sprüche wie »Der Children’s Pool gehört den Robben!« skandieren und anschließend zur La Jolla Cove, zum Strand, weiterziehen.
Sie setzten sich in Bewegung, Emily mit Raffaella und Stephen in der vordersten Reihe. Zusammen mit mehreren anderen trugen sie eines von Emilys Transparenten vor sich her. Ein Kamerateam forderte sie auf, langsamer zu gehen. Es war vor ihnen aufgetaucht und filmte sie, während eine blutjunge Reporterin, kaum älter als Emily, ihr das Mikrofon vor den Mund hielt und Fragen stellte wie: »Was erwarten Sie sich von Ihrer heutigen Aktion, Miss Harper?« Und: »Hätten Sie mit diesem Andrang gerechnet?«
Vor dem Haus des Bürgermeisters erwartete sie noch mehr Presse. Und ein halbes Dutzend Polizeieinsatzfahrzeuge. Das Grundstück des Bürgermeisters war zusätzlich mit Sperrgittern abgeriegelt.
Unterwegs war die Gruppe der Teilnehmer weiter angeschwollen, und längst wurden nicht nur die verabredeten Sprüche skandiert. Rufe wie »Tod den Kapitalisten« wurden laut, begleitet von einem ohrenbetäubenden Konzert aus Trillerpfeifen und Trommeln. Die Atmosphäre heizte sich zunehmend auf.
Entsetzt bemerkte Emily, dass sich nicht wenige der Teilnehmer vermummt hatten. Mit den Sperrgittern im Rücken versuchte sie vergeblich, mit dem Megafon gegen die Verrückten anzubrüllen.
»Du solltest den Weitermarsch abblasen, bevor alles außer Kontrolle gerät«, schrie Stephen ihr ins Ohr.
»Diese Idioten hören mir doch gar nicht zu!«, brüllte Emily zurück. »Aber solange sie mich hier vorne sehen, werden sie sich zurückhalten.« Ein frommer Wunsch. Als die erste Flasche in ihre Richtung flog, wurde Emily so zornig, dass sie sich schnurstracks zu der lautesten Gruppe durchkämpfte. Sie hatte dort einen der Rädelsführer ausgemacht.
»Nehmt eure verdammten Masken ab, ihr Feiglinge, und hört mit dem Flaschenwerfen auf!« Sie entriss dem Nächststehenden seine Flasche und fuchtelte damit vor seinen Augen herum. »Das hier ist eine friedliche Demonstration!«
Aufgrund des Lärms und der Maske konnte sie seine Antwort nicht verstehen, aber sie war sich beinahe sicher, dass er sie auslachte. Gleich darauf wurde sie von ihm grob gepackt, in die Menge hineingeschoben und immer weiter durchgereicht.
Eingekeilt zwischen den Randalierern bekam Emily nichts davon mit, was vorne vor sich ging. Es wurde so laut, dass ihre Trommelfelle zu schmerzen begannen. Plötzlich roch sie Feuer! Diese Verrückten warfen Brandsätze! Emily kämpfte sich in Panik aus der Randalierergruppe. Irgendwann lichtete sich die Menge, Polizisten rückten an – und ringsum setzte eine wilde Flucht ein. Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Mülltonnen und Gummireifen brannten, Polizisten und Vermummte schlugen aufeinander ein, mit Knüppeln auf der einen Seite, Baseballschlägern, Latten und vereinzelt Eisenstangen auf der anderen. Auch Nicht-Vermummte mischten mit. Die Lage geriet völlig außer Kontrolle.
Und plötzlich stand ein Vermummter mit Eisenstange vor Emily und schrie: »Ihr verdammten Studentinnen! Was glaubt ihr, wer ihr seid?«, und holte aus. Emily konnte dem ersten Schlag gerade noch ausweichen. Doch dabei stolperte sie und stürzte.
Sie sah die Eisenstange bereits auf sich niedersausen, als sich plötzlich ein Mann von der Seite gegen den Angreifer warf. Die Stange rollte davon, und beide Männer gingen schwer zu Boden. Dann rappelte sich Emilys Angreifer auf und rannte davon.
Starke Arme griffen nach Emily und zogen sie hoch. »Geht es dir gut, Emily?«, keuchte Citizen, dem Blut von der Stirn lief.
»Ja, ich bin in Ordnung.«
»Komm, ich bringe dich von hier weg.«
Am nächsten Tag schaffte es ein Bild von Emily landesweit auf die Titelseiten. Darauf schwenkte sie inmitten einer Gruppe Vermummter eine Flasche, und die Schlagzeile lautete: Rädelsführerin Emily Harper in Aktion.