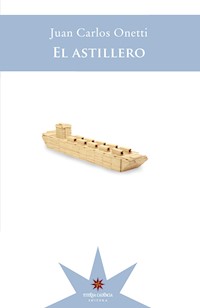12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wenn es nicht mehr wichtig ist besteht aus den Aufzeichnungen von Juan Carr, einer heillos gescheiterten Existenz. Carr kommt eines Tages nach Santa María, wo er für gute Dollars Arbeiten an einem Stauwerk beaufsichtigen soll. Er lebt in einem großen Haus am Fluss, versorgt von der Mestizin Eufrasia, zu deren Tochter Elvira er sich hingezogen fühlt. Er stößt auf Díaz Grey, der ihn zu Gesprächen und Alkohol einlädt. Der Arzt hat Angélica Inés, die labile Tochter des Werftbesitzers Jeremías Petrus, geheiratet und lebt mit einem Wissen, das ihn zu Schweigsamkeit und Bekenntnis treibt. Eine absurde Aufgabe drängt Carr in einen grell ausgeleuchteten Randbereich von Schmuggel, Lebensbeharrung und ätzender Selbstbefragung. Seine Aufzeichnungen zeigen ihn als ein ironisch verzeichnetes Alter Ego Onettis. Dieses letzte Werk Juan Carlos Onettis, ein Jahr vor seinem Tod erschienen, ist ein lakonischer, ja anarchischer Bogenschlag zu seinem atmosphärisch so ganz anderen, aber nicht minder unerschrockenem Erstling Der Schacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Ähnliche
Juan Carlos Onetti
Wenn es nicht mehr wichtig ist
Roman
Aus dem Spanischen von Rudolf Wittkopf
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel Cuando ya no importe.Nähere Angaben in der Editorischen Notiz.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5046.
© Heirs of Juan Carlos Onetti 1993
© 2023, der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung nach Entwürfen von hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-77155-6
www.suhrkamp.de
Inhalt
Wenn es nicht mehr wichtig ist
Anhang
Editorische Notiz
Anmerkungen
Literaturhinweise
Zeittafel
Für Carmen Balcells, nur um ihr Dank zu sagen.
Personen, die versuchen, in dieser Erzählung ein Motiv zu finden, werden belangt. Personen, die darin eine Moral finden wollen, werden verbannt. Personen, die in ihr eine Handlung zu entdecken versuchen, werden erschossen.
Auf Befehl des Autors
Per G. G. Der Generalstabschef
Während ich schreibe, fühle ich mich gerechtfertigt: ich denke, ich erfülle meinen Beruf als Schriftsteller, ganz abgesehen davon, was mein Schreiben taugen mag. Und sagte man mir, dass alles, was ich schreibe, in Vergessenheit geraten wird, würde ich das höchstwahrscheinlich nicht mit Freuden aufnehmen, doch voller Zufriedenheit würde ich weiter schreiben. Für wen? Für niemanden, für mich selbst.
Jorge Luis Borges
Wenn es nicht mehr wichtig ist
6. März
Vor vierzehn Tagen oder einem Monat hat meine jetzige Frau beschlossen, in einem anderen Land zu leben. Es gab weder Vorwürfe noch Klagen. Ihr Magen und ihre Vagina gehören ihr. Wie auch sollte ich sie nicht verstehen, wo wir beide fast nichts anderes als den Hunger geteilt haben.
Wir trösteten uns manchmal mit Mahlzeiten, zu denen gute Freunde uns einluden; Klatsch, Diskussionen über Sartre, den Strukturalismus und die Farce, die die Rechten weltweit anerkannt sehen wollen, für die sie ihre Anhänger gut zu bezahlen wissen und die sie Postmoderne taufen. Wir hielten mit, stritten uns und schmückten die Bonmots mit unserem Lachen. Jene Abendessen, zu denen wir keinen einzigen Peso beisteuern konnten, boten einem etwaigen Beobachter, vielleicht einem der Tischgäste, die ihren Anteil an der Rechnung zahlten, einen wunderbaren Anblick. Denn Bewunderung verdiente die List, mit der sie und ich, weiter unbekümmert lachend, uns Stückchen Brot stibitzten, die in ihrer Handtasche oder in einer meiner Jackentaschen verschwanden. Auf diese Weise sicherten wir uns ein karges Frühstück für den nächsten Morgen, wenn wir im Bett der Pension aufwachen würden.
Die fast elenden Tage mehrten sich, und es obsiegte bei ihr die Überzeugung, dass ich als heillos gescheiterte Existenz geboren war.
Das Mädchen verbrachte die ganze Zeit im Bett, um Kräfte zu sparen, keine Kalorien zu vergeuden. Womöglich war es Winter. Ich glaube ja, bin aber nicht ganz sicher. Also: sie im Bett und ich unterwegs, die Avenida immer rauf und runter, in der Hoffnung, einem besonders freundlichen Menschen zu begegnen, den um Geld zu bitten ich mich nicht demütigen müsste. Ich erinnere mich, dass es nicht mehr darum ging, nur einen Peso zu kriegen, damit wir zu essen hätten. Nie habe ich in den Zeitungen nachgeschaut, wie hoch gerade die Lebenshaltungskosten waren. Doch in jenen Tagen war das absolute Minimum auf fünf Pesos angestiegen.
Selten habe ich soviel zusammengekriegt, nicht weil man mich einfach stehenließ, sondern weil man einander verfehlte. Bei meinen Streifzügen in der Stadt nahm ich nur die Kinder aus. Nie habe ich Unterschiede beim Geschlecht gemacht. Wenige Frauen habe ich getroffen.
25. März
Ich erinnere mich, dass meine Frau, die jetzt nicht mehr da ist, mir wieder und wieder gesagt hatte: Ich weiß, dass ich dir Unglück bringe. Was sich aus ihrer Abwesenheit ergab, wird man nicht schon als Veränderung meines Loses bezeichnen können, doch plötzlich hatte ich neben meinen vielen Beschäftigungen andere, die sich in Esswaren umsetzten. Einem der Freunde aus den Restaurants, wo wir die schönen goldkrustigen Stückchen Brot stibitzt hatten, die am nächsten Morgen geknuspert werden sollten, einem meiner blasierten Gastgeber mit mancherlei Beziehungen zu irgendeiner Politbagage, gelang es schließlich, mir eine Arbeit zu verschaffen. Das unbedingt Notwendige, um den Pensionswirt zu erfreuen und mein Essen zu bezahlen.
Gleich nach der guten Nachricht bemühte er sich redlich, meine Erwartungen zu dämpfen, und wand sich bei dem Versuch, mir zu erklären, worin meine soeben erlangte Arbeit bestand. Ich sagte ihm, dass es mir egal wäre, und sollte es die Portiersstelle in einem Bordell auf dem Lande sein, denn für mich gab es kein hartes Brot.
27. März
Auch erinnere ich mich, dass zu jener Zeit die Leute von Monte aus ihrer Stadt flohen, über den Fluss setzten und in die Großstadt kamen, die dann zur Hauptstadt der dritten Welt wurde, strotzend von Kartons und verrostetem Blech, woraus das bestand, was sie Häuser nannten, in Hunderten von krebsartig wuchernden Elendsvierteln, die jeden Tag näher rückten und den großen phallischen Stolz des Obelisken umdrängten. Vielleicht hatte der Hunger dort einen anderen Geschmack als in Monte. Immerhin waren diejenigen in Monte noch nicht so zahlreich, die Ambitionen hatten und es schafften, über den Fluss zu setzen, um – ein unverzichtbares Schicksal – an einer Ecke der Hauptstraße Rasierklingen und Kaugummi, Kleenex und Seifenstückchen, ausgetrocknete Kugelschreiber, Kämme und Streichholzheftchen zu verkaufen. Der Ertrag eines Tages würde bedeuten, eine Chorizo mit Brot zu kauen, falls ebenso verzweifelte Eingeborene sie nicht verjagten.
Ich kann die aus Monte nicht vergessen, die von einer anderen Art zu leben träumten, die aufs Ganze gingen, die sich nicht scheuten, den Selbstmord als Wette dafür einzusetzen, wirklich in jenen europäischen Ländern zu leben, aus denen die Vorfahren kamen, aus Spanien und Italien, bevor sie sich vermischten und so die autochthone Rasse schufen.
Und jetzt, fünfhundert Jahre nachdem sie versehentlich von einem Genueser Seefahrer entdeckt wurden, dank auch der Intuition einer Königin, die nie ihren Schmuck aufs Spiel setzte noch ihr Hemd wechselte, versuchten die Nachkommen verzweifelt, ihren Vorfahren einen Gegenbesuch abzustatten.
Sollten sie ruhig mit dem Morgengrauen vor Botschaften oder Konsulaten kilometerlange Schlangen bilden und mit kärglicher Hoffnung auf das Wunder eines Visums warten. Auf dem Flughafen konnte ich zwei einander widersprechen de Graffiti lesen: »Der letzte, der geht, mache das Licht aus.« Und das andere bat flehentlich: »Geh nicht fort, Bruder.«
28. März
Dennoch glaubte ich am Anfang, dass man mir einen üblen Streich gespielt hatte. Es handelte sich um ein riesiges Gebäude, das sie Schuppen, Halle oder Hangar nannten. Ich hörte den Männern zu. Es wimmelte von Arbeitern mit nacktem Oberkörper und Shorts oder Schurzen aus Sackleinen. Zum größten Teil waren es große, kräftige Galicier, die sechzig Kilo schwere Säcke Getreide buckelten, als wäre es ein Kinderspiel. Und das acht Stunden täglich, falls es nicht noch zusätzliche Arbeit gab. In großen schwarzen Lettern stand an der hinteren Wand die Abkürzung S. O. S.
Zuerst musterte mich ein Halbkreis spöttischer Blicke, die, wie mir schien, meine Fähigkeiten in einem Kampf mit immer weiteren sechzig Kilo einschätzten. Keiner sagte etwas. Ich war der Fremde, und sie verpflichteten sich, mich zu hassen, waren entschlossen, mich aus ihrem Gebiet auszustoßen.
Ich war schon drauf und dran, danke und Tschüss zu sagen, als mir ein Eingeborener in einem Kittel, der tags zuvor vielleicht weiß gewesen war, Trost brachte. Er zeigte auf einen Haufen Säcke, die mir als Sitz mit Rückenlehne dienen konnten, dann auf ein rundes Loch am Boden und händigte mir ein kleines Messer aus. Dieser Mann wurde mit wenigen Worten mein Vorarbeiter.
So erfuhr ich, dass das runde Loch Mühltrichter hieß, dass der mit Weizen oder dem, was die Säcke enthielten, gefüttert werden musste und dass dieser Apparat, der Spreu von den Körnern schied, kaputtgehen würde, sollte er nicht nachgefüllt werden. Auch erfuhr ich, dass man diese Arbeit eigens für mich erfunden zu haben schien. Ich erinnere mich an viele Wochen nächtlichen Glücks. Eine Arbeit ohne den unvermeidlichen Druck eines Chefs oder Vorgesetzten. Während ich einen Krimi las, in einer Zeitung oder Zeitschrift blätterte, beobachtete ich aus dem Augenwinkel den gierigen, gefräßig schluckenden Schlund des Mühltrichters. Und ich war ganz allein und friedvoll in der ewigen Nacht, die stets von elektrischem Licht erhellt war, da das riesige Gebäude keine Fenster hatte und die Tatsache gleichgültig war und ignoriert wurde, dass es draußen in der Stadt regnete oder eine gleißende Sonne wütete. Auch Wärme oder Kälte gab es dort nicht. Viele dicke und flinke Ratten, bei denen man nicht wusste, woher sie angeschossen kamen oder wohin sie wollten. Bloßes Geflitze, denn ein schmutzfarbenes Hündchen jagte sie und brachte es fertig, sie mit den Zähnen zu packen und ihnen das Genick zu brechen. Nie habe ich gesehen, dass es ihm misslang. Und nach dem Erfolg kam er immer verzweifelt angelaufen, um aus einem großen Becken Wasser zu trinken oder sich den Ekel aus der Schnauze zu spülen.
Ich habe geschrieben: glückliche Nächte, aber es wäre richtiger, sie Nächte des Friedens zu nennen. Denn wenn ich dieses oder jenes Problem wälzte, handelte es sich nie um Probleme, die mir die Außenwelt bereitet hätte. Es waren meine Probleme, ganz und gar. Sie gehörten dieser besonderen Art von Problemen an, mit denen sich Millionen von Menschen herumgeschlagen haben, ohne sie zu lösen. Ich denke sie mir mit Vorliebe neben dem Feuer aus oder, wie damals, neben dem Mühltrichter. Alles war stille Nacht, heitere Nacht, bis ich eines Mittags die Anzeige in der Zeitung sah, die ein anderer Pensionsgast auf den benutzten Tellern des Mittagessens liegengelassen hatte. Selten lese ich Zeitung, ich brauche nur einen Blick auf die Schlagzeilen zu werfen, um mich in meiner alten Überzeugung bestärkt zu sehen, dass die menschliche Dummheit nicht ausstirbt.
Die einzige glaubhafte Hoffnung, die man uns lässt, ist die atomare.
Die Anzeige unterschied sich in allem von den anderen auf der Seite. Sie bot einem Mann eine Stelle, »dessen Ehrgeiz keine Grenzen kennt und der bereit ist zu reisen«. Mein Alter passte sehr gut zwischen das Mindest- und Höchstalter, wie es als unerlässlich angegeben war. Nie werde ich die Telefonnummer vergessen, die ich mehrere Tage lang vergebens anrief, wozu ich die freien Stunden nutzte, die mir der Mühltrichter gewährte. Manchmal war das Telefon besetzt, und der Ton war der der Ewigkeit, oder ich stellte mir das vergebliche Klingeln in einem alten, menschenleeren Büro vor.
Wenn dringend ein Schiff beladen werden musste, arbeitete S.O.S. auch am Samstagnachmittag. Doch zum Unglück für dieses Land geschah das nicht oft, so dass ich fast jeden Samstagnachmittag frei hatte. Und ich nutzte die Zeit, um eine Antwort zu erwirken. Vielleicht hatte diese Nummer auf ihrer Jagd nach einem ehrgeizigen Mann, der zu reisen gewillt ist, schon Erfolg gehabt. Doch eines Mittwochs im August, der mit seiner Kälte und seinem Regen sehr widerwärtig war, verwandelte sich die Telefonnummer in eine Stimme.
7. April
Ich versuche mich zu erinnern, wie jene Stimme klang, als ich sie das erste Mal hörte. Adjektive: sanft, feucht, einschmeichelnd, eben die Stimme, die man haben muss, um ohne Schärfe an dem Angebot von irgend etwas Obszönem und leicht Gefährlichem festzuhalten.
Es war dieselbe Stimme, die mir beim Vorstellungsgespräch wiederholte: Sie müssen es wortwörtlich nehmen, dass die Letzten die Ersten sein werden.
Sie begleitete den Satz mit einem eher liebenswürdigen denn spöttischen kurzen Lachen. Das Büro befand sich in einem baufälligen Gebäude der Altstadt. Die Fassade war fast ganz bedeckt mit Schildern aus verschiedenem Material, die alle möglichen Berufe, Zauberer oder Fußpfleger, anboten. Das Büro war eine staubige Tristesse. Tisch aus Pinienholz, zwei ungleiche Stühle, Telefon und grüner metallener Karteikasten.
Und jetzt der Inserent, der in dieses Ambiente nicht passen wollte, der auf mich den seltsamen Eindruck eines Menschen machte, der zu nichts passte. Nur das Gesicht, das passte zu der Stimme. Es war ganz weiß, sehr groß im Verhältnis zu dem fast kindlichen, zu elegant gekleideten Körper. Eine Krawattennadel mit einem Diamanten, aber kein Ring an den manikürten Fingern. Wenn er lächelte, wobei er ein kräftiges Pferdegebiss zeigte, stülpten sich die Lippen nach vorn und bildeten einen vollkommenen Kreis.
»Und wie weit, glauben Sie, könnte Ihr Ehrgeiz gehen?«
»Das kommt darauf an. Sie werden mir ja wohl nicht das Angebot machen, Schwarze oder irgendwelche Sklaven auszunutzen.«
»Ich muss Ihnen leider sagen, dass die Palette meines Angebots sehr klein ist. Ich verfüge nicht über diese Art Schändlichkeiten. Ihrem Ehrgeiz gemäß kann ich Ihnen folgenden Posten verschaffen: in ein fremdes Land gehen, nichts tun und viel Geld verdienen. Nichts tun, aber dafür sorgen, dass etwas getan wird. Und auch informieren.«
10. April
Ich machte bei der ominösen S. O. S. Schluss, indem ich Krankheit vorschob, und hatte drei weitere Besprechungen mit dem Mann, der sich Professor Paley nennen ließ, »obgleich das weder mein Name noch mein Titel ist. Auch für Sie habe ich einen anderen Namen und Beruf.«
Bei der zweiten oder der letzten Zusammenkunft tauchte das Wort Bestimmungsort auf. Der Professor fragte, ob mir der Name Santamaría bekannt sei. Ich sagte, ganz Süd- und Mittelamerika seien mit Städten oder Dörfern dieses Namens übersät.
»Ja, ich weiß. Aber unser Santamaría ist etwas anderes.«
So beginne ich also, mehr oder weniger getreu, die Geschichte meines Abschieds von Monte aufzuzeichnen. Ich erinnere mich, dass ich damals den Leitspruch der New York Times stahl und mir schwor, alles aufzuschreiben, was wert wäre, aufgeschrieben zu werden.
12. April
Es fällt mir leicht, diese Aufzeichnungen zu beginnen, doch weiß ich nicht, ob ich das mir selbst gegebene Versprechen werde halten können, tagtäglich Aufzeichnungen zu machen. Denn noch weiß ich nicht, wohin ich komme und wozu man mich braucht. Meine Situation in Monte ist ausgesprochen schlecht und grenzt an Angst, die mich aber nicht überwältigen soll, denn immer hilft mir die Erinnerung an einen Freund aus alten Tagen namens Kirilow oder so ähnlich. Ich habe gehört, dass man ihn aus seiner Partei ausgeschlossen hat.
28. April
Als ich Monte mit einem sträflich hervorragenden Curriculum vitae und einem frischen Ingenieurstitel in der Tasche verließ, war Professor Paley an meiner Seite und verabschiedete sich von mir erst in Santamaría. Er hatte nicht viele Worte machen müssen, um mich davon zu überzeugen, dass es im Land meiner Geburt keine Arbeit für mich gab. Ohne mich zu drängen, ließ er mich einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der mir ein Gehalt in guten Dollars verhieß. Mit vagen Erklärungen deutete er an, dass es nicht darum gehe, eine Talsperre oder ein Stauwehr zu bauen, sondern lediglich zu zementieren, was schon getan war. Da mir nach vielen Enttäuschungen verschiedener Art alles egal war, unterschrieb ich, was Paley wollte.
Anfangs, nach meiner Flucht aus Monte, nichts als Traurigkeit und Gefahr. Als ich dann den schlammigen und schläfrigen Fluss überquert hatte und noch einen anderen, schmaleren Fluss hinaufgefahren war, der traditionell Bedrohung und Selbstmord bedeutete, landete ich in einem sanmarianer Tagesanbruch.
Doch mein offizieller Besuch in Santamaría, den letzten und wichtigsten Teil meiner künftigen Aufgabe betreffend, erfolgte Tage später, als Paley, portugiesischer Jude und von meinen neuen Vorgesetzten der einzige, den ich kannte, mich in seinem schwedischen Wagen zum Fluss fuhr.
Lange betrachtete ich mir den landschaftlichen Aspekt meiner Zukunft. Links ein riesiger Wohnwagen an einem grauen Auto angekuppelt; gegenüber ein großes, schmutziges Haus, von dem Putz abbröckelte, und dann, über der Biegung des Flusslaufs, auf noch mehr unbekanntes Land von Santamaría Nueva hinweisend, eine Brücke aus Bohlen mit Seilen als Geländer. Zur Rechten Bäume, Wälder, Dschungel.
Ich denke, dass jeder Leser sich anhand dieser Beschreibung eine Karte von jener Gegend Santamarías zeichnen kann. Doch nicht einmal ich wusste, dass ich mich ganz allmählich, rhythmisiert vom monotonen Dahintröpfeln der Tage und vom Geraschel der Blätter Papier, der schmerzlichsten und vulgärsten Seite meines Unglücks näherte.
Dort war ich und sah mich um. Mit dem eingelösten Versprechen vieler Dollars, der Aussicht auf eine interessante und geisttötende Arbeit, in Erwartung einer langen, wenn auch nicht totalen Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob es sehr viel später war, dass ich an den Leuchtturm im Río Negro denken musste, den ich nie bewohnen sollte.
Parenthese: Es war in Monte, wo ich von der freien Stelle eines Leuchtturmwärters im Río Negro erfuhr, diesem Fluss, der das Land fast genau in der Mitte teilt. Irgendein vaterlandsloser Zyniker hat mir einmal gesagt, der nördliche Teil sei für Brasilien bestimmt und der südliche für die Argentinier. Ich war allein und sehr arm und hatte nicht übel Lust, allem zu entfliehen. Dank familiärer Beziehungen sollte der Leuchtturm auf den Papieren der Bürokratie schließlich mir gehören. Doch als ich erfuhr, dass ich in meiner ersehnten Einsamkeit nur einmal alle sechs Monate von einer Barkasse gestört werden würde, die Konservendosen, deren Verfallsdaten abgelaufen waren, sowie alte Zeitungen brächte, machte ich einen Rückzieher, von einer Angst gepackt, die stärker war als die vor der Feuchtigkeit des nie benutzten Leuchtturms.
Vergessen sei also der Río Negro und sein hoher, zwinkernder Leuchtturm, der den Schiffern weiterhin den Kurs weisen wird. Wahrscheinlich hat man ihn privatisiert, und die Gebühren kassieren jetzt irgendwelche Nordländer.
Nun betrachte ich einen anderen Fluss, den ich für sanft halte. Dieses seltsame Szenarium sei kurz beschrieben; wie alle verlangt es Persönlichkeiten, Personen, Bewohner, die schon wenig später auftauchten und mir von dem angeblichen Portugiesen vorgestellt wurden.
Es war, als hätte er mit den Fingern geschnippt. Zuerst erschienen Tom, Dick und Harry in hohen Gummistiefeln und mit breitem einfältigem Lächeln, da oben in Oklahoma City oder Main Street oder Texas von Kindheit an gelernt. Ich fand sie sympathisch und grausam. Wir begrüßten uns: sie in verkrüppeltem Spanisch und ich in stotterndem Englisch. Mit großer Herzlichkeit gaben sie mir zu verstehen, dass das Stauwerk praktisch fertig sei und ich lediglich dazu taugen konnte, bei etwas Unbestimmtem, das sie nicht Verstrebungsarbeiten nannten, unnötige Ratschläge zu geben. Auch erfuhr ich von ihnen, dass es jenseits der ängstlichen kleinen Brücke, weiter gen Osten, eine prosperierende Schweizerkolonie gebe, von der mir in einer entfliehenden Vergangenheit jemand mal erzählt hatte. Bei der bloßen Erwähnung der Kolonie wurden Tom, Dick und Harry gleich jünger, erröteten leicht, lachten und schlugen einander auf die breiten Schultern, gekräftigt auf den Sportplätzen der Universitäten, die jetzt so fern waren wie ihre erste Jugend.
Als sie sich wieder eingekriegt hatten, ergriff einer von ihnen, ich glaube, es war Dick, das Wort. Er erklärte mir, dass die Schweizerkolonie heute keineswegs mehr eine Kolonie sei, sondern eine mächtige Stadt, der Zukunft zugewandt, ständig expandierend und ich weiß nicht mehr, was noch für Schönheiten und dummes Zeug. Ja, es war Dick, der die Lobeshymnen anstimmte. Es war ein Chor, und aufgrund unbewusster Gehirntätigkeit musste ich an den Titel denken, den ein mir sehr lieber Freund einem pornographischen Buch zu geben versprochen hatte, das er nie zustande brachte: Die Einmütigkeit der Mösen. Hat nichts damit zu tun, aber er fiel mir nun mal ein.
1. Mai
Und hier befand ich mich an einem Ort, der nur für besessene Geographen existiert, genannt Santamaría Este, wo ich mir die Vergangenheit abschüttelte, so wie eine überaus geliebte Hündin, die ich einmal hatte, ihre Flöhe loszuwerden versuchte, und mich mit meinem falschen Ingenieurstitel die Arbeit von etwa zwanzig ausgebeuteten Mestizen zu beaufsichtigen bemühte. Wir waren dabei, den Bau eines Stauwerks zu beenden, wo das Land den Fluss zu einer Biegung zwang.
3. Mai
Es war die Stunde des Hungers, der Sonne direkt über unseren Köpfen. Wir befanden uns in dem Gebäude, das mir als Wohnhaus zugewiesen war, gebaut aus großen, kalten Steinen. Jemand war zum Wohnwagen gegangen und kam nun zurück mit einer Flasche Whisky einer mir unbekannten Marke sowie einigen Plastikbechern. Einer der Gringos sagte mir:
»Jetzt müssen Sie noch Doña Eufrasia kennenlernen. Um gut mit ihr auszukommen, muss man die Form wahren. Sie werden sehen. Sie hat immer noch einen schönen Körper. Niemand weiß, ob sie dreißig oder vierzig ist. Zu drei Vierteln ist sie India und sehr herrschsüchtig, wenn man das zulässt. Mit uns verkehrt sie in einer Art geharnischtem Frieden. Sie ist nach Este gegangen, um uns frische Lebensmittel zu besorgen. Sie hasst Konserven mehr als wir. Auf sie ist immer Verlass, muss gleich zurücksein.«
Und da kam Doña Eufrasia auch schon; ein Körper, den ich begehrenswert fand, obgleich mit großen Hängebrüsten. Aber das Gesicht hatte sehr gelitten, es war besser, es nicht anzusehen; womöglich war sie einem dankbar dafür.
Da war sie, dunkelhäutig, schweißbedeckt und mit zerzaustem Haar, ein Tier mit einem Rucksack aus speckig glänzendem Leder, der meinen Freunden gehörte, und in jeder Hand ein Netz voller Esswaren. Sie grüßte mit einem Kopfrucken, während meine Gringos mich ihr in einem wirren Durcheinander vorstellten. Sie setzte ihre Lasten ab und zeigte mir blitzartig ihr weißes Gebiss, das im langsamen, genüsslichen Kauen des Kokablattes kurz innehielt. Wir drückten uns die Hände, und ich drückte ein Stück trockenes Holz, und ihre schwarzen Augen wie auch die meinen blickten verschleiert und spöttisch.
Aber ich wusste sofort, dass da noch etwas war. Ich hörte drei Befehlsworte: Grüß den Señor. Da schlüpfte aus der Obhut des langen weiten Rocks die verschüchterte Gestalt eines kleinen blonden Mädchens in einem kurzen Schottenröckchen und einer sauberen weißen Bluse, das einen mit großen hellen und gleichmütigen Augen ruhig musterte. Die Mutter insistierte:
»Elvirita, grüß.«
Und da sagte das Mädchen salü, wobei es eine Hand bewegte und seine klaren, unschuldigen Augen hob.
Erst viel später gestand ich mir ein, dass ich der Unschuldige gewesen war.
Die Frau sagte:
»Ein reizendes Kind, alle sagen das, und deshalb verwöhne ich es auch. Ich habe noch eins, heißt Josefina und ist dunkelhäutig wie der Vater. Ich weiß von ihr nur wenig. Man hat mir gesagt, dass sie bei einem Arzt wohnt, einem richtigen Arzt.«
Es genügte, Frau Eufrasias Hautfarbe zu sehen, um sich zu sagen, dass sie keiner finsteren Hilfe bedurfte, eine dunkelhäutige Tochter zu bekommen.
Es vergingen Monate mit eintönig sich wiederholenden Tagen. Immer am Wasser, um dessen Druck zu kontrollieren und die Mestizen zu beaufsichtigen, die für das Elend, das sie in ihren Hütten im Regenwald erwartete, ein wenig entschädigt wurden durch die Pfundmünzen, die meine Gringofreunde ihnen turnusmäßig alle vierzehn Tage in die Lohntüten steckten.
15. Mai
Das Wohnhaus viel zu groß und ganz weiß gestrichen, im Widerstreit mit der mörderischen Sonne, unbrauchbar in den Nächten, wenn die Hitze, reglos und resolut, auf uns, dem weißen Haus, der Welt, in der wir lebten, lastete. Blieben uns die erstarrten Welten der Erinnerung, aber sie waren uns keine Hilfe, man glaubte nicht mehr an sie. Und dann fing die Frotzelei an, denn Doña Eufrasia, unübertrefflich im Zubereiten des Locro-Eintopfes, in der Kunst, Fleischzubraten, wobei sie immer wusste, wer es durchgebraten oder noch blutig mochte, begann langsam dick zu werden.
Wir waren vier: Tom, Dick, Harry und ich. Und die Hitze zwang uns, uns Lippen und Mund an Ajísoßen zu verbrennen. Auf diese Weise schwitzten wir mehr.
Eufrasia kochte, machte aus dem Haus ein Prunkstück übertriebener Sauberkeit, Eufrasia war glücklich und brauchte kein Lächeln, Eufrasia wurde immer dicker, Millimeter um Millimeter.
Jeden Sonntag machte sich Eufrasia frühmorgens auf den Weg zur Kirche in Santamaría. Der Bau erinnerte an die spanische Kolonialzeit, und seine vier Ecken wurden regelmäßig rosa nachgestrichen. Sie hatte im Haus kaum etwas Essbares dagelassen, und wir mussten darum würfeln, wer für Lebensmittel und Getränke ins Städtchen gehen sollte. Und immer gingen wir zu zweit, um das träge Vergnügen auszukosten, uns an die Theke des Chamamé zu lehnen und einen Aperitif oder auch mehrere zu schlürfen. Man wusste nicht recht warum, aber die Sonntagmittage vergingen in Schweigen und ohne Groll, jeder vor seinem Glas, jeder das Regal voller Flaschen anstarrend, ohne es zu sehen, die feuchten Flecken auf der blinden Scheibe des Spiegels, der einstmals Feste, Paare, Schweizer mit rotem, sonnenverbranntem Gesicht widergespiegelt hatte.
Manchmal auch wurde unser Duo sentimental, und es kam zu einer Art unerwünschtem Wettstreit mit Erinnerungen an Orte, Berge, Seen, Farmhäuser oder Städte aus Beton, Glas und Aluminium. Obendrein zeigte man sich Fotos von albern lächelnden Frauen und sommersprossigen Kindern; alles Kontur gewinnend im Dunst von Anekdoten, die wir für entscheidend und der Zeit verhaftet gehalten hatten.
Wir mussten zur Stunde der Siesta zurück sein. Nach der Reinigung von ihren Sünden im Beichtstuhl war Eufrasia, ohne zu ermüden, zur nördlichen Hüttensiedlung getrippelt, wo sie Familie hatte oder wo in der Einsamkeit und der Hitze vielleicht ein Mann auf sie wartete. Jetzt wurde Eufrasia Zentimeter um Zentimeter dicker.
Die Gringos erzählten mir, dass sie bei ihrer Untersuchung des Flussbetts, um den Standort des Stauwerks zu bestimmen, Berichte alter Eingeborener gehört hatten, die sich an ein starkes Anschwellen des Wassers erinnerten oder zu erinnern vorgaben, das das Tal überschwemmte und immer höher stieg, bis es die kleinen Hügel bedeckte und halb zerfallene Häuser, Tiere und alles, was lebte, mit sich riss. (Jedenfalls erinnerten sie sich an viele tote Großeltern, von der mächtigen Flut bis ins Meer fortgeschwemmt, und nie mehr hatte man von denen gehört.) Eines Tages, als die Tauchgänge zwecks Berechnung der Wassertiefe und Konsistenz des Schlamms für die Gringos schon Erinnerung waren, ganz am Anfang der Bauarbeiten, formte sich Eufrasias zunehmender Leibesumfang zu einem Spitzbauch aus.
Synthetisch vorgehend, in dem Versuch, ihr tiefes Verständnis für jenen Landstr ich zum Ausdruck zu bringen, dem sie die Art von Kultur und die unerschütterlichen Methoden des Gewinns und der Ausbeutung gebracht hatten, die dort oben in der Devise ihres einzigen Banners Ingold we trust proklamiert werden, wurde gespöttelt:
»Wir kennen die Mutter des Lamms.«
»Man kann sich denken, wer der Vater des Geschöpfes ist.«
Und die drei rosigen, sommersprossigen Gesichter, die sie behalten würden auch noch in der Stunde der Heimkehr, des Schulterklopfens als Zeichen der Freundschaft, auf den von ihren jeweiligen Ehefrauen arrangierten oder überwachten Cocktailpartys, diese Gesichter wiederholten über das unzähmbare Bäuchlein abgedroschene Witze:
»An dem Sonntag haben wir euch beide allein gelassen, und ich habe gesehen, wie deine Augen glänzten.«
»Man muss gesehen haben, wie sie dich bevorzugt, wenn sie das Essen austeilt.«
»Sie tut, als sähe sie dich nicht.«
»Wenn zwei sich lieben, das riecht man.«
»Es muss gleich nach unserer Ankunft passiert sein. Denn es dürfte sich nur noch um wenige Tage, vielleicht nur um Stunden handeln.«
»Wenn’s da ist, werden wir ja sehen, wem es ähnelt.«
Eufrasia, gleichmütig, so unbekümmert um ihren Bauch wie um den Augenblick, da die Wehen einsetzen würden, hielt das Haus sauber, beköstigte uns mit Linsen, Gemüse und einmal die Woche mit etwas Fleisch. Und sie trippelte, ohne einen Sonntag auszulassen, zur Kirche und zu der Hüttensiedlung im Norden. An jenem Tag hatte sie uns wie immer Teigtaschen mit Quittengelee hingestellt. Fortwährend betete sie die Vaterunser und Ave Marias herunter, die der Priester ihr verordnet hatte. Und bei jedem mehr oder weniger kurzen Schritt vergrößerte sich ihr Glück und schwitzte sie mehr; sie fühlte sich rein, gesegnet, geweiht, bereit, zur ewigen Glückseligkeit des Himmels aufzusteigen.
Wir vier Männer aber hatten keine Kirche; außerdem mussten wir uns an die langweiligen, immer zweifelhaften siebzehn Konservendosen halten. Wir hatten weder eine Kirche noch einen Kerosin-Kühlschrank. Denn Tom war Baptist, Dick Methodist, Harry Jude, und ich hatte meinen vagen Papistenglauben schon lange verloren.
In jenem fast leeren Haus untergebracht zu sein war nicht unsere Schuld, es war Gottes Wille. Wenn Angst in ihnen aufstieg, wenn sie Gewissensbisse bekamen, dann vertrieben sie diese mit dem nächtlichen Gebet und der Lektüre der Bibel. Es war anzunehmen, dass sie nicht übereinstimmten in der Deutung von Bibelsprüchen, gewundenen Phrasen, hartnäckigen Wiederholungen von Ungeheuerlichkeiten und von derart schrecklichen Drohungen, dass diese sie von dem Papier, worauf sie gedruckt waren, dröhnend anzuspringen schienen.
20. Mai
Doña Eufrasias Fußwanderungen mit dem an ihrem Arm dahinzuckelnden blonden Mädchen nach Santamaría Este, in Wirklichkeit eine Schweizerkolonie, ließen letztlich auf andere Motive schließen als den Besuch bei den Paten. Bei jeder Rückkehr betrachteten Tom, Dick und Harry unauffällig ihren schwellenden Leib und wetteten, wie viele Monate noch fehlten, und sogar, welchen Geschlechts das Ungeborene sei. Nie habe ich mich an dem Spiel dieser Prophezeiungen beteiligen wollen, die sie vor der Frau geheimzuhalten suchten. Doch einmal hörte ich Eufrasia mit ganz ruhiger und sanfter Stimme zu ich weiß nicht wem von ihnen sagen:
»Sicher hat Ihre Frau Mutter dasselbe getan.«
Niemand antwortete, und wir alle taten, als wären wir ganz von irgendwelchen Nichtigkeiten in Anspruch genommen, um die Erinnerung an die nie erlebte Tatsache zu verscheuchen: Mutter in der Horizontalen, mit gespreizten Beinen und flehend, Vater völlig weg, wütig am Schweiß ihrer Brust klebend, sich des lächerlichen Auf und Ab seiner kargen männlichen Hinterbacken nicht bewusst.
4. Juni
Für uns, die wir unter den Bäumen dösten, kam es überraschend. Es war ein schwüler Nachmittag, und wir konnten dort oben schwarze Wölkchen ausmachen, die sich langsam versammelten und schließlich eine geschlossene Decke bildeten. Doña Eufrasia, die im großen Trog Wäsche wusch oder Teller spülte, muss es mit einem Schmerz, einem Schrei, einem schmutzigen Wort gekommen sein. Mit überaus vorsichtigen kleinen Schritten erreichte sie die Tür und verschwand schließlich im kühlen Halbdunkel des Hauses.
Ich war der erste, der von dem Schrecken wach wurde. Im Zickzack lief ich unter das Fenster von Eufrasias Zimmer, kauerte mich mit dem Rücken zur Wand hin und horchte.
Wie immer konnte ich mir Eufrasia nicht weinend vorstellen, was ich hörte, war kein Weinen, sondern leises Winseln junger blinder Hunde. Während die Burschen, in ihrer Siesta durch mein wildes Rennen zum Wohnhaus aufgeschreckt, sich näherten, wurde das Wimmern immer stärker. Es wuchs sich aus zu einem Schreien; in den Pausen zu einem Gestammel, zur Anrufung der Allerheiligsten Jungfrau Maria und der heiligen Carolina, Märtyrerin und ebenfalls Jungfrau, Schutzpatronin der Gebärenden. Das Kreißen wurde immer lauter, und ich wusste, dass sie sich vor Schmerzen wälzte, hörte, wie sie Gebete mit Flüchen würzte, denen zufolge alle Männer der Welt vor tausend Schlechtigkeiten stinken, und gelobte, uns als Latrinen zu benutzen, wir alle seien Söhne ausgemachter Hurenmütter.
Und da waren wir, vier Männer, machtlos, hörten den Schmerz, waren auch beschämt, denn wir spürten, dass hinter den Wänden ein Mysterium seinen Anfang nahm, das erste des Lebens, das, mit Blut und Kot befleckt, Gestalt annehmen würde, um sich, vielleicht in vielen Jahren, einem anderen Mysterium, dem letzten, zu nähern. Und wir waren nur Männer, und unser armseliger Beitrag war nur ein kurzer und riesiger Augenblick des Glücks gewesen, längst vergessen, in der Zeit verlorengegangen.
Von draußen hörte man, wie Eufrasias Jammern und Klagen mal lauter, mal leiser wurde, denn sicher biss die Frau in irgendeinen schmutzigen Lappen, um Schmerzen und Schreie zu unterdrücken. Manchmal auch hielt sie inne, um näselnd zu beten, und man konnte ihr Klagen verstehen.
»Ach, heilige Carolina, wie leicht war es, hereinzukommen, und wie schwer ist es, herauszukommen.«