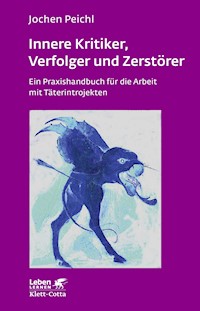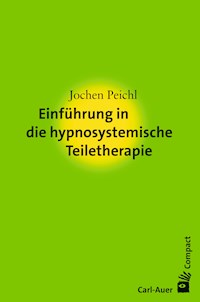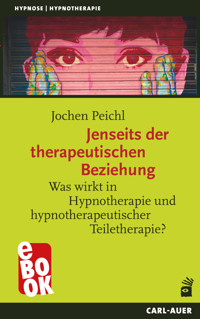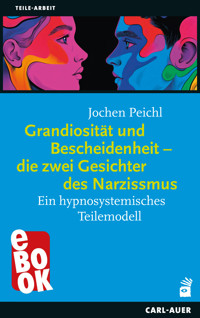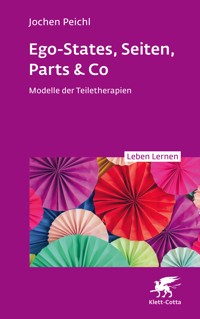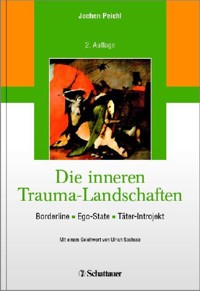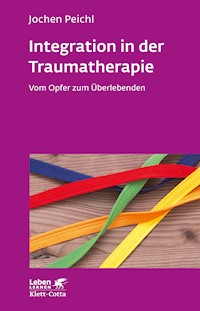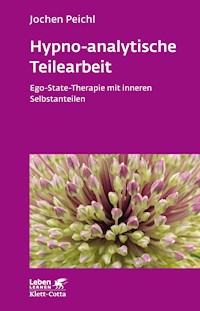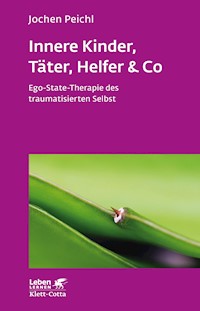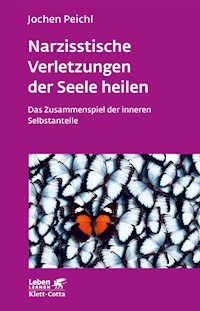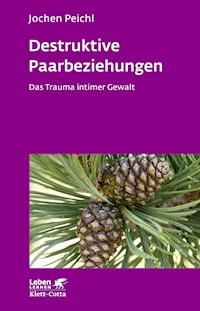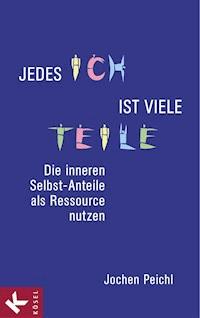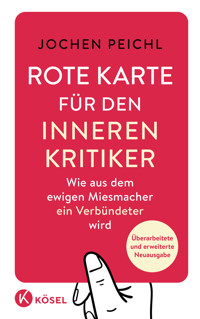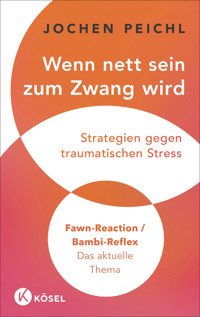
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die sozialen Reaktionen auf traumatischen Stress verstehen
Von einem harmonischen Miteinander profitiert jeder. Zeigen Menschen jedoch Verhaltensweisen wie übermäßiges Gefallen-Wollen, ausgeprägte Harmoniesucht oder Überangepasstheit, führt das bei Betroffenen häufig zu vielfältigen negativen Folgen: z.B. zu geringem Selbstwertgefühl, chronischer Erschöpfung, Angststörungen oder Depressionen. Ein solches übermäßig angepasstes Verhalten ist die Folge von frühkindlichen Belastungen und Trauma-Erfahrungen. Diesen sogenannten »Bambi-Reflex« (englisch »Fawn Reaction«) stellt der bekannte Traumatherapeut Jochen Peichl hier vor. Der Bambi-Reflex ist eine Überlebensstrategie, bei der Menschen mit Unterwerfungsverhalten und Selbstaufgabe auf für sie bedrohlich wirkende Situationen reagieren, und diese Strategie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder einsetzen.
Fachlich fundiert, aber verständlich geschrieben, erklärt Peichl psychologisch-therapeutischen Fachleser*innen ebenso wie Betroffenen, was das Phänomen des Fawning ausmacht. Er zeigt wie diese Traumareaktion den Alltag bestimmt sowie Strategien, mit denen dieses problematische Verhaltensmuster unterbrochen werden kann. Dieses Buch kann Betroffenen dabei helfen, Konflikte zu entschärfen, Stress abzubauen, Selbstbestimmung zu finden und sich realistische Ziele zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zwischen Anpassung und Selbstaufgabe: Die Psychologie des »Bambi-Reflexes« verstehen
Von einem harmonischen Miteinander profitiert jeder. Zeigen Menschen jedoch Verhaltensweisen wie übermäßiges Gefallen-Wollen, zwanghafte Harmoniesucht oder Überangepasstheit, hat das vielfältige negative Folgen: ein geringes Selbstwertgefühl, chronische Erschöpfung, Angststörungen, Depressionen. Dieses überangepasste Verhalten, den sogenannten »Bambi-Reflex«, und seine Folgen stellt der bekannte Traumatherapeut Jochen Peichl hier vor. Er erklärt, wie sich diese bislang unterschätzte Traumareaktion durch frühkindliche Belastungen entwickelt und wie sie das Alltagsleben und zwischenmenschliche Beziehungen beeinflusst. So können wir lernen, unsere sozialen Reaktionen auf traumatischen Stress zu verstehen und mit welchen Strategien wir solch problematische Verhaltensmuster durchbrechen können, um Konflikte zu entschärfen, Stress abzubauen und Selbstbestimmung zu finden.
Dr. med. Jochen Peichl, geboren 1950, ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie für Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Er hat verschiedene psychotherapeutische Weiterbildungen absolviert, u. a. in Ego-State-Therapie. Der Autor vieler Fachbücher und populärer Sachbücher war bis 2011 Oberarzt für Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Nürnberg. Heute leitet er das Institut für hypno-analytische Teilearbeit und Ego-State-Therapie (InHAT).
www.teiletherapie.de
JOCHEN PEICHL
Wenn nett sein zum Zwang wird
Strategien gegen traumatischen Stress
Fawn-Reaction /Bambi-Reflex
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber. Kapiteln vorangestellte Zitate können als Destillat des jeweils nachfolgenden Kapitels gelesen werden.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlag: zero-media.net, München
Redaktion: Jennifer Wagner
Satz- und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33407-9V001
www.koesel.de
»Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen darf,es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweitertenElementen der Vergangenheit gestaltet, und dieechte Sehnsucht muss stets produktiv sein,ein Neues, Besseres zu schaffen.«
Giordano Bruno (1548 – 1600)1, italienischer Philosoph
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Warum Sie dieses Buch lesen sollten
Was Sie in diesem Buch erwartet
TEIL 1: GRUNDLAGENUNDURSPRÜNGE
KAPITEL 1: Defensive Reaktionen auf Bedrohung oder wie unser Gehirn auf Gefahr reagiert
Trauma – ein kleiner Rückblick
Die sechs Überlebensreaktionen 6F: die Defensivkaskade des Gehirns
Die neurobiologischen Marker der Defensivreaktionen
Die Entwicklungsgeschichte der Abwehrreaktionen
Anpassungs- und Beschwichtigungsverhalten und soziale Rangordnungssysteme
KAPITEL 2: Soziale Reaktionen auf traumatischen Stress
Positive Eigenschaften sozialer Reaktionsmuster
Soziale Reaktion auf Stress und Gefahr
Die vier sozialen Anpassungsreaktionen
KAPITEL 3: Weitere soziale Abwehrreaktionen
»Flop«
Die »Tend-and-Befriend«-Reaktion
Das »Stockholm-Syndrom«
KAPITEL 4: Die Psychologie hinter dem »Bambi-Reflex«
Der »Bambi-Reflex« und der unsichere Bindungsstil
Die Sehnsucht nach und die Angst vor Nähe
Anpassung und Gefälligkeit
Kognitive Verzerrungen und Glaubenssätze
KAPITEL 5: Einflüsse von Erziehung und Familiendynamiken: die Entstehung des »Bambi-Reflexes«
Familiendynamiken und Rollenverteilung
Die Rolle von Eltern und Geschwistern bei der Entstehung des »Bambi-Reflexes«
Missbräuchliche Familiensysteme: frühe Bindungstraumata
Das Dilemma des inneren Kindes
Die Dynamik des inneren Systems
TEIL 2: MANIFESTATIONENUNDAUSWIRKUNGEN
KAPITEL 6: Der »Bambi-Reflex« bei Erwachsenen
Die subjektiven Symptome der »Bambi-Reaktion« bei Erwachsenen
Beispiele für die verschiedenen Persönlichkeitsstile bei Erwachsenen mit »Bambi-Reaktion«
Typische Denkmuster
Die Funktion der »Bambi-Reaktion«
Die langfristigen Auswirkungen der »Bambi-Reaktion«
KAPITEL 7: Der »Bambi-Reflex« als Kulturphänomen
Fawning: Soziale Medien und Online-Interaktionen
Echte und zwanghafte Freundlichkeit
Die »Bambi-Reaktion« im kulturellen Kontext
»Bambi-Reaktion« vs. »Tend-and-Befriend«
Der Unterschied zwischen »Bambi-Reaktion« und »People-Pleasing«
Die »Bambi-Reaktion« und verdeckter Narzissmus
Die »Bambi-Reaktion« im Film: Das Leben der Anderen
TEIL 3: WEGEZUVERÄNDERUNGUNDTHERAPIE
KAPITEL 8: »Bambi-Reflex«: Bin ich davon betroffen?
Drei wichtige Aspekte: Allgemeines zur Therapie
Woher kommt das alles bei mir? Ursachenforschung
KAPITEL 9: Allgemeine Therapieempfehlungen: Strategien zur Bewältigung
Angebote der Richtlinien-Therapieverfahren
Training sozialer Fähigkeiten
KAPITEL 10: Teiletherapie in der Arbeit mit dem inneren Beschwichtiger
Ego-States und die innere Bühne
Karina und die »Bambi-Reaktion«: Verlauf einer Ego-State-Therapie
Was habe ich in der Therapie gemacht?
Das innere Kind in die Gegenwart bringen
»Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit«
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Anmerkungen
Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
ich freue mich ganz besonders, dass Sie ein Interesse daran bekunden, mein kleines Werk zu lesen. Ich hoffe, ich vergeude Ihre wertgeschätzte Zeit nicht und Sie bereuen nicht, das Geld in dieses Buch investiert zu haben. Eingedenk dessen habe ich mich in aller Bescheidenheit sehr bemüht, Sie zu diesem wichtigen Thema gut zu informieren und auch zu unterhalten. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen.
Mhm … ein bisschen dick aufgetragen, finden Sie nicht? Das klingt etwas unterwürfig und ängstlich, voller Selbstzweifel und vielleicht werden Sie denken: »Mach dich nicht so klein, so wichtig bist du nicht.« Damit sind wir mitten im Thema dieses Buches: übertriebene Freundlichkeit und vorauseilender Gehorsam, um nicht anzuecken: Friede, Freude, Eierkuchen.
Was das alles mit dem scheinbaren Zwang, nett zu sein, zu tun hat, den wir immer wieder bei unseren Artgenossen erleben, will ich mit diesem Buch erzählen.
Einleitung
Bambi-Reflex« oder »Bambi-Reaktion«* ist die deutsche Übersetzung des englischen Wortes: Fawn Reaction (auch als »Fawning« bezeichnet). Dabei handelt es sich um einen Begriff aus der Psychologie, der eine spezifische soziale Reaktion auf Belastung und Trauma beschreibt. Im Englischen bedeutet »Fawn« Rehkitz, aber auch: jemandem schmeicheln, katzbuckeln oder kriechen. Der Begriff gehört zu den vier klassischen Reaktionsweisen auf Stress oder Bedrohung: Fight (Kampf), Flight (Flucht), Freeze (Erstarrung) und Fawn (Unterwerfung).
Die Fawn Reaction (man könnte das mit »Anpassungs- und Beschwichtigungsverhalten« übersetzen) bezieht sich auf das Verhalten eines Menschen, das darauf abzielt, durch übermäßiges Gefälligkeitsverhalten oder Anbiedern die Gunst eines Aggressors** oder eines Bedrohers zu gewinnen. Dieses Verhalten wird oft als Überlebensstrategie in traumatischen oder bedrohlichen Situationen eingesetzt, insbesondere in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Der »Bambi-Reflex« kann durch verschiedene Verhaltensweisen gekennzeichnet sein:
übermäßiges Entgegenkommen und Zustimmung, auch wenn es den eigenen Bedürfnissen und Wünschen widerspricht,Vermeidung von Konfrontationen und Meinungsverschiedenheiten,übermäßige Fürsorge und Bemühungen, dem Angreifer zu gefallen, sowieUnterdrückung eigener Gefühle und Bedürfnisse, um Harmonie zu bewahren.Das Konzept der Fawn Reaction hat seine Wurzeln in der Psychologie, speziell in der Traumatherapie. Ich lernte es im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Reaktionen des Organismus auf traumatische Erfahrungen kennen. Der Begriff wurde mir durch die Arbeiten von Pete Walker, einem US-amerikanischen Psychotherapeuten und Traumaspezialisten, in den 2010er Jahren bekannt. Walker beschreibt die Fawn Reaction in seinem Buch »Posttraumatische Belastungsstörung – Vom Überleben zu neuem Leben«.2 Darin erklärt er, wie Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung diese Überlebensstrategie entwickeln können. Walker argumentiert, dass die Fawn Reaction oft in der Kindheit entsteht, wenn Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie ständiger Kritik, Vernachlässigung oder Missbrauch ausgesetzt sind. Um zu überleben, die Zuneigung durch ihre Bezugspersonen zu sichern oder Missbrauch zu vermeiden, entwickeln sie Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Aggressoren zu besänftigen.
Ein anderer psychologischer, neudeutscher Begriff ist zurzeit ebenfalls hoch im Kurs: »People-Pleaser«. Das heißt so viel wie: »Allen-alles-Rechtmacher«. Das hat ganz sicher einen Bezug zu unserem Thema, weshalb ich im Laufe des Buches Verbindungen zur Fawn-Reaktion herstelle.
Zunächst lässt sich zusammenfassen: Wie bei allen Lebewesen reagiert unser Gehirn mit einem Feuerwerk neurobiologischer und neurochemischer Reaktionsmuster auf akuten Stress und lebensbedrohliche Gefahr – man nennt das in der Fachliteratur die Defensivkaskade. Neben dieser Akutreaktion versucht unser Organismus, sich an eine zeitüberdauernde Bedrohung anzupassen, und entwickelt soziale Reaktionsmuster. Die Fawn Reaction oder der »Bambi-Reflex« ist eine Form chronischer Unterwerfung und Überanpassung, die als Reaktion auf Belastungssituationen entsteht, aus denen es kein Entkommen gibt. Sie ist eine kreative Überlebensstrategie in der Kindheit und muss als solche anerkannt und gewertschätzt werden. Im Erwachsenenalter chronisch angewendet, ist sie allerdings meist dysfunktional und kostet den Menschen einen hohen Preis an individueller Lebenszufriedenheit und Selbstverwirklichung. Wie dieser Potenzialverlust genau aussieht, werde ich in den nächsten Kapiteln und in den Fallschilderungen aus meiner Praxis beschreiben.
Noch eine Anmerkung, um ein mögliches Missverständnis vorwegzunehmen: Ich habe die Begriffe »Bambi-Reflex« und »Bambi-Reaktion« weder geprägt noch erstmals im deutschsprachigen Raum eingeführt. Der Begriff kursiert schon länger im Umfeld der Diskussion um Trauma und Traumafolgen. In diesem Buch werde ich die deutschen Bezeichnungen »Bambi-Reflex« und »Bambi-Reaktion« neben dem englischen Terminus Fawn Reaction der Abwechslung halber synonym verwenden, denn sie bedeuten alle das Gleiche und beziehen sich auf eine soziale Traumareaktion.
Der Begriff »Fawning« wurde im Internet aufgegriffen und populärwissenschaftlich gebraucht (und vermarktet: siehe dazu YouTube). Dabei ging bei einigen selbst ernannten Influencern (ohne Trauma-Ausbildung) die Bezugnahme zu Trauma-Erfahrungen und Überlebensstrategien in der frühen Kindheit weitgehend verloren. Das können Sie sehen, wenn Sie diese Begriffe in eine Suchmaschine eingeben.
Der Begriff »People-Pleaser« tauchte in den späten 1990er Jahren auf und wurde von den Vertretern der Transaktionsanalyse in Amerika benutzt, um einen besonderen inneren Kritiker zu benennen: den »Allen-alles-Rechtmacher«. Er kann uns massiv unter Druck setzen, in sozialen Interaktionen alles zu tun, um es den anderen recht zu machen und von allen gemocht zu werden. Auch hier ist der Bezug zur Traumatisierung leider verloren gegangen.
Ich werde Ihnen im ersten Kapitel die sogenannte »Defensivkaskade« der Reaktion unseres menschlichen Gehirns auf Bedrohung und traumatischen Stress vorstellen. Um die einzelnen Reaktionszustände bei Zunahme der Bedrohung und Nähe zum Aggressor (Bedroher, gefürchtetes Objekt) zu benennen, werde ich die englischen Begriffe der »Defensive Cascade« aus der Originalpublikation von Maggie Schauer und Thomas Elbert verwenden und sie mit Großbuchstaben markieren: FREEZE, FLIGHT, FIGHT, FRIGHT, FLAG, FAINT. Die beiden Professoren der Universität Konstanz haben 2010 einen bahnbrechenden Artikel in einer englischen Fachzeitschrift zur Defensivkaskade veröffentlicht und darin die neurobiologischen, neurochemischen Veränderungen und beteiligte Hirnstrukturen als angeborene Reaktionsmuster des Gehirns (Reflexebene) genau beschrieben. Keine Angst, ich werde es kurzhalten.
Uns interessieren in diesem Buch mehr die Coping-Strategien eines Menschen, also die sozialen und psychologischen Reaktionsmuster, insbesondere das chronische Unterwerfungs- und Anpassungsverhalten, das wir bei Kindern in schwierigen familiären Kontexten, aber auch bei Erwachsenen in Paarbeziehungen und im Beruf beobachten können: das, was das Buch im Titel verspricht. Bei diesen Abwehr- und Reaktionsmustern stütze ich mich vor allem auf die Arbeiten von Pete Walker zu den 4Fs – im Englischen sind das Flight, Fight, Freeze und Fawn. Um diese von Walker beschriebenen sozialen Reaktionen von der oben genannten neurobiologischen Defensivkaskade abzugrenzen, werde ich für die sozialen Abwehrmechanismen die deutschen Bezeichnungen in Normalschrift wählen: Flucht, Kampf, Einfrieren und Unterwerfung.
Warum Sie dieses Buch lesen sollten
Mir fallen mehrere gute Gründe ein, warum Sie den »Bambi-Reflex« kennen und etwas darüber wissen sollten. Wenn Sie von diesem Verhalten selbst betroffen sind, können Sie Ihre eigenen Verhaltensmuster durch das Wissen um die Fawn Reaction besser erkennen und begreifen, warum Sie in bestimmten Situationen übermäßig nachgiebig oder unterwürfig reagieren. Sie verstehen, warum Sie eine solche »Harmonie-Sehnsucht« haben. Das kann der erste Schritt zu persönlicher Heilung und zur Stärkung des Selbstwertgefühls sein.
Wenn Sie nicht davon betroffen sind, werden Sie traumatische Erlebnisse und ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Mitmenschen besser nachvollziehen können. Dann gelingt es Ihnen, diese »Sehnsucht nach Harmonie« hinter der »Bambi-Reaktion« zu verstehen und sie als sinnvolle Überlebensstrategie auf Traumabelastungen einzuordnen. Das kann helfen, Mitgefühl und Unterstützung für Betroffene zu fördern.
Generell können Sie durch das Wissen um diese Verhaltensweise eine Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen anstreben. Ein besseres Verständnis der Fawn Reaction kann dazu beitragen, Kommunikationsmuster zu verbessern und Konflikte zu reduzieren. Menschen lernen, sich gegenseitig besser zu verstehen und auf respektvolle Weise zu interagieren. So können auch Prävention und Intervention bei Mobbing und Missbrauch im Umfeld etabliert werden. Im sozialen oder beruflichen Umfeld kann das Wissen über Anpassungs- und Beschwichtigungsverhalten (Fawn Reaction) helfen, missbräuchliche Verhaltensweisen zu erkennen und zu bekämpfen. Es ermöglicht Führungskräften und Pädagogen, angemessene Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen.
Deshalb ist es aus meiner Sicht als Traumatherapeut sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Was Sie in diesem Buch erwartet
Nach der Definition und der Frage nach dem Ursprung des »Bambi-Reflexes« geht es im ersten Teil des Buches um die neurobiologischen Hintergründe der automatisierten Abwehrreaktionen unseres Säugetiergehirns auf äußere und innere Bedrohungen. Diese körpereigenen neurobiologischen und neurochemischen Reaktionen bei einem Akutereignis nennt man in der Traumaliteratur die »Defensivkaskade« – eine Kaskade, weil die Abwehrreaktionen Schritt für Schritt von der ersten Alarm-Orientierung hin zum Bedroher bis zu Unterwerfung und Totstellen stufenweise ablaufen. Hält die Bedrohung, zum Beispiel in der Kindheit oder in repressiven Gemeinschaften, über längere Zeit an, entwickeln sich soziale Reaktionsmuster, die uns als spezifische Persönlichkeits- oder Charaktereigenschaften imponieren: Dazu gehören Modi der Persönlichkeitsorganisation wie Flucht-, Kampf- und Erstarrungsverhalten sowie die Fawn Reaction, um die es hier gehen soll. Im Themenfeld der Psychologie des »Bambi-Reflexes« ist es hilfreich, sich mit dem »unsicheren Bindungsstil«, seinen Auswirkungen auf ein zu geringes Selbstwertgefühl und auf Schwierigkeiten bei der Selbstbehauptung zu beschäftigen. Weiter beschäftige ich mich mit der Entwicklung des »Bambi-Reflexes« durch spezifische Erziehungsmuster und Familiendynamiken, vor allem mit zu hohen Erwartungen der Eltern und emotionalem Missbrauch. Im zweiten Teil des Buches geht es um die Manifestationen des »Bambi-Reflexes« im Erwachsenenalter und seine langfristigen negativen Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit, zwischenmenschliche Beziehungen und beruflichen Erfolg.
Der dritte Teil des Buches heißt »Wege zu Veränderung und Therapie«. Ich beschreibe verschiedene Therapiestrategien, darunter die tiefenpsychologische, kognitive Verhaltenstherapie, die systemische Therapie und die Traumatherapie. Sie können dabei helfen, den »Bambi-Reflex« zu bewältigen und gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln. Das soll Ihnen als Leserinnen und Leser einen Überblick über unterschiedliche Therapieansätze verschaffen, ohne dass ich im darauffolgenden Teil über meinen Ansatz der »Teiletherapie« (Ego-State-Therapie, EST) den Anspruch habe, mit dem Buch einen praktischen Hilferatgeber vorzulegen. Meine Vorstellung ist, dass es neben einem Training sozialer Fähigkeiten gelingen kann, mit verschiedenen Ich-Zuständen zu arbeiten, die durch traumatische Erfahrungen entstanden sind und die die innere Dynamik des »Bambi-Reflexes« auf der inneren Bühne reinszenieren. Das wird mit einem Auszug aus einem Therapieverlauf dokumentiert.
Dieses Buch enthält zahlreiche Fallbeispiele aus meiner jahrelangen Praxis, die die verschiedenen Aspekte des »Bambi-Reflexes« und die therapeutischen Ansätze veranschaulichen. Diese Beispiele sollen helfen, die Theorie in der Praxis besser zu verstehen.
* Ich setze die Begriffe »Bambi-Reflex«, »Bambi-Reaktion« und »People-Pleaser« in Anführungszeichen, da sie keine wissenschaftlich anerkannten Begriffe darstellen, sondern eher populärwissenschaftlich gemeint sind.
** Alle genannten Aussagen, bei denen nicht explizit das Geschlecht genannt ist, gelten immer für alle Geschlechter.
Grundlagen und Ursprünge
Teil 1
Kapitel 1: Defensive Reaktionen auf Bedrohung oder wie unserGehirn auf Gefahr reagiert
Als ich 1991 mit der Aufgabe betraut wurde, als leitender Oberarzt eine Traumastation am Klinikum Nürnberg zu organisieren, konnte ich auf erste Erfahrungen in Bielefeld (Luise Reddemann) und Göttingen (Ulrich Sachsse) mit stationärer Traumatherapie nach Besuchen und Hospitationen in den Abteilungen zurückgreifen. Jenseits psychoanalytischer Modelle zur Arbeit mit traumatisierten Menschen, die in Deutschland bis dato üblich waren, schwappten Innovationen wie Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR, Francine Shapiro) oder die Ego-State-Therapie (John und Helen Watkins) über den großen Teich. Sie sorgten für Aufsehen unter der wachsenden Community der Traumatherapeuten.
Die Traumaforschung und in Folge auch die zielgenauere Traumatherapie haben sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, indem sie ein besseres Verständnis der psychologischen und neurobiologischen Reaktionen auf traumatische Ereignisse erlangen konnten. Ein zentraler Aspekt der Traumaforschung war zu Beginn dieses Jahrhunderts das Konzept der »Flucht-Kampf-Freeze«-Reaktion (Freeze für »Einfrieren«, »Erstarren«): eine automatische Reaktion des Körpers auf bedrohliche Situationen. Auch die Traumatherapie sollte nach einer etwas starren Reihenfolge ablaufen: Stabilisierung, Konfrontation mit dem Trauma und schließlich Integration des Traumas in das weitere Leben. Die moderne Traumatherapie hat sich an vielen Stellen weiterentwickelt und zeichnet sich heute durch eine Reihe spezifischer Ansätze und Methoden aus, die auf den neuesten Erkenntnissen aus Psychotherapie, Neurowissenschaften und Traumaforschung basieren. In der Frühphase meiner Traumatherapie-Ausbildung galten für mich noch die für die 1980er Jahre des letzten Jahrhunderts typischen Überzeugungen: In der Psychoanalyse wurde ein Trauma als überwältigendes, psychisches Ereignis betrachtet, das das Unbewusste beeinflusst und verdrängt wird. Es kann sich durch Symptome, einen Wiederholungszwang und Übertragung in der Therapie äußern. Das Ziel der psychoanalytischen Traumatherapie war es, Betroffenen diese unbewussten Konflikte durch die therapeutische Arbeit ins Bewusstsein zu bringen, um eine Integration und Heilung zu ermöglichen.
Heute würde ich die Frage nach meinem Traumaverständnis anders beantworten. Ich verstehe, basierend auf den Neurowissenschaften und der Hirnforschung, Traumata als tiefgreifende Veränderungen im Gehirn und im Nervensystem. Traumatische Erlebnisse führen zu einer Störung in der Gedächtnisverarbeitung und zur Dysregulation des Nervensystems. Das gilt insbesondere im Bereich des limbischen Systems, das für Emotionen, Gedächtnis und die Stressreaktion verantwortlich ist. Methoden wie EMDR oder somatische Techniken zielen darauf ab, diese dysfunktionalen Prozesse im Gehirn zu normalisieren. Deshalb arbeitet moderne Traumatherapie weniger mit der Analyse und dem Erzählen von Ereignissen, sondern behandelt körperorientiert. Dazu werden keine Berührungen wie in üblichen Körpertherapien genutzt. Ziel ist es, dem gestressten Nervensystem in kleinen Schritten beizubringen, sich selbst zu beruhigen und herunterzuregeln. Ein Hauptaugenmerk liegt auf dysfunktionalen Glaubenssätzen und Kognitionen. Die Teiletherapie geht in ihrem Behandlungsmodell von unterschiedlichen Teilpersönlichkeiten aus, die in unterschiedlichen Situationen unser Denken, Fühlen und Handeln prägen. Eine spezielle Therapierichtung neben Transaktionsanalyse, Schematherapie, Inneres Team und anderen ist die Ego-State-Therapie. Mit ihrer Hilfe kann ein Zugang zu verletzten Kindanteilen und inneren destruktiv wirkenden Anteilen gelingen.
Das Therapieangebot ist weiterhin phasenorientiert. Normalerweise gibt es drei Hauptphasen: Stabilisierung, Traumaverarbeitung sowie Integration und Neuorientierung. Diese drei Phasen sind als grobe Orientierung zu verstehen und nicht klar abgegrenzt; in der Therapie kann man zwischen ihnen hin und her springen. Moderne Traumatherapie ist stark individualisiert, es gibt keinen Einheitsansatz. Jede Person hat eine einzigartige Geschichte. Die Therapie wird angepasst, um den spezifischen Bedürfnissen und der Resilienz des Einzelnen gerecht zu werden.
Trauma – ein kleiner Rückblick
Zu den frühen Ansätzen fallen mir vor allem zwei Namen ein, die in meiner Ausbildung immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Sie sind die Lichtgestalten des 19. Jahrhunderts: Sigmund Freud aus Wien und Pierre Janet aus Frankreich. Sie legten mit ihrer Arbeit über Hysterie und traumatische Erinnerungen den Grundstein der Traumaforschung und ihre Arbeiten haben bis heute Einfluss. Freud entwickelte die Theorie, dass traumatische Ereignisse verdrängt werden und sich später als Symptome manifestieren können. Die vielen körperlich und seelisch verletzten Männer (sowie Frauen und Kinder?) im Ersten und Zweiten Weltkrieg beschleunigten die Erforschung von Kriegsneurosen (heute als »Posttraumatische Belastungsstörung« (PTBS) bekannt). Das führte zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Kriegstraumata auf Soldaten.
In den 1950er und 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts begann mit der Einführung der Psychopharmakologie die Erforschung der biologischen Grundlagen von Traumata. Forschungen an Universitäten über Stressreaktionen und das Nervensystem nahmen zu und führten zu einer raschen Zunahme des Wissens über die menschliche Psyche unter toxischem Stress. Ein weiterer Meilenstein wurde in den 1970er Jahren gelegt: Die Diagnose »Posttraumatische Belastungsstörung« (PTBS) wurde im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III, 1980) offiziell berücksichtigt. Das war ein entscheidender Moment der Anerkennung dieser Diagnose und des zugrunde liegenden Leidens im Bereich der Psychiatrie, der die Traumaforschung weiter vorantrieb.
Als ich mich ab 1975 bei meiner Ausbildung zum Psychoanalytiker in Göttingen für Traumatherapie zu interessieren begann, war das Feld noch stark von psychoanalytischen Glaubensüberzeugungen geprägt. Diese verengten den Blick auf das Problem. Es galt damals noch als Tabubruch, vom freudschen Denken abzuweichen und sich für Publikationen aus dem Bereich Hirnforschung, Neurobiologie oder Stressforschung zu interessieren. Aber die Fortschritte in der Neurobiologie und bei Bildgebungstechnologien (wie fMRT) haben mein Verständnis der Auswirkungen von Traumata auf das Gehirn vertieft und öffneten meinen Blick. Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) ist eine nicht invasive Untersuchungsmethode, dank der wir »die Arbeit« des Gehirnes bei unterschiedlichen Aufgaben dokumentieren können.
Forscher wie Bessel van der Kolk und Judith Herman haben wichtige Beiträge geleistet, indem sie die biologischen und psychologischen Mechanismen von Traumata erforschten. Ihre Bücher3 wurden ins Deutsche übersetzt und mit Begeisterung gelesen. Die neurobiologische Forschung heute untersucht die Rolle von Hirnstrukturen wie der Amygdala, dem Hippocampus und dem präfrontalen Kortex in der Verarbeitung von Traumata und Stressreaktionen. Sie versucht, die Entstehung von Dissoziation zu erklären. Unser Wissen über die Reaktion von Menschen auf traumatischen Stress wurde auf sechs unterscheidbare Reaktionsmomente erweitert. Darum soll es in den folgenden Unterkapiteln gehen.4
Noch ein Tipp: Wenn Sie sich im Moment nicht für die Neurobiologie der Notfallreaktion des Gehirns auf Bedrohung und Lebensgefahr interessieren, dann empfehle ich Ihnen, gleich Kapitel 2 aufzuschlagen und mit den sozialen Reaktionen auf Stressbelastung im Alltag weiterzumachen.
Die sechs Überlebensreaktionen 6F: die Defensivkaskade des Gehirns
In der klinischen Traumatheorie hat die Wissenschaft in den letzten Jahren durch intensive Studien an Tieren und Menschen ein Kaskadenmodell defensiven Verhaltens entwickelt.5 Ausgehend von Arbeiten zum Tiermodell und kürzlich auch nachgewiesen im Humanbereich konnte gezeigt werden, dass defensives Verhalten durch unser Nervensystem dynamisch in sechs Schritten organisiert ist. Mit zunehmender Nähe zu Gefahr und Bedrohung und den beim Individuum vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten ändert es sich. Bei der Beschreibung der sechs Haltepunkte der Defensivkaskade stehen in den neurobiologischen Arbeiten vor allem die körpereigenen, physiologischen Reaktionen und Veränderungen im Gehirn an erster Stelle. Sie werden, wie angekündigt, im Folgenden auf Englisch und in Großbuchstaben genannt.
Unser Organismus hält verschiedene neurobiologische Möglichkeiten bereit, um auf eine akute Gefahr und Bedrohung zu reagieren und unser Überleben wahrscheinlicher zu machen. Ich lege meinen Ausführungen die Originalarbeit von Maggie Schauer und Thomas Elbert aus dem Jahre 2010 zugrunde, in der die speziellen neurobiologischen und neurochemischen Veränderungen im Gehirn für die einzelnen Stressmuster bei Bedrohung von Säugetieren und Menschen beschrieben wurden.6 Um es noch einmal deutlich zu sagen: Bei der Beschreibung der 6F von Schauer und Elbert geht es nur um die Reaktion des Organismus auf (lebens-)bedrohliche Reize, um das physiologische Erbe unserer Phylogenese vom Knorpelfisch bis zum Homo sapiens.
Bei der vorgestellten Abwehrkaskade handelt es sich um unterschiedliche Reaktionsmuster, die bei der Annäherung an ein gefürchtetes Objekt auftreten.
Wir können also grob zwei Szenarien für diese Bedrohungssituationen unterscheiden: Ein Mensch/Tier ist in Gefahr und hat Möglichkeiten, zu flüchten oder zu kämpfen, oder ein Mensch/Tier ist in Lebensgefahr, kann nicht mehr entkommen und sich nur totstellen. Ich möchte Ihnen die sogenannten 6F der Abwehrreaktion auf Bedrohung an einem Beispiel erläutern.
Stellen wir uns eine Traumasituation vor: Herr Blau sitzt in einem Café und liest Zeitung. Plötzlich hört er einen Knall auf der Straße. Herr Blau schreckt hoch, erstarrt und sieht sich um. Er sieht, wie die anderen Menschen im Café reagieren, möglicherweise nimmt er Kontakt mit ihnen auf. Sein Gehirn arbeitet, um die Quelle der Störung und die Art der potenziellen Gefahr auszukundschaften. Bei Elbert und Schauer heißt dieser Zustand FREEZE, »Aufmerksame Unbeweglichkeit« (»Attentive Immobility«) oder »Orienting Respone« (kurz OR). Diese Orientierung ist eine automatische Reaktion des Organismus auf neue, unerwartete oder bedeutsame Reize.
Wenn nichts weiter passiert, wird Herr Blau denken »Es war nur die Fehlzündung eines Motorrades« und sich wieder der Zeitung widmen. Wenn die Bedrohung zunimmt, wird Herr Blau nach einem Fluchtweg Ausschau halten, hochspringen und loslaufen. Das nennen wir FLIGHT: Flucht oder Vermeidung der Bedrohung.
Wenn Herr Blau bemerkt, dass es keinen Fluchtweg gibt, ein Mann mit einer Pistole das Café betritt und in die Decke schießt, wird er schnell überlegen, ob er den Angreifer allein oder mit anderen niederkämpfen kann. Das nennen wir FIGHT: Kampf und aktiver Widerstand gegen oder Konfrontation mit der Bedrohung.
Wenn der Angreifer zu mächtig ist und keine Chance besteht, ihn auszuschalten, ändert sich die Situation grundlegend: Aus der Gefahr ist eine Lebensgefahr ohne Fluchtmöglichkeit geworden. Herr Blau erstarrt, wirkt äußerlich bewegungslos, aber in seinem Inneren sucht er nach einer Überlebensstrategie.
Als FRIGHT bezeichnet man einzufrieren und unbeweglich zu werden oder die Unfähigkeit, auf die Bedrohung zu reagieren. Dieser Zustand heißt in der englischen Literatur »Tonic Immobility«, tonische Unbeweglichkeit. Die Muskelspannung ist dabei also noch erhalten. Auch die Begriffe »Unresponsive Immobility« oder auch FRIGHT, was so viel wie »Schock« bedeutet, werden in diesem Zusammenhang benutzt. In der deutschen Traumaliteratur hat es sich eingebürgert, diesen Erstarrungszustand bei Menschen »Freeze« zu nennen, was nicht ganz korrekt ist, weil der Begriff eigentlich die Orientierungsreaktion (OR) im ersten Schritt (siehe oben) meint.
Wenn die Bedrohung anhält, die Lebensgefahr stärker wird und keine Aussicht auf Rettung besteht, wird Herr Blau immer weiter »abschalten«, sich dem Willen des Täters unterwerfen und aufgeben – das heißt im Englischen SUBMIT. Jetzt schwindet die Muskelspannung, weshalb der Zustand als atonische Bewegungslosigkeit oder FLAG (steht für »schlaff werden«, »erlahmen«) bezeichnet wird: Der Organismus schaltet ab, der eigene Wille wird aufgegeben.
Was dann noch folgt, ist, dass Herr Blau vielleicht ohnmächtig wird (»fainting«) und auf dem Boden liegt, als wäre er tot. Wir sprechen von FAINT: Ohnmacht als extreme Form der Stressreaktion, bei der ein Organismus auf eine überwältigende Bedrohung mit Tonusverlust und Kollaps reagiert.
Diese sogenannten 6Fs sind die Verteidigungsreaktionen bei Menschen und höheren Säugetieren in einer Situation, in der sich die Gefahr durch einen Aggressor durch räumliche Annäherung steigert und zu einer Bedrohung potenziert, aus der man nicht mehr flüchten kann. Die Kaskade FREEZE – FLIGHT – FIGHT – FRIGHT – FLAG – FAINT ist eine kohärente Sequenz von sechs Furchtverhaltensweisen. Diese treten als Überlebensreaktionen des Organismus nacheinander auf. Im nächsten Abschnitt sollen diese einzelnen Zustände genauer untersucht, dargestellt und erläutert werden.
Die neurobiologischen Marker der Defensivreaktionen
Bezüglich der neurobiologischen Veränderungen innerhalb der sechs Haltepunkte der Defensivkaskade gelten folgende Hinweise: Die ersten drei defensiven Reflexe der sogenannten »Defensivkaskade« werden primär vom sympathischen Nervensystem, die zweiten vom parasympathischen Nervensystem orchestriert. Die tonische Immobilisierung (Stufe 4) ist eine Übergangszone, in der beide autonomen Nervensysteme, Sympathikus und Parasympathikus, aktiv sind. Zur besseren Veranschaulichung siehe Abbildung 1 mit den 6 Haltestellen (6F) der Reaktion des Organismus auf Bedrohung und Lebensgefahr.
Abbildung 1: Die Defensivkaskade (Dunkle Felder: parasympathisch; helle Felder: sympathisch), orientiert an Schauer & Elbert 2010
Im Folgenden sollen die genannten Reaktionsmodi auf Stress und Bedrohung im Einzelnen betrachtet werden.
Die FREEZE- oder Orientierungs-Reaktion ist die automatische Reaktion eines Organismus auf neue, unerwartete oder bedeutsame Reize: Stop – look – listen! Umgangssprachlich nennen wir so etwas »Schrecksekunde«. Habe ich zu Beginn meiner Ausbildung in Bezug auf das klassische Stressreaktionsmodell noch gelernt, dass diese Orientierungsreaktion mit sympathischer Erregung (erhöhter Puls und Blutdruck) verbunden ist, zeigen neuere Forschungen im Gegensatz dazu, dass die anfängliche Reaktion auf aversive Stimuli eher durch eine parasympathische Verringerung als durch eine Erhöhung der Herzfrequenz gekennzeichnet ist und von einer Unterbrechung der Schreckreaktion begleitet wird.7 Diese »Angst-Bradykardie« (Aufmerksamkeits- oder Alarmreaktion) umfasst eine motorische Hemmung, konzentrierte Aufmerksamkeit auf die Bedrohung und eine Verlangsamung der Herzfrequenz.8
Forscher fanden bei psychophysiologischen Untersuchungen heraus, dass sich die Richtung der physiologischen Reaktion wenige Sekunden nach dem Auftreten eines bedrohlichen Reizes umkehrt und zu einer Beschleunigung des Herzschlags und einer Verstärkung des Schreckreflexes führt. Es gibt also eine Zunahme der sympathikotonen Aktivierung. Diese vorübergehende Pause, das Innehalten vor der Mobilisierung von Handlungen, wird mit einer verstärkten Sinneswahrnehmung und der Verarbeitung kontextbezogener Details in Verbindung gebracht. Der Körper eines Tieres oder auch eines Menschen ist auf die Reizquelle hin ausgerichtet, er »friert« in Sekundenschnelle ein und geht vom Normalzustand in eine aufmerksame Unbeweglichkeit über – deshalb spricht man in der englischen Literatur von »Attentive Immobility«. Eine Person in diesem Zustand bleibt stehen, schaut, hört zu und bewertet die Situation anhand der Frage: »Bin ich sicher oder bin ich in Gefahr? Muss ich lebensrettende Maßnahmen ergreifen?« Diesen Zustand der Informationssammlung, durch den sich der Körper auf weitere Stufen der Defensivreaktion vorbereitet, bezeichnet man als Hypervigilanz oder Hyperarousal: auf der Hut, wachsam und bereit sein zu agieren. Bei Menschen scheint es mir relevant, zwischen verschiedenen Szenarien zu unterscheiden, in denen ein Mensch eine Bedrohung wahrnimmt: Entweder er ist ganz auf sich gestellt oder er reagiert in einer Gemeinschaft. Es ist sicher leicht zu verstehen, dass sich eine Person, deren Wahrnehmung der Welt im Alltag in dieser Position verharrt, in einem dauernden Spannungs- und Erregungszustand befindet (Hyperarousal). Die Welt ist für sie ein »gefährlicher Ort«, an dem man ständig auf der Hut sein muss.