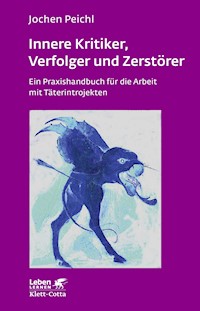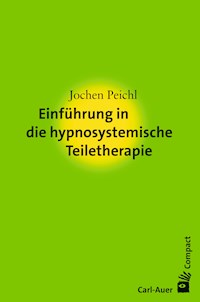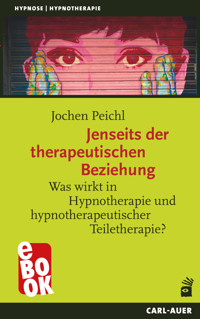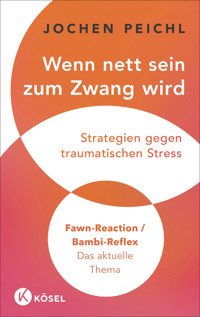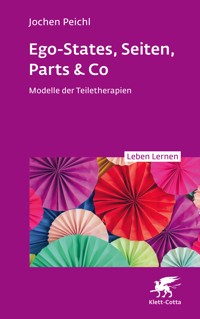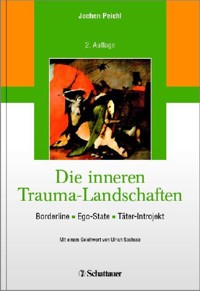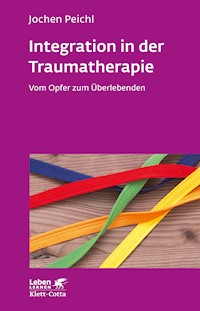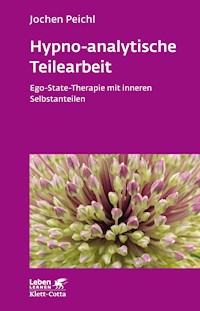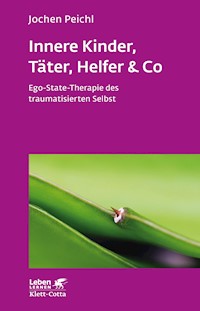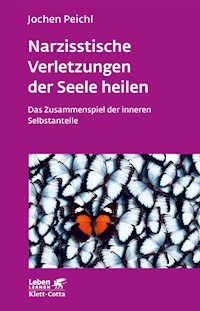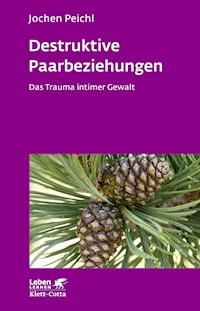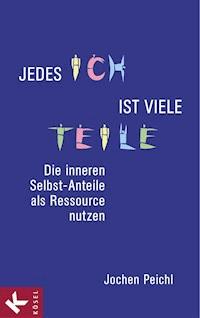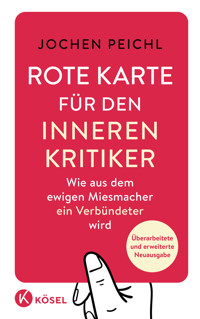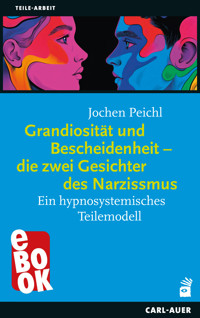
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Narzissmus als Lösungsstrategie Narzissmus ist nicht gleich Narzissmus. In der Persönlichkeitspsychologie werden zwei Arten von Narzissmus unterschieden: der offene, grandiose und der verdeckte, verletzliche Narzissmus. Diese Unterscheidung ist in der Regel mit einer Sicht auf Narzissmus als Defekt oder problematische Verhaltensweise verbunden. Jochen Peichl stellt dem eine Perspektive von Narzissmus als Lösungsstrategie entgegen, mit der Menschen versuchen, ihr Selbstwertsystem zu stabilisieren. Diese hypnosystemische Sichtweise fragt nicht nach einem "guten" oder "schlechten" Narzissmus, sondern geht von einem "normalen Narzissmus" aus, der bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Das Buch untersucht, welche Selbstanteile im Laufe des Lebens zu einem arrogant-selbstzentrierten Narzissmus führen und welche zu einem selbstlos-bescheidenen. Peichl führt dazu die Ego-State-Theorie von John und Helen Watkins mit Erkenntnissen des Neurokonstruktivismus zusammen. Das Ziel ist es, die Grenzen zwischen gesunder Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Narzissmus zu erkunden und die therapeutische Arbeit an den inneren Anteilen Grandiosität und Bescheidenheit zu erleichtern. Der Fokus liegt dabei auf dem Erleben von gesunder Selbstliebe und der Erfahrung, für jemanden besonders zu sein – einmalig und unverwechselbar. Der Autor: Jochen Peichl, Dr.; Facharzt für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Neurologie; ausgebildet als Psychoanalytiker, Hypno- und Ego-State-Therapeut mit Schwerpunkt Traumatherapie; Gründer und Leiter des Instituts für hypnoanalytische Teilearbeit und Ego-State-Therapie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carl-Auer
Jochen Peichl
Grandiosität und Bescheidenheit –die zwei Gesichter des Narzissmus
Ein hypnosystemisches Teilemodell
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Sebastian Baumann (Mannheim)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Dr. Carmen Beilfuß (Magdeburg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Michael Bohne (Hannover)
Dr. Dirk Rohr (Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Dr. Angelika Eck (Karlsruhe)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Torsten Groth (Münster)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt † (Münster)
Reinert Hanswille (Essen)
Jakob R. Schneider (München)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Tom Levold (Köln)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Dr. Dr. Kurt Ludewig (Münster)
András Wienands (Berlin)
Dr. Stella Nkenke (Wien)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Rainer Orban (Osnabrück)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Themenreihe »Teile-Arbeit«
hrsg. von Bernhard Trenkle und Silvia Zanotta
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv: © AdobeStock von cff999 (KI-generiert)
Redaktion: Nicola Offermanns
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0616-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8568-0 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Inhalt
Warum es auch gut ist, Narzisst zu sein
Was Sie hier erwartet
Für Schnellleser: Die Essenz des Buches
Einführung: Die systemische Sicht erweitern
Aber ist damit wirklich das Muster verschwunden?
Das Ich ist viele Teile
Das Dilemma des inneren Kindes
Zurück zur Persönlichkeitsstörung
Was heißt das für dieses Buch?
Teil 1: Narzissmus als Problem
1 Formen und Dimensionen des Narzissmus
Millons Taxonomie
Der exhibitionistische und heimliche Narzissmus bei James Masterson
Narzisstische Persönlichkeitsstörung: dimensional oder kategorial?
Drei Subtypen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung nach Eric Russ
2 Narziss und Echo im griechischen Mythos – die Unmöglichkeit einer Liebe
Was ist ein Mythos?
Narziss-Mythos bei Ovid
Der Spruch des Teiresias
Der Narziss-Mythos aus einer traumatherapeutischen Sicht
Einsicht mit Ausblick
3 Vom »guten« und »schlechten« Narzissmus
Das Alternativmodell der Persönlichkeitsstörungen im DSM-5
Selbstachtung versus narzisstische Not
Selbstliebe – Selbstachtung – Selbstwert
Gesunde Selbstliebe
Selbstwertschätzung: ein Kontinuum?
Zusammenfassung
4 Craig Malkins Selbstwertkontinuum: von gesundem Selbstbewusstsein bis zum pathologischen Narzissmus
Selbstliebe zwischen Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung
Besonders sein
5 Verträglichkeit: Haben Sie ein angenehmes Wesen?
Die Big Five
Die äußere Bühne
6 Die zwei Gesichter des Narzissmus
Erinnerung an die Einteilung von Russ
Grandiosität und Bescheidenheit – die zwei Seiten des Narzissmus
Der Mensch mit offenen narzisstischen Persönlichkeitszügen: der selbstzentrierte Typus
Der Mensch mit verdeckten narzisstischen Persönlichkeitszügen: der selbstlose Typus
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Seiten einer Medaille
Zwei Seiten der gleichen Person?
Die Erweiterung des Selbstwertkontinuums
Verdeckter Narzissmus und Depression
Rückschau
Teil 2: Narzissmus als Lösung
Vorausschau
7 Das »strukturelle Defizit«: Wie entstehen die zwei Gesichter des Narzissmus in der Kindheit?
Zur Erinnerung: Die Phänomenologie der beiden Subtypen
Der Einfluss des Erziehungsstils beim offenen und verdeckten Narzissmus
Die Kindheitsentwicklung
Gemeinsamkeiten der Erziehungsstile
Zusammenhang zwischen Temperament und Narzissmustypen
8 Narzissmus als hochkompetente und kreative Form der Selbstwertregulation
Die Regulation des Selbstwertes durch Selbstherrlichkeit und Grandiosität
Die Regulation des Selbstwertes durch Bescheidenheit und Selbstlosigkeit
9 Das elterliche Erziehungsverhalten: Ichbezogenheits-Narzissmus und Selbstlosigkeits-Narzissmus
Groß und klein
Teil 3: Das Ego-State-Modell
10 »In mir spielt ein Orchester«: Warum wir vielfältig sind – das klassische Ego-State-Modell
11 Sind Ego-States wie Innenpersonen mit eigenen Wünschen und Träumen? Wieweit ist Ver-DING-lichung hilfreich?
Die Krux mit den verdinglichten Metaphern
»Das Gehirn ist wie ein Computer«
Wie arbeitet unser Gehirn aus Sicht des Neurokonstruktivismus?
Was sind vernetzte Muster und Vorhersagemodelle im Gehirn?
Die Persönlichkeit als ein komplexes Konstrukt
Mein Zwischenfazit
12 Das Selbst als Erzählung: Wie Ego-States unser Leben schreiben
Was könnten Ego-States sein?
Wie könnten Therapiestrategien der Ego-State-Therapie hilfreich sein?
Das Narrativ vom inneren Kind
Das Narrativ in der Philosophie
»Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben«
Brauchen wir Integration in der Teiletherapie?
Überleitung
Teil 4: Die narzisstische Wunde heilen: Überlegungen für die Praxis
13 Das verletzte innere Kind hinter der Grandiosität
Das Leid aus fernen Zeiten
Die Entstehung der narzisstischen Wunde
14 Die Grandiosität als Wundpflaster der narzisstischen Verletzung
Zwischen Bindung und Individuation
Die Selbstlosigkeits-Lösung
Die Ichbezogenheits-Lösung
Die zwei überlebenswichtigen Reaktionen auf die frühe Verletzung des Kindes – eine Zusammenfassung
15 Größen-Selbst und Kleinheits-Selbst in der Praxis
Das Größen-Selbst: grandios-ichzentriert
Das Kleinheits-Selbst: grandios-selbstlos
Zusammenfassung: Zwei Wege, um Unsicherheit zu bewältigen
16 Vorderbühne und Hinterbühne
Auf die Welt zu
Von der Welt weg
Vorderbühne und Hinterbühne
Die innere Bühne
Übungen zur inneren Landkarte: Wie reguliere ich meinen Selbstwert?
Das innere Selbstwert-Kompetenzteam
Die innere Bühne des offenen Narzissten
Die innere Bühne des verdeckten Narzissten
17 Die narzisstische Wunde heilen: eine persönliche Ermutigung
Das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart
Die 5 Schritte zur Versorgung der narzisstischen Wunde
Zum guten Ende
Literatur
Über den Autor
Der Narzissmus trägt viele Masken:Heiligkeit, Pflichtbewusstsein, Freundlichkeit und Liebe, Bescheidenheit und Stolz. Er reicht damit von der Haltung eines hochmütigen und arroganten Menschen bis zu einer bescheidenen und unaufdringlichen Person.
Erich Fromm1
1Fromm 2003, S. 144.
Warum es auch gut ist, Narzisst zu sein
Wie bitte? Vermutlich sind Sie, liebe Leserin und lieber Leser, jetzt leicht irritiert und finden diese Aussage mit Ausrufezeichen etwas überraschend oder gar befremdlich. Das ist auch ein wenig beabsichtigt, da ich Ihnen hier kein weiteres Narzissten-Bashing-Buch vorlegen möchte – mit dem Tenor: Narzissten2 sind anstrengende Menschen, und man sollte einen großen Bogen um sie machen. Das kann im Einzelfall sicher zutreffen, und wir müssen mit solchen Frauen und Männern auch nicht einen »Erlebnis-Urlaub« im RTL-Dschungelcamp buchen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dafür gewinnen könnte, dass wir uns das Thema »Narzissmus« aus einer hypnosystemischen Sicht genauer anschauen. Vielleicht kann ich ja ein paar neue und interessante Ideen zum Thema beisteuern.
Danke, dass Sie immer noch bereit sind, sich an meiner Seite mit diesem zweifelhaften und leicht irritierenden Thema auseinanderzusetzen. Ich hätte volles Verständnis dafür gehabt, wenn Sie lieber zu dem Eheratgeber »Warum Hass besser klebt als Liebe? Hypnotherapeutische Anleitung zum Scherbenkleben« oder zu etwas Erbaulicherem wie »Das Glück kennt tausend Wege zu Dir« gegriffen hätten.
Schon das Un-Wort »Narzissmus« lässt einem die Haare zu Berge stehen – entweder, weil man davon als »armes Opfer« im Alltag betroffen ist und unter einem sogenannten »Narzissten« z. B. zu Hause, im Büro oder in der Familie ganz fürchterlich leidet, oder, weil man schon mal mit dem Schlachtruf »Du bist ein blöder Narzisst/eine blöde Narzisstin« von jemand anderem vorschnell etikettiert und abgewatscht wurde. Sicher wollen Sie nun endlich wissen, was sich hinter solchen freundlichen Zuschreibungen und wenig wertschätzenden Tiefschlägen verbirgt. Solche treffsicheren Totschlagargumente sollen heutzutage im Zeitalter des Narzissmus und in unserer »narzisstischen Gesellschaft«3, wie es so schön heißt, ja gar nicht so selten vorkommen.
Mit dem Buch in Ihren Händen möchte ich mich von Büchern à la »Wie entwaffne ich einen Narzissten? Überleben und Gedeihen neben einem Selbstzentrierten« der Schematherapeutin Wendy Behary (2013) oder »Warum immer nur Du? Die sieben Todsünden des Narzissmus« von Sandy Hotchkiss (2002) deutlich unterscheiden. In diesen US-amerikanischen Publikationen werden die meist männlichen, erwachsenen Narzissten als perfide, arrogante und rücksichtlose Typen beschrieben, vor denen man/frau sich schützen muss. Sie werden entweder dämonisiert oder lächerlich gemacht und wirken dann in der Buchbeschreibung oft wie die Erwachsenenversionen von verwöhnten und egozentrischen Kindern, die sich vor der Kasse im Supermarkt auf den Boden werfen und toben, wenn sie den Lolli nicht bekommen. Solche Fieslinge gibt es ganz sicher unter uns Männern (Frauen?), aber ob dann ein Buch von Leyla Loric und Richard Grannon4 mit dem Titel »Wie man sich an einem Narzissten rächt: Hole dir deine Macht zurück, indem du die geheimem Techniken der emotionalen Manipulation gegen ihn richtest« für das Problem hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. Was Ihnen sicher auch aufgefallen ist, ist diese kriegerische und etwas theatralische Wortwahl in den Buchtiteln, die den amerikanischen Leser auf eine Art Geschlechter-Gemetzel zwischen zwei Buchrücken vorbereitet.
Obige Beschreibung als »verwöhnt« und »egozentrisch« kommt dem herkömmlichen Bild des Narzissten in der Presse auch bei uns schon sehr nahe: grandios, selbstbezogen und ohne jegliches Einfühlungsvermögen für andere, anstrengend im Umgang und oft von der Marke »Kotzbrocken«. Derartige Menschen gibt es sicher einige in unserer heutigen Gesellschaft: klischeehafte Prototypen wie skrupellose Investmentbanker und karrieregeile Politiker – mittlerweile auch unter Frauen in Topberufen –, aber um diese Gruppe Menschen mit einer sogenannten »narzisstischen Persönlichkeitsstörung« solles hier nicht gehen. Dafür verweise ich gerne auf die vielfältige psychologische Literatur zu diesem Thema in einschlägigen Psychiatrie-Lehrbüchern. Dort ist alles sehr genau, differenziert und höchst wissenschaftlich störungsorientiert beschrieben – aber aus einer ganz bestimmten psychologischen Perspektive: aus der Defizitperspektive. Narzisst sein heißt in diesem klinischen Feld, eine psychische Störung im Rucksack durchs Leben zu tragen – Narzissmus ist im psychiatrischen Sinne eine Persönlichkeitsstörung, und Menschen, die die Diagnose »narzisstische Persönlichkeit« (F 60.8 im ICD-10)5 bekommen habe, sollten sich Hilfe bei meinen psychiatrischen und psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen holen. Ein bisschen milder betrachtet wird die »Störung« bei dem amerikanischen Psychoanalytiker Heinz Kohut, deutlich destruktiver und in der Nähe der Borderline-Störung siedelt sie Otto Kernberg an. Darüber werden Sie von mir an späterer Stelle etwas ausführlicher hören.
Was Sie hier erwartet
Wenn dieses Buch vieles von dem oben Benannten nicht ist – kein Selbsthilfebuch, kein Narzissten-Bashing-Buch, keine Kampfschrift gegen unmögliche Männer –, was soll es dann sein?
Ich möchte über uns »Normalos« und unsere Durchschnittsklienten/-patienten schreiben, über die alltäglichen Probleme mit dem Selbstwert und Selbstbewusstsein. Deshalb habe ich kein ausschließliches Sachbuch über die Psychotherapie des Narzissmus geschrieben, welches wir mit Distanz und reinem Fachinteresse lesen sollten. Ich will darüber nachdenken, warum wir alle manchmal auf der einen Seite kühl, distanziert, egoistisch und arrogant sind – echte »Kotzbrocken« und »Zicken« eben – und dann wieder schlecht abgegrenzt sind, nicht Nein sagen können und immer damit beschäftigt, wie die anderen uns finden – so echte »Ja-Sager« und »Gutmenschen«. Wirklich zufrieden sind wir sicher alle nicht mit diesen Seiten in uns – es passiert uns einfach unwillkürlich,würde Gunther Schmidt sagen. Aber warum sind wir manchmal so?
Ich behaupte an dieser Stelle einfach mal: Wir alle haben mehr oder weniger stark ausgeprägte »narzisstische Ecken und Kanten«, und die würden wir gerne besser verstehen und sicher auch ändern – oder nicht? Dafür biete ich Ihnen in diesem Buch ein paar Ideen und psychologische Konzepte an und möchte Ihre persönlichen Fragen zum sogenannten Narzissmus nicht auf einer populär-, sondern auf einer psychologisch-wissenschaftlichen Basis beantworten. Nur so wird es uns leichter fallen, auch unsere Patienten mit ähnlichen Anliegen und Persönlichkeitsmerkmalen zu verstehen und sie in der Therapie auf dem Weg der Änderung zu begleiten.
In einem nächsten Abschnitt des Buches habe ich eine kleine Pause vom Narzissmus-Thema eingeschoben und mich meinem Lieblingsthema Ich-Zustände (Ego-States) und Ego-State-Therapie gewidmet. Als ich mich beim Schreiben entschlossen hatte, die zwei Gesichter des Narzissmus mit dem hypnosystemischen Teilemodell für die Praxis zu verbinden, merkte ich, dass ich Ihnen nicht wieder, wie in vorigen Publikationen, die klassische Ego-Theorie von John und Helen Watkins präsentieren wollte – an die ich heute eine Reihe Fragezeichen knüpfe. In Ego-States, Seiten, Parts & Co. (Peichl 2023a) hatte ich schon kritische Einwände gegen die Theorie vorgelegt und möchte Ihnen nun hier im Buch einen neuen Zugang zu dem Teilemodell nahebringen. Dabei greife ich auf vertraute Theoreme des klassischen Modells zurück und verbinde sie mit meinen neuen Ideen aus dem Bereich des Neurokonstruktivismus. Ich hoffe, ich kann damit Ihr Interesse wecken.
Im Teil 4 verwende ich das Ego-State-Modell, um einen Überblick für die psychotherapeutische Arbeit mit den beiden Seiten der narzisstischen Selbstwertregulation zu geben. Dabei verzichte ich bewusst auf Rezepte oder »Gebrauchsanweisungen« und beschreibe nur den weiteren Rahmen. Ich bitte alle professionellen Leser, diese meine Ideen Ihrem Stil und Ihrer Arbeitsweise anzupassen. Das letzte Kapitel des Buches ist dann noch eine sehr persönliche Ermutigung sowohl für fachfachkundige Leser als auch für interessierte Laien und Betroffene, sich in 5 Punkten mit der eigenen Vergangenheit zu befassen und sich mit sich selbst zu versöhnen.
Für Schnellleser: Die Essenz des Buches
Im Folgenden finden sie eine kurze Revue meiner Gedanken und Vorannahmen, von denen sich Ihnen einige erst im Verlauf des Lesens voll erschließen werden.
Mein Narzissmusbegriff stammt aus der Persönlichkeitspsychologie, nicht aus der Krankheitslehre der Psychiatrie und auch nicht primär aus der Psychoanalyse. Das bedeutet: Narzissmus geht uns alle an und ist als Persönlichkeitsdimension bei jedem von uns mehr oder weniger stark ausgeprägt. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem sogenannten »normalen Narzissmus« – mit uns Normalneurotikern und unseren Patienten, die manchmal sehr unter Ihrer »narzisstischen Not« (Eidenschink 2024) leiden.
Ich möchte erkunden, wo die Grenzlinie zwischen gesunder Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Narzissmus verläuft und ob es so etwas wie »guten« und »schlechten« Narzissmus gibt.
Um die wildwuchernde Komplexität des Terminus »Narzissmus« zu reduzieren, konzentriere ich mich bei der Definition von »gesunder Selbstliebe« auf das uns allen vertraute Erleben, selbstbewusst, selbstfürsorglich und selbstliebend zu sein sowie ein Gefühl dafür zu haben, etwas Besonderes zu sein – einmalig und unverwechselbar (Malkin 2016).
So gesehen ergibt sich bei der Betrachtung der sichtbaren Charaktermerkmale der Menschen um uns herum ein sogenanntes »narzisstisches Spektrum« – mit Selbstverleugnung (Selbstlosigkeit) auf der einen Seite, mit Selbstsucht (Selbstzentriertheit) auf der anderen Seite und einem »beziehungsbezogenen Selbstbewusstsein« in der Mitte des Kontinuums.
In der Literatur werden zwei charakterliche Ausprägungen des Narzissmus unterschieden: der offene, grandios-exhibitionistische oder »kalte« Narzissmus und der verdeckte, verletzlichdepressive und »warme« Narzissmus. Ich frage mich: Wie können sich diese zwei Seiten einer Medaille im Laufe des Lebens entwickeln?
Und jetzt mein wichtigster Punkt als hypno-analytischer Teiletherapeut: Wenn, ganz generell gesprochen, ein Symptom (z. B. Migränekopfschmerz, Höhenangst, Impotenz oder Waschzwang usw.) im hypnotherapeutischen Denken nicht das Problem, sondern die Lösung für ein Problem ist – für welches verborgene Problem sind dann die Ausprägungen des offenen und verdeckten Narzissmus eine kreative und hochkompetente Lösung?
Welche Selbstanteile (Ego-States) bilden im Laufe eines Menschenlebens die innere Mannschaftsaufstellung, sodass Sie und ich und die Personen in unserer Umgebung mal arrogantselbstzentriert (offener Narzissmus) oder auch selbstlos-bescheiden (verdeckter Narzissmus) nach außen hin wirken – mal als flüchtiger Zustand, mal als verfestigter Persönlichkeitsstil. Wie sieht dann jeweils die Choreographie auf der inneren Bühne aus? Welche Selbstanteile auf der inneren Bühne eines Menschen erzeugen den arroganten oder selbstlosen Persönlichkeitsstil?
Ich lade Sie dazu ein, in diesem Buch mit mir zusammen all unsere Seelenwinkel zu durchforsten und zu schauen, inwieweit auch wir bisher auf narzisstische Lösungsstrategien für Selbstwertprobleme zurückgegriffen haben bzw. noch zurückgreifen. Bald werden Sie sehen, dass es manchmal auch gut (sagen wir besser: hilfreich) ist, Narzisst zu sein – zumindest eine Zeit lang, um in dieser Welt zu überleben.
2Wo auch immer im Buch männliche Personen auftauchen, dürfen sich immer auch alle anderen Geschlechter gemeint fühlen.
3Ich denke an das Buch Die narzisstische Gesellschaft von Maaz (2014).
4Originaltitel des Buches: How to take revenge on a narcissist: Take your power back by using the secret techniques of emotional manipulators – against them (2015).
5Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ist das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem der Medizin. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben. Die aktuelle, international gültige Ausgabe ist ICD-10, Version 2013.
6Vgl. Schmid 1994.
7Verfügbar unter: https://schematherapie-rhein-ruhr.de/schemata-nach-j-young/ [1.9.2025].
8Mit der Bezeichnung »innere Menschen« ist die Tendenz zur Verdinglichung im Teilekonzept auf die Spitze getrieben worden.
Teil 1: Narzissmus als Problem
»Jeden Morgen, wenn ich erwache,
erlebe ich die allergrößte Freude:
nämlich die, Salvador Domingo
Felipe Jacinto Dali i Domenéch zu sein!«
Salvador Dali
1 Formen und Dimensionen des Narzissmus
In diesem Kapitel beschreibe ich die verschiedenen Formen und Dimensionen des Narzissmus – insbesondere die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) – und diskutiere deren Klassifikationen und Subtypen. Wichtig ist hierbei die Debatte darüber, ob Narzissmus als dimensionale oder kategoriale Konzeption zu verstehen ist, da er eine hohe Komorbidität und variable Erscheinungsbilder aufweist. Zur Veranschaulichung der diagnostischen Vielfalt nehme ich Bezug auf Arbeiten unterschiedlicher Autoren.
Die sog. narzisstische Persönlichkeitsstörung (im Folgenden NPS) wurde im Jahr 1980 ins Klassifikationssystem psychiatrischer Störungen (DSM-III)9 aufgenommen. Es dauerte gar nicht lange, da häuften sich die Bedenken – v. a. von Psychiatern und ihren Berufsverbänden –, dass die im DSM-III beschriebenen Kriterien für die Störung viel zu eng gefasst seien und für deren Varianten keinen Platz ließen. Darin spiegelte sich auch eine Ablehnung der durch die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie Otto Kernbergs dominierten Beschreibung der Störung, die von Anfang an wegen der Zentrierung auf die Innenperspektive der Krankheit heftige Kritik erntete. Der positive Aspekt dieser Diskussion war aber, dass ein Interesse an dem Thema erwachte und erste substanzielle Forschungsarbeiten aus Kliniken und Universitäten veröffentlicht wurden, vor allem aus dem Bereich der quantitativen Persönlichkeitsforschung. Die Uneinigkeit über die Dimension der Störung bestand weiter, und so wurde die narzisstische Persönlichkeitsstörungnicht als spezifische Persönlichkeitsstörung ins ICD-1010 aufgenommen.
Obwohl die DSM-V-Diagnosekriterien für NPS als homogen gelten, gibt es eine Vielzahl von Subtypen, die für die Klassifizierung von NPS verwendet werden. Es gibt kaum einen Konsens darüber, wie viele Subtypen es gibt, aber es herrscht eine breite Akzeptanz, dass es mindestens zwei sind: grandioser bzw. offener Narzissmus und verletzlicher bzw. verdeckter Narzissmus. Allerdings ist keiner der Subtypen von NPS im DSM-5 oder im ICD-11 anerkannt.
Millons Taxonomie
Im Jahr 1996 schlugen die US-amerikanischen Psychologen Theodore Millon und Roger D. Davis verschiedene Subtypen der NPS vor, ohne jedoch spezifische Behandlungsansätze für jeden Subtyp zu benennen. Sie gingen davon aus, dass Narzissmus nicht einheitlich ist, sondern unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Ihre Klassifikation umfasst folgende 6 Subtypen:
charakterloser/prinzipienloser Narzisst (unprincipled N.):
mangelndes Gewissen; skrupellos, amoralisch, illoyal, betrügerisch, arrogant, ausbeuterisch; kann ein Hochstapler und Scharlatan sein (auch straffauffällig); im Beruf oft erfolgreich
amouröser Narzisst (amorous N.):
sexuell verführerisch, verlockend, betörend; schlagfertig und klug; Abneigung gegen echter Intimität, kann sich nicht auf tiefe Beziehungen einlassen kann; zahlreiche Affären, krankhaftes Lügen und Schwindeln
kompensatorischer Narzisst (compensatory N.):
versucht, tiefe Minderwertigkeitsgefühle, mangelndes Selbstwertgefühl, Scham und Selbstzweifel zu kompensieren; gleicht Defizite aus, indem er sich einbildet, überlegen, außergewöhnlich, bewundernswert, bemerkenswert zu sein (grandioses Selbst)
elitärer Narzisst (elitist N.):
erscheint mit überhöhtem Selbstwertgefühl; ist angeberisch und selbstbezogen; strebt nach sozialem Erfolg und ist süchtig nach Bewunderung; fühlt sich aufgrund seines besonderen Status in der Kindheit und seiner »Fähigkeiten« privilegiert und ermächtigt
normaler Narzisst (normal N.):
Die narzisstischen Seiten sind hier am wenigsten schwerwiegend ausgeprägt; ist deutlicher auf die zwischenmenschliche Ebene bezogen und ist meist empathisch; oft eine Spur berechnend mit einem Mangel an Gegenseitigkeit; erscheint seiner Umgebung kühn, selbstbewusst, wettbewerbsorientiert, strebt nach hohen Zielen, fühlt sich oft (verdeckt) als einzigartig; Talent in Führungspositionen;
fanatischer Narzisst (fanatic N.):
Millon beschreibt diesen Subtyp der NPS als eine grundsätzlich strukturell defekte paranoide Persönlichkeit mit prototypischen narzisstischen Merkmalen, die tief miteinander verwoben sind (s. Millon 1998, S. 98); daneben paranoide Züge, die ein niedriges Selbstwertgefühl und Bedeutungslosigkeit durch Omnipotenzillusionen kompensieren. »Leider werden diese Ansprüche auf Größe, Bedeutung und Macht von anderen leicht als das erkannt, was sie sind; daher entfremdet sich der fanatische Narzisst nur noch mehr von sich selbst, indem er oder sie so sehr versucht, ernst genommen und geglaubt zu werden« (ebd., S. 98–99).
Diese Taxonomie soll zeigen, dass für die beiden Autoren das Phänomen »Narzissmus« von gesunden bis zu pathologischen Formen reichen kann und dass es dabei verschiedene Muster und Schweregrade geben kann. In ihren Arbeiten verorten Theodore Millon (1998) und Roger Davis (Millon a. Davis 2000) die Entstehung der narzisstischen Störung nicht so sehr in Richtung einer biologischen Ursachentheorie, sondern in der Kindheit. Sie vermuten, dass diese Menschen in ihrer frühkindlichen Entwicklung unzureichende Liebe und Anerkennung von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen erhalten haben. Deshalb leiden sie oft lebenslang unter diesem Mangel und geben ihre Reaktionen auf ihre Entbehrungen interpersonell an andere weiter.