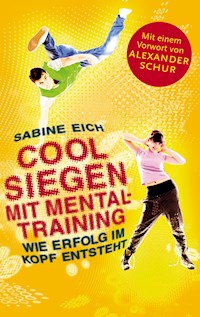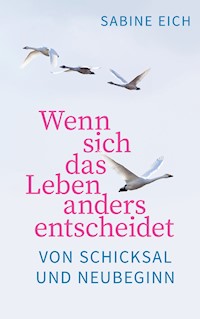
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In ihrem vierten Buch widmet sich Sabine Eich verschiedenen Schicksale. Sie erzählt ergreifende Geschichten, die man in der Gesamtschau in dieser Form nicht kennt. Viele Menschen haben eine Vorstellung von ihrem Leben: Heiraten, eine Familie gründen oder einfach nur in Frieden leben. Doch was, wenn plötzlich alles anders kommt? Wenn das Leben eine andere Wendung nimmt? Wer über eine hohe Selbstwirksamkeit verfügt, kann in seinem Leben viel steuern und gestalten. Auf das Schicksal jedoch haben wir keinen Einfluss. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen, wenn Träume zerplatzen, wir einen nahestehenden Menschen oder all das verlieren, was für uns Heimat und Familie bedeutet. Dieses Buch soll zeigen, dass es Hoffnung und Möglichkeiten der Bewältigung gibt. Es soll Menschen, die solche oder ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben, das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, und ihnen eine Idee vermitteln, wie sie wieder nach vorne schauen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Anne M. Lang: Dieses Buch handelt von „Schicksalshelden“
Achtung Planänderung!
Ein starkes Dreierteam: Leben mit einem mehrfach schwerstbehinderten Kind
Auf der Suche nach der Zukunft: Ahmeds lange Reise
Vergessen kann eine Gnade sein. Eine demenzkranke Mutter und ein Vater, der unerwartet an Krebs verstirbt
Als Erwachsener zurück ins Kinderzimmer: Ein Verkehrsunfall mit Folgen
Leben und Tod eines schwerstbehinderten Kindes, Depressionen, Insolvenz und Neubeginn
Wenn das Leben so weitergeht, dann danke! Diagnose Krebs nach dem plötzlichen Tod der kleinen Tochter
Brustkrebs und der Tod zweier Brüder
Einordnung der Erzählungen
Der Einfluss von Schicksalen und Diagnosen auf die Persönlichkeit
Was immer trägt: Werte
Stabilisatoren trotz und in Krisen
Fähigkeiten, die einen Schicksale meistern lassen
Und trotzdem: Eigene Ziele im Auge behalten
Schattenseiten
Auswirkungen und Veränderungen durch Corona
Botschaften: Was wir anderen sagen möchten
Familie als Schicksal – Wie es bei uns ist, ist es normal!
Dieses Buch handelt von „Schicksalshelden“
Für ihr Buch hat Sabine Eich in erkundenden Begegnungen mit Menschen deren Schicksalsschläge und deren Erzählung darüber zusammengestellt. Es sind die Erzählungen von Schicksalsbewältigern.
Sie haben einen ganz eigenen Umgang mit ihrer Situation gefunden, ihr Schicksal anzugehen und es dadurch lebendig zu gestalten. Man staunt beim Lesen und ist voller Hochachtung.
Was gab diesen Menschen die Kraft? Früher sagte man, Gott schickt einem das, was man bewältigen kann. Welch ermutigende, stärkende Deutung. Aber es scheint auch, als könne man an seinem Schicksal wachsen. Es sind besondere Geschichten und im Nachhinein erzählt. Im jeweiligen Moment wird es hart, tragisch, schwer zu nehmen gewesen sein. Die Helden laden uns ein, daran zu denken, dass es ein „Nachher“ an Entwicklung geben wird. Sie erzählen von der Resilienz, die Menschen haben und auch erwerben können.
Sabine Eich begegnet ihnen offen und empathisch, und es entstehen dadurch ergreifende Geschichten. Diese hört man in der Gesamtschau und im Prozessrückblick sonst nicht so am Stück. Es war nötig, das einmal zu Papier zu bringen bzw. diesen Lebensereignissen Gehör zu verschaffen. Hier geht es um erarbeitetes Umgehen und Bewältigung.
Herausgekommen ist ein Buch über Menschen, die Helden und gleichzeitig Leute wie du und ich sind. Sie erzählen uns davon, wie sie den unvorhergesehenen tragischen Lebenssituationen begegneten, wie ihr Leben davon geprägt wurde und welchen Umgang sie entwickelten. Und das oft für längere Zeit. Die Fülle der Schicksalsbeispiele, die mitten aus dem Leben sind, kennt thematisch jeder Mensch – sie haben alle etwas gemeinsam, doch die Bewältigung erfolgte immer individuell.
So geballt zusammen in einem Buch gefasst, bewirken sie Betroffenheit und großen ergreifenden Respekt. Das Schicksal betrifft Angehörige, Eltern, Kinder und natürlich die jeweiligen Protagonisten, wobei jede Perspektive Respekt bekommt. Wir lernen lesend, dass es immer ein Umgehen gibt und Menschen über sich hinauswachsen können. Das zumindest aus dieser Erzählperspektive. Im Lebensmoment selbst ist es dann einfach Leben „annehmen“ und Leben „leben“.
Es sind Lebensfacetten, die man sich nicht wünscht, die aber zum Leben dazugehören und jeden treffen können bzw. auch getroffen haben. Sie werden dann zu seinem gestalteten Leben werden.
Hier sehen und hören und spüren wir, wie fast selbstverständlich Menschen im Nachhinein diese Situationen lösten, aber auch welch schwerer Weg sie im Prozessverlauf dazu brachte, das Schicksal anzunehmen.
Diese Themen verdienen unsere Beachtung. Wer sie tabuisiert, vergibt die Chance, Bewältigung zu lernen, sich selbst wiederzuerkennen und Mut für das eigene Leben zu schöpfen.
Es sind Situationen, die in jedem Leben vorkommen können.
Gut, wenn wir dann von anderen Beispielen wissen.
Gut, wenn unser Verständnis für andere in diesen Situationen wächst.
Gut, wenn wir alle dadurch gestärkt werden.
Ein sehr dichtes, sehr offenes, sehr nachdenklich machendes Buch über das Leben.
Und insofern ein sehr gutes Buch für jeden!
Bonn im Juni 2021, Anne M. Lang, AML Institute Bonn
Achtung Planänderung!
Ein starkes Dreierteam: Leben mit einem mehrfach schwerstbehinderten Kind
Wenn man Danica und Martin, die Eltern von Marko, kennenlernt, schlägt einem die Herzlichkeit der beiden regelrecht entgegen. Vor einem stehen zwei offensichtlich glückliche Menschen, die anderen mit unglaublicher Offenheit begegnen. Man spürt die Bodenständigkeit und auch die ‚Wir-packen-es-an-Mentalität‘. In allem, was sie tun und sagen, ist eine unfassbare Liebe zu ihrem Sohn Marko zu spüren. Wenn sie von ihm erzählen, leuchten ihre Gesichter – mit Begeisterung zeigen sie Bilder, die ihn während verschiedener Ereignisse zeigen: bei der Firmung, seiner Kommunion, im Wasser bei der Delfintherapie, auf einer Klassenfahrt.
Marko reist oft und gerne mit seinen Eltern in den Urlaub: in die Türkei, nach Spanien, nach Italien – Generalaudienz beim Papst inklusive – Kroatien und Serbien. Er mag die Wärme.
Markos größte Stärke ist seine Sturheit. Er zieht durch, was er sich wünscht, und hat viel innere Kraft.
Doch was so selbstverständlich klingt, ist es nicht. Marko ist mehrfach schwerstbehindert. Er sitzt im Rollstuhl, kann sich kaum bewegen, nicht sprechen, ist blind und geistig beeinträchtigt. Er äußert sich durch Gesten und Laute, lacht herzlich, wenn ihm etwas gefällt, und schreit, wenn er etwas nicht mag. „Er hört, wenn er hören will“, sagt sein Vater Martin lachend.
Mittlerweile ist Marko 22 Jahre alt, ein erwachsener junger Mann, der unter der Woche in einer Pflegeeinrichtung für junge Menschen mit neurologischen Einschränkungen lebt und am Wochenende bei seinen Eltern. „Dann ist immer Halligalli“, sagt Danica.
Danica ist gelernte Altenpflegerin und Martin Architekt. Sie lernten sich kennen, als Danica ein Haus bauen wollte, und es dauerte nicht lange, bis der Funke übersprang. Dass der Funke immer noch da ist, sieht und spürt man, wenn sie sich anschauen, und daran, wie sie miteinander umgehen. Beide sind Realisten, die das Leben nehmen, wie es kommt, Menschen auf Augenhöhe begegnen, keinerlei Vorurteile hegen und zusammen durchs Leben gehen, egal, was es gerade zu bieten hat. Das und ihre Bodenständigkeit wurden zur Grundlage, das Leben mit einem mehrfach schwerstbehinderten Kind zu meistern. Was für andere ‚unnormal‘ ist, wurde für sie zur Normalität.
Als Danica schwanger wurde, freute sie sich auf Ihr Kind und wusste sofort: „Es wird ein Bub, und er heißt Marko.“
Marko kam am 6. April 1998 nach einer Notoperation in der 27. Schwangerschaftswoche im Offenbacher Stadtkrankenhaus zur Welt, Geburtsgewicht 750 Gramm.
Direkt nach der Geburt erlitt er Hirnblutungen vierten Grades, da die Gefäße nicht ausreichend entwickelt waren. Die Eltern mussten damit rechnen, dass alles passieren kann. Die Ärzte gingen davon aus, dass Marko die erste Nacht nicht überlebt. Im Laufe seines Lebens rieten sie den Eltern noch oft, sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Das würden sie jedoch niemals tun. „Erzählt, was Ihr wollt“, dachten sie sich. Und Marko kämpfte. „Der hat ihnen immer den Finger gezeigt“, sagt Danica, „der Marko ist ein echter Herkules“, sagt sein Opa.
Obwohl die Mutter als Altenpflegerin medizinisch vorgebildet ist und wusste, was die Diagnosen aussagten, überblickte sie das Ausmaß der Behinderung vorerst nicht.
Ein gnadenloses Procedere begann: Die ersten neun Monate verbrachte Marko ununterbrochen in Krankenhäusern, die gewechselt wurden „wie die Unterhosen". Es folgte eine OP nach der anderen. Als erstes bekam er einen Shunt(1) gelegt. Doch es kam zu einer Infektion, der komplette Shunt musste wieder herausgenommen werden.
Durch den hochdosierten Sauerstoff im Inkubator löste sich Markos Netzhaut. In der Folge erblindete er. Eine Augen-OP erfolgte in Frankfurt/Höchst. Zurück im Krankenhaus Offenbach infizierte er sich mit NEC(2).
Diese Bakterien, die jedes Neugeborenes im Darm hat, explodieren bei Frühchen durch das unausgereifte Immunsystem regelrecht und können dazu führen, dass der Darm platzt. Innerhalb einiger Stunden schwoll Markos Bauch so an, „dass man durchschauen konnte wie durch eine Glaskugel“, beschreibt Danica den Zustand.
Er wurde zur Not-OP in die Uniklinik Frankfurt geflogen. Es mussten einige Zentimeter Darm entnommen werden. Marko erhielt für drei Monate einen künstlichen Darmausgang. Auch hier gab es immer wieder Komplikationen: Verätzungen und wiederholt offene Hautstellen.
In der Kinderklinik Offenbach redeten die Ärzte offen mit den Eltern. Danica und Martin realisierten innerhalb der ersten vier Monate, dass Marko niemals ein gesundes Kind sein würde. In der ersten Zeit hatten sie daran zu knabbern und fragten sich: „Verdammt, wieso?“ Sie schüttelten diese Gedanken jedoch schnell ab: „Das Leben geht weiter, und wir schauen nur noch nach vorne.“ Komplikationen und Behinderungen sahen sie niemals als Belastung oder etwas Negatives, sondern wandten es ins Positive und kämpften fortan gemeinsam für eine Sache.
Die letzte OP wurde in Heidelberg durchgeführt. Die komplizierte Verlegung des Shunts aus den Gehirnventrikeln stand an. Im Vorfeld mussten sich Ärzte finden, die bereit waren, diese filigrane OP an einem Säugling durchzuführen.
Der Arzt erklärte im Vorfeld der OP, dass die Chancen 60:40 stünden. Markos Mutter erinnert sich noch heute, wie sie im Keller des Heidelberger Krankenhauses saß, vor der OP-Tür, den Kopf im Genick, die OP-Schwestern immer wieder herauskamen und sie informierten, dass alles gut läuft und Marko stabil ist. Zu diesem Zeitpunkt war Marko acht Monate alt. Dieser Shunt hält bis heute.
Zurück zur Normalität
„Wenn man nur bei Ärzten und in Krankenhäusern unterwegs ist, verliert man irgendwann den Bezug zur Normalität und Realität.“ Danica wollte wieder anfangen, in Vollzeit zu arbeiten, weil sie diesen Alltag benötigte. Viel Unterstützung erhielt sie von Anfang an unter anderem von ihrer Mutter, die auch als Altenpflegerin arbeitete. Fortan übernahm die Oma die Nachtschicht, und die Mutter kümmerte sich tagsüber, um Marko rund um die Uhr versorgen zu können.
Weil alle immer offen und positiv mit der Situation umgingen, erlebten sie niemals Ablehnung. Wo sie sich auch in der Welt aufhalten, ist ihre Haltung immer: „Hey wir sind da, was geht ab?“
Die Sehnsucht nach einem gesunden Kind gab und gibt es nicht. „Wir sind glücklich mit dem Kerl, wie er ist“, sagt Danica und strahlt dabei. Und auch für Martin ist alles gut so, wie es ist, und auch er strahlt, wenn er von seinem Sohn spricht.
Mehr Zeit zum Durchatmen: Kindergarten und Schulzeit
Mit drei Jahren kam Marko in einen integrativen Kindergarten, zuvor wurde er von einer Tagesmutter bis zum Nachmittag betreut, zusammen mit zwei weiteren Kindern und einem Hund. Marko fand das cool, auch die Zeit im integrativen Kindergarten verlief optimal.
Mit sechs Jahren stand die Einschulung an. Da er Offenbacher ist, schickte das Schulamt Marko auf die Fröbelschule(3). Diese Schule bot jedoch keine Möglichkeiten für die Förderung von sehbehinderten Kindern. Die Eltern setzten durch, dass Marko die Johann-Peter-Schäfer-Schule – eine Einrichtung für Blinde und Sehbehinderte – in Friedberg besuchte. Dort lebte er fünf Tage die Woche im Internat und kam am Wochenende nach Hause.
Während der Eingewöhnungsphase konnte die Mutter im Internat übernachten. Marko machte es sich und anderen nicht leicht: „Er war ein Kreischer, er war rebellisch und hatte seinen eigenen Kopf.“ Die Betreuer mussten sich erstmal auf Marko einstellen. Durch seine mehrfache Schwerstbehinderung kann er sich nicht wie gesunde Kinder mitteilen. Mit der Zeit und wenn man sich öffnet, kann man ihn gut verstehen lernen und spüren, wie er wann auf was reagiert.
Die ersten drei Monate waren die Eltern auf Abruf, bis er sich eingewöhnte und Freunde fand. Auch unter den Jugendlichen mit Behinderung fanden Kloppereien statt. Einmal erwischte Marko den Finger eines Schulkameraden und biss zu, im Gegenzug kratzte dieser ihm so übers Gesicht, dass Marko aussah, als hätte ihn eine Katze angefallen. Die Eltern sehen das gelassen: „Da müssen die Jungs durch. Das ist wie bei anderen Kindern auch. Sie kloppen und vertragen sich wieder.“ Bis zum Ende des zwölften Schuljahres besuchte er diese Schule.
Bei der Finanzierung der Schule kamen die Ämter ins Spiel, der Landeswohlfahrtsverband, die Krankenkasse, Sozialämter usw. Der Kampf mit den Ämtern zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben der Familie. In kurzen, aber regelmäßigen Abständen kommen Briefe von verschiedenen Ämtern, die beantwortet und bearbeitet werden müssen.
Seit Marko volljährig ist, sind die Eltern die offiziellen Betreuer. Die mehrfache Schwerstbehinderung muss immer wieder neu attestiert werden, auch seine Blindheit muss immer wieder nachgewiesen werden. Regelmäßig müssen die Eltern mit ihrem Sohn vor das Amtsgericht, um erneut feststellen zu lassen, dass sie seine amtlichen Betreuer sind.
Ganz normal schwerbehindert
Marko wird von seinen Eltern wie ein gesundes Kind behandelt: „Wir behandeln ihn ganz normal, weil es für uns ja auch normal ist.“ Sie gehen forsch vor, verstecken ihn nicht und machen dadurch nur selten schlechte Erfahrungen mit der Resonanz anderer.
Ab dem 16. Lebensjahr gab es die pubertären Phasen, wie bei anderen Jugendlichen auch: „Maulerei und Stänkerei auf seine Art und Weise. Es gibt sich nichts gegenüber einem gesunden Jugendlichen“, sagt der Vater, „weder von der körperlichen, organischen Seite her – geistig ist es nicht zu beurteilen.“
Marko ist älter und ruhiger geworden. Er macht seinen Eltern deutlich, dass er wie jeder erwachsene Mensch auch mal seine Ruhe haben möchte.
Alle haben sich im Laufe der Zeit zusammen weiterentwickelt. Jedoch richten die Eltern nicht alles auf Marko aus. Die Eltern benötigen ihr Leben als Paar und ihre Auszeit. Einmal im Jahr fahren sie für eine Woche in den Skiurlaub.
„Das Wichtigste in der Partnerschaft ist, über alles reden zu können“, sagen sie.
Betreuungseinrichtung vs. Betreuung zu Hause
Markos Eltern setzten sich früh mit den Schulen und Einrichtungen auseinander und sprachen mit den dortigen Erziehern. Diese erklärten in den vorbereitenden Gesprächen wiederholt, wie gut sich Kinder mit Behinderungen sozial entwickeln.
Marko
Auch wenn es für andere oft so aussieht, als würde man sein Kind abschieben. „Wir hätten Marko nichts Besseres geben können“ sagen sie rückblickend. Marko wusste jederzeit, dass seine Eltern immer für ihn da sind und zur Not auch mitten in der Nacht kommen, wenn sie von der Internatsleitung angerufen werden.
Gerade die Zeit auf dem Internat gab ihm die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln. Wie gesunde Kinder erhielt Marko Zeugnisse für sein Sozialverhalten. Von den Lehrkräften und Betreuern wurde seine Entwicklung in Berichten festgehalten. Sie sahen ihn als willensstark, aufmerksam, zum Teil ungeduldig, aber doch sozial aufgeschlossen an. „Marko hat aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen“, sagt Martin.
Nach der Schulzeit: Auf der Suche nach einer Pflegeeinrichtung
Vor der Beendigung der Schule wurden Pflegeeinrichtungen besichtigt. Die Schulleitung wies die Eltern rechtzeitig vor Ende der Schulzeit immer wieder auf diese Notwendigkeit hin. Leider gab es andere Eltern, die das nicht für notwendig hielten. Zwei Familien, die sie kannten, fanden schließlich nur noch einen Platz in Heimen, in denen ihre Kinder nicht gut versorgt wurden. Martin und Danica erlebten, wie die Kinder ein paar Monate später starben.
Für beide ist es grundsätzlich nicht nachvollziehbar, dass Eltern ihre behinderten Kinder nicht auf ein Internat oder in eine Einrichtung geben: „Wenn die Eltern sich aufgrund von Krankheit oder Tod nicht mehr um ihre Kinder kümmern können, kommt eine riesige Problematik auf diese zu. Kinder, die erst dann in eine Einrichtung kommen, sind nicht in der Lage, sich sozial zu integrieren, und geben auf.“
Auf der Suche nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung für Marko machten sie eine leidvolle Erfahrung: Ein zweiwöchiger Probelauf in einem Heim verlief für Marko katastrophal. Die Pflegekräfte waren völlig überfordert, eine ausreichende Versorgung war nicht sichergestellt. Innerhalb weniger Tage wurde Marko mit einem Anfall und ausgetrocknet in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern holten ihn sofort aus dem Heim heraus und bekamen glücklicherweise einen Platz im Alten- und Pflegezentrum des Main-Kinzig-Kreises (APZ MKK)(4) in Rodenbach, in dem er heute noch lebt. Unterstützung erhalten sie vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau(5) . Einmal in der Woche kommt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter und kümmert sich um Marko, geht mit ihm spazieren. Für die Eltern eine wertvolle Entlastung, genau wie alle anderen Angebote des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, wie zum Beispiel der Familienbrunch, der Besuch im Wildpark oder der Jahresempfang.
(1) Mittels einer Untertunnelung der Haut wird ein Schlauchsystem durchgezogen. Hinter dem Ohr kommt die Ventileinheit zum Liegen. Die meist durch die Haut regelbaren „Ventile“ sorgen dafür, dass erst ab einer bestimmten Druckdifferenz zwischen Kopf und Bauch Hirnwasser abfließen kann.
(2) Nekrotisierende Enterokolitis (Abkürzung NEC oder NEK) ist eine Erkrankung des Darmes.
(3) Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung
(4) Die Einrichtung wird hauptsächlich über den Landeswohlfahrtverband und das Sozialamt finanziert. Ein Platz kostet aktuell € 6.500,– pro Monat. Das Konzept beinhaltet einen hervorragenden Pflegekraftschlüssel sowie ein Therapeutenteam vor Ort. Der Bereich Junge Pflege umfasst dreißig Plätze.
(5) Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau begleitet Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung.
Auf der Suche nach der Zukunft: Ahmeds lange Reise
Wer Ahmed begegnet, bemerkt sofort seinen wachen und interessierten Blick. Er zeigt sich anderen auf eine sehr angenehm zurückhaltende und doch offene Art und Weise. Man spürt sein echtes Interesse an Menschen. Ahmed kann Menschen ohne Vorurteile begegnen. „Ich bin so erzogen, dass ich niemanden verurteile, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Man kann nie verallgemeinern.“ Menschen, so sagt er, haben Vorurteile, da sie sich mit anderen und ihren Umständen nicht auseinandersetzen.
Freundlich, hilfsbereit, bescheiden, intelligent sind Adjektive, die man ihm schnell zuordnet. Er spricht so ausgezeichnet Deutsch, dass man auf die Idee kommen könnte, er lebte schon Jahrzehnte hier. Nichts lässt vermuten, wie sehr seine Lebenspläne Jahre zuvor durcheinandergewirbelt wurden und wie lange eine Reise von 4.000 Kilometern dauern kann.
Ahmed wurde am 1. Januar 1991 in Homs, der drittgrößten Stadt Syriens, geboren. Dort, im Herzen des Landes, ist er mit einem Bruder und vier Schwestern aufgewachsen. Gerechtigkeit spielte so eine große Rolle für ihn, dass er schon immer Rechtsanwalt werden wollte.