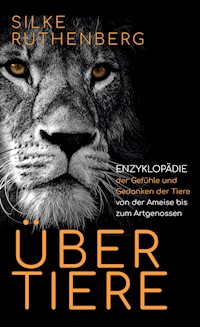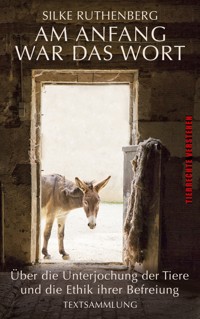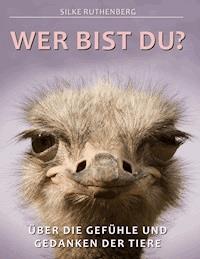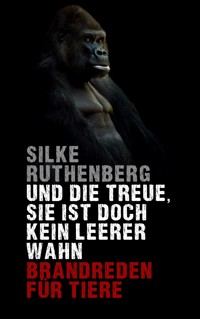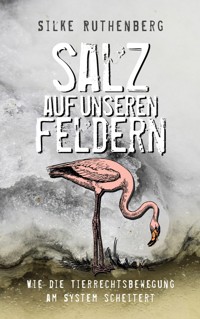
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist für die Mitglieder der Bewegung - und jene, die im Herzen schon bei den Tieren sind. Als die Römer Karthago zerstörten, so sagt es die Legende, streuten sie Salz auf die Felder: ein letzter Akt grundlegender Vernichtung. Was, wenn auch der Boden unserer Gesellschaft so vergiftet ist, dass die Saat der Tierrechtsbewegung nicht aufgehen kann? Seit über 200 Jahren ringt man in Deutschland um den Tierschutz, seit fast 50 Jahre um Tierrechte. Und doch bleiben die Erfolge beschämend überschaubar. Diese Sammlung streitbarer Abhandlungen legt offen, wie tief alte Mythen, ideologische Trägheit und moralische Selbsttäuschung selbst das Denken jener durchziehen, die sich dem Tierrecht verschrieben haben. Ein unbequemes Buch. Für alle, die wissen wollen, warum sich kaum etwas ändert - und was sich ändern müsste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort – Ein Überblick über den Status quo
TEIL 1
Grundsätzliches
Tierfreunde, Tierschützer, Tierrechtler – Der kleine Unterschied und seine großen Folgen
Von Nacktaffen und anderen Tieren – Warum ‚Mensch‘ und ‚Tier‘ keine harmlosen Begriffe sind
Tiere sehen dich an – Warum Solidarität mit ihnen so wichtig ist
Ein Appell an die Vernunft – Warum die Gefühle der Tiere nicht wichtig sind
Warum es Mord ist – Eine ethische Einordnung nach rechtlichen Kriterien
Vom Feudalherrenprivileg zum wahren Recht – Warum Tierrechte die Abschaffung der Menschenrechte erfordern
Die Freiheit der Anderen – Wie der Leberwurst-Liberalismus seine Werte zum Faustrecht verwurstet
Warum der Umweltschutz Tierrechte übersieht: Eine kritische Auseinandersetzung mit einem anthropozentrischen Konstrukt
Im Namen der Fledermaus ergeht folgendes Urteil
TEIL 2
Zerfall und Dekonstruktion
Chronik eines Verrates – Die hessischen Grünen vergraulen ersten amtlichen Tierschützer
Zerrspiegel – Wie die erste Tierrechtsreportage im deutschen Fernsehen zu einem Machwerk des tendentiösen Journalismus geriet
Öffentliche Hinrichtungen werden populär – und die Claqueure bejubeln den Backlash
Immoral Sanity und wenn Ideologie zum Metzger wird: Über Freikäufe und Prinzipienreiter
Vegan bei McDonald´s – Oder: Wie schreitet der Weltgeist voran?
Ein Schiff voller Tierfresser entzweit die vegane Community – Von richtigen und falschen Wertehierarchien
Vergesst Karnismus – Kritik an einem kontraproduktiven Strategiekonzept
Mord am Wort – Wie der Speziesismus zerstört wurde
Tugendwächter auf Abwegen – Ist man Speziesist, wenn man Tiere idealisiert?
Der Pieks und der Verrat – Wie die veganen Säulenheiligen im Coronajahr die Tiere verkauften
Der Hochverrat eines veganen Parvenüs
Zu weit gegangen! So verleumdete das Y-Kollektiv die Befreiungsbewegung der Tiere
Schlusswort
Nicht überall, wo Tierrecht draufsteht, ist Tierrecht drin
Vorwort – Ein Überblick über den Status quo
Die Realität setzt sich nicht von alleine durch, sie braucht eine Stimme. Das gilt natürlich auch für die Realität, die die herrschende Spezies der unterworfenen Tierheit bereiten und die einige Menschen verändern wollen.
Im Nachkriegsdeutschland entwickelte sich erst Ende der siebziger Jahre eine politisierte Tierrechtsbewegung, nachdem vergleichbare Bestrebungen mit radikalem und veganem Anspruch in der Weimarer Republik mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten eliminiert wurden. Wir blicken damit auf bald ein halbes Jahrhundert aktiver politischer Tierrechtsarbeit zurück. Doch die Resultate sind dürftig. Für die Betroffenen ist zumindest quantitativ die Lage deutlich schlimmer geworden. Die Schlachtzahlen in Deutschland haben sich in dieser Zeit verdoppelt. Andererseits kennt heute jeder den Begriff „vegan“ und das Label hat in einer sensationellen Weise die Supermärkte erobert. Wir haben unzählige vegane Restaurants und fast überall vegane Optionen – vegan ist zum Bestandteil unserer Kultur geworden. Auch der karitative Tierschutz heute grundsätzlich deutlich besser da. Was vor 50 Jahren noch die schrullige Marotte mannloser älterer Damen war, ist heute anerkanntes Engagement. Und nicht nur das Retten von Katzen und Hunden ist akzeptiert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Reservate für Hühner und Schweine, Bären und Rinder, die mitten in der Tyrannei todesbedrohten Tieren ein würdevolles und sicheres Zuhause bieten, und damit die Idee der Tierrechte Gestalt annimmt. Die Hölle selbst haben wir leider nicht heller machen können.
Seit Jahrtausenden ist die Stimme der Täter ohrenbetäubend, während die Opfer vom Diskurs ausgeschlossen sind und nur von wenigen Tierbewegten irgendwie und eigentlich mehr schlecht als recht vertreten werden. Dabei hat es zu allen Zeiten Widerspruch gegeben. Bereits in der Antike gab es Philosophen, die das Misshandeln und Töten von Tieren verurteilten. Das Nein zur Unterjochung, Ausbeutung, zum Pogrom an der Tierheit war immer da, aber es ist an der Entschlossenheit der Gewalttäter, die blutig über die Tierheit herrschen wollten, bis heute gescheitert. Diese halten bis heute die wirklichkeitsstiftende Macht in den Händen, und auch deshalb macht die Masse mit.
Die Spieltheorie gibt uns diesbezüglich einen interessanten Erklärungsansatz: Sie vergleicht uns mit Bakterien in einem Teich: Etwa 10% dieser Bakterien sind „gute“ Bakterien, die für ein gesunde Ökosystem unerlässlich sind. Genau so viele sind „schlechte“ Bakterien, die das Potential haben, ein Gewässer kippen zu lassen. 80% Bakterien sind grundsätzlich neutral. Wenn die „guten“ Bakterien gegenüber den „schlechten“ überwiegen, werden die eigentlich neutralen Bakterien zu „guten“ Bakterien und stabilisieren das Gewässer. Dominieren allerdings die „schlechten“ Bakterien gegenüber den „guten“, so orientieren sich die neutralen Bakterien um und werden zu „schlechten“ Bakterien. Dann kippt das Gewässer.
Das ist in der menschlichen Gemeinschaft nicht viel anders. Die breite Masse ist eigentlich „neutral“, was nichts anderes bedeutet, als dass sich diese 80% an der Macht orientieren, je nachdem, welcher Meinungsflügel die Deutungshoheit hält, weil er – oft nur geringfügig – stärker ist. So haben wir beispielsweise einen verhältnismäßig kleinen prozentualen Anteil an echten Tätern: Jäger, Metzger, Fischer, Angler, Züchter und Bauern, Schlachthausbetreiber, Vivisektoren, Zoobetreiber , Tierhändler usw., also diejenigen, die ein unmittelbares und persönliches Interesse daran haben, dass Tiere rechtlose Verfügungsmasse sind, weil sie sich auf ihren Knochen gesundstoßen bzw. einen substantiellen Vorteil daraus ziehen.
Bis heute sind diese Täter und Nutznießer realitätsbestimmend, während die Tierbewegten mit ihrer Überzeugung schwächer und zahlenmäßig weniger sind. Deshalb – so deutet es die Spieltheorie – orientiert sich die Masse an den Gewalttätern an den Tieren. Sie tun dies nicht aus echter Überzeugung, sondern machen aus Opportunismus mit: besuchen Zoos, tragen Lederschuhe, fressen Lämmchen. Und auch wenn sie sich selbst die Hände nicht blutig macht, reagiert diese schweigende und mittuende Masse auf genau zwei Arten: Entweder identifizieren sich die mampfenden Mitläufer mit den Tätern, obwohl sie selber unmittelbar gar keine sind. Sie bilden die ideologische Vorhut und machen sich zu den Fürsprechern und Vertretern der Gewalt gegen Tiere. Oder sie sagen, dass sie es auch nicht gut finden, wie Tiere misshandelt werden – während sie sich trotzdem dem herrschenden System anpassen und an der Fleischtheke die Putenbrust ordern. Sie sind korrumpiert und drücken ihre Unterwerfung aus, indem sie die Toten verdauen und vernutzen, während sie dabei eine scheinbar kritische Haltung zum Besten geben.
Warum ist das so? Menschen sind soziale Lebewesen, für die die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft einst überlebensnotwendig war und auch heute noch von großer Bedeutung ist. Die vielen Esskulturen (eigentlich ja Unkulturen) offenbaren, welch zentrale Rolle das Essen dabei spielt, um die Zusammengehörigkeit auszudrücken. Je nachdem, wie wichtig es dem Individuum ist, dazuzugehören, passt es sich den Gepflogenheiten an und entwickelt in Folge gegenüber Kritik die krudesten Abwehrstrategien. Das ist das eigentliche Phänomen des „Bullshitbingos“ und der im Grunde so unfassbar armseligen Gegenargumente, die kein Mensch mit einem Funken Verstand im Kopf eigentlich ernst meinen kann.
Die Macht aber hatte es noch nie nötig, sich mit guten Argumenten zu erklären. Macht kommt von machen. Wer dreist genug ist zu machen, hält die Macht. Wer etwas Gutes verhindern will, muss unfair spielen, und dazu gehört es, den Widersacher mit billigen Phrasen abzuspeisen und damit auch zu verhöhnen, und natürlich fällt darunter auch der Adhominem-Schlag unter die Gürtellinie.
Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch Studien, die nachgewiesen haben, dass das entsprechende Zahlenverhältnis offensichtlich eine Konstante ist, die nicht durch die herrschenden Verhältnisse in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Egal wie diese beschaffen sind, haben immer nur 10% das Potential, sich gegen die herrschenden Verhältnisse zu stellen – sei es durch Verweigerung, mitzumachen, oder durch aktiven Widerstand. 90% unterwerfen sich den herrschenden Machtverhältnissen und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob diese durch Lüge, Unheil und Unrecht getragen sind.
Am Inhalt liegt es also nicht. Offenbar handelt es sich hierbei um ein sozialpsychologisches Phänomen, das sich ausgebildet hat, damit Gruppen funktionieren. Eine Gruppe mit zu vielen Quertreibern wird über kurz oder lang zerfallen. Andererseits braucht eine Gruppe Außenseiter als Kontrollinstanz. Sie sind die kritische Stimme, die laut wird, wenn die Dinge in eine falsche Richtung laufen.
Man kann das Phänomen auch auf einer individuellen Ebene betrachten, je nachdem, welche Bedeutung das Wahre, Schöne und Gute im Leben eines Individuums hat und wie groß im Verhältnis dazu das Sicherheitsbedürfnis ist. Es ist nämlich vor allem das Sicherheitsbedürfnis, das uns zur stärkeren Gruppe und eben auch zur Mehrheitsmeinung drängt, und es ist die Bedeutung der Transzendenz, die uns die Kraft gibt, alleine zu stehen und zu widerstehen. Je nachdem, was in unserem Leben die stärkere Rolle spielt, verhalten wir uns massenkonform oder widerständlerisch.
Möglicherweise hat es auch etwas mit Dominanz zu tun. Primatologen von der University of St. Andrews und der Université Neuchâtel haben jedenfalls ein interessantes Phänomen bei Vertretern der Grünen Meerkatze in Südafrika entdeckt. In ihrer Studie versorgten die Forscher die Primaten mit Kisten voller Popcorn, das entweder blau oder rosa gefärbt war. Bei zwei Gruppen wurde das blaue Popcorn zuvor in einen pflanzlichen Bitterstoff getaucht, sodass es ungenießbar war. Natürlich bedienten sich die Meerkatzen schnell nur beim rosa Popcorn und verschmähten das blaue. Mit der gleichen Methode wurden dann zwei weitere Meerkatzengemeinschaften dazu gebracht, das rosa Korn zu bevorzugen. Wie erwartet, wurden die entsprechenden Präferenzen dann auch dem Nachwuchs beigebracht – sogar, wenn mittlerweile beide Popcorn-Farben genießbar waren.
Die entscheidende Entdeckung gelang den Forschern aber bei jenen heiratswilligen Männern, die in eine fremde Gruppe wechselten, die auf die jeweils andere Popcorn-Farbe geprägt war: Neun von zehn Männern passten sich an an und wechselten rasch zum anders gefärbten Popcorn. Die einzige Person, die die fremden Essgewohnheiten ignorierte, war ein Alpha-Mann, der sich an die Spitze der neuen Gruppe hatte setzen können. Mit hohem Status kann man sich offenbar mehr herausnehmen. Anpassung wird nur gegenüber Untertanen durchgesetzt. Quod licet lovi, non licet bovi – was den Göttern erlaubt ist, ist dem Ochsen noch lange nicht gestattet.
Vielleicht sollte man als Veganer deshalb die dummen Sprüche und Untergriffigkeiten nicht als persönlichen Angriff verstehen oder ihnen auf der argumentativen Ebene begegnen, sondern sie als Test erkennen, wie standhaft und stark man in seiner Rolle als Vertreter einer Mindermeinung ist. Wer die Position souverän halten kann und nicht in die Falle läuft, ist der Sieger.
All diese psychologischen Grundlagen sollte man kennen und berücksichtigen, wenn man sich mit Fragen politischer Strategien auseinandersetzt. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Punkt, den man sich verdeutlichen muss, wenn man sich nicht nur tiersolidarisch positionieren, sondern erfolgreich politisch wirken will. Hier möchte ich Max Frisch ins Boot holen, denn er hat das Grundsatzproblem in seinen Tagebüchern1 scharfsichtig auf den Punkt gebracht:
„Die ganze Erziehung, die nicht nur unsere Kirche, sondern auch unsere Schulen abliefern, geht wesentlich dahin, dass wir anständige Menschen werden, beispielsweise dass wir nicht stehlen – sie geht nicht dahin, dass wir uns wehren, wo immer gestohlen wird, und dass wir für das Gute, das sie uns lehrt, kämpfen sollen. Das Gute, wir wissen es, lässt sich allerhöchstens in deiner eignen Brust verwirklichen. Ein guter Gedanke, gewiss, gut für die Herrschenden.“
Politische Arbeit, die das Zusammenleben gestaltet, ist immer ein Streit um widerstreitende Interessen. Üblicherweise drücken sich im Diskurs die Meinungen über Interessensgruppen aus, die sich dabei allein aus Eigeninteresse Gehör verschaffen. Hier geht es nie um Werte oder Moral, sondern nur um Durchsetzung nach allen Regeln der Kunst. Die Teilnehmer der Auseinandersetzung verfolgen dabei eigene Ziele.
Die Sache der Tiere ist zweifelsohne ein Thema, bei dem es um widerstreitende Interessen geht, aber die Tiere sind vom Diskurs ausgeschlossen, und so gehen die diesbezüglichen Verhandlungen im vollen Umfang auf ihre Kosten. Die Partei der Menschen entscheidet in eigener Angelegenheit zu ihren eigenen Gunsten. Die Partei der anderen Tiere wird nicht angehört. Sie wird bestenfalls von freiwilligen Tierrechtlern vertreten, die unweigerlich aber auch zur Partei der Menschen gehören und damit zwangsläufig befangen sind. Wie soll da etwas Vernünftiges herauskommen? Es macht den Kampf um die Deutungshoheit und Interessensdurchsetzung zu einem ideologischen Kampf um das Gute. Diesen erfolgreich zu führen haben wir aber nie gelernt.
Nüchtern schreibt Max Frisch: „Man kann darauf bedacht sein, das Gute durchzusetzen und zu verwirklichen, oder man kann darauf bedacht sein, ein guter Mensch zu werden - das ist Zweierlei, es schließt sich gegenseitig aus. Die meisten wollen gute Menschen sein. Niemand hat größere Freude daran, wenn wir gute Menschen werden, als das Böse. Solange die Menschen, die das Gute wollen, ihrerseits nicht böse werden, hat das Böse es herrlich!“
Wer setzt sich für Tiere ein? Menschen, denen „das Gute“ wichtig ist und die genau deshalb umso mehr zum Scheitern verurteilt sind, weil ihre Intention, das Gute durchzusetzen, immer beinhaltet, ein guter Mensch zu sein. Genau damit hatte man uns als Kind diszipliniert. Die in Aussicht gestellte Belohnung, „wenn wir brav sind“ hat uns dahingehend geformt, auch als Erwachsene noch an den Weihnachtsmann zu glauben. Wir erhoffen uns, Ziele zu erreichen, wenn wir nur gut genug sind.
Welch verheerender Irrglaube! Die Guten denken, es ginge um Gut und Böse, während die Bösen wissen, dass es nur ums Siegen und Verlieren geht. Dazu schreibt Frisch: „Tägliche Erfahrung im Kleinen: Dein Anstand ist die beste und billigste Waffe deiner Feinde! Du hast dir versprochen, nicht zu lügen - zum Beispiel - und das ist schön von dir, splendid, wenn du es dir leisten kannst; es ist närrisch, wenn du dir einbilden würdest, dass du damit ohne weiteres der Wahrheit dienst. Du dienst deiner Anständigkeit.“ Und nüchtern stellt er fest:„Die Sittlichkeit, wie sie uns gelehrt wird, schließt immer schon die weltliche Niederlage in sich; wir retten die Welt nicht vor dem Teufel, sondern wir überlassen ihm die Welt, damit wir nicht selber des Teufels werden. Wir räumen einfach das Feld, um sittlich zu sein. Oder wir räumen es nicht; wir lassen uns nicht erschießen, nicht ohne weiteres, nicht ohne selber zu schießen, und das Gemetzel ist da, das Gegenteil dessen, was wir wollen […].“
Wir aber schießen nicht. Auf uns wird geschossen, in England gibt es bereits Tote auf unserer Seite zu beklagen, aber wir schießen nicht zurück. Möglicherweise wollen wir gar nicht siegen, sondern einfach nur gut sein und deshalb fordern wir uns auch noch gegenseitig zum Anstand auf. Wir lassen uns durch sittliche Forderungen fesseln und in die Ecke drängen. Es kann kein Zufall sein, dass uns die Täter und Mittäter dazu auch gern ermahnen.
„Womit arbeitet jeder Terror?“, fragt Frisch und gibt eine schlüssige Anwort: „Mit unserem Lebenswillen und also mit unserer Todesangst, ja, aber ebenso mit unserem sittlichen Gewissen. Je stärker unser Gewissen ist, um so gewisser ist unser Untergang. Je größer eine Treue, umso gewisser die Folter. Und das Ergebnis jedes Terrors: die Schurken gehen ihm durch die Maschen. Denn der Terror, scheint es, eignet sich besonders zur Vernichtung sittlicher Menschen.“
Und ja, wir leben im Terror. Im längsten und fürchterlichsten Terrorregime, das es je gegeben hat. Mit Milliarden von Opfern. Und wir stehen da, als gute Menschen, und spüren jeden Tag, dass es eben nicht ausreicht, selbst gut zu sein, und dass wir völlig hilflos und ohne Orientierung sind, wie wir uns selbst zu einem Werkzeug des Guten machen können, während die Täter Tat auf Tat setzen und damit ihre Macht Minute um Minute blutig beweisen. Meine Antwort darauf lautet: Wir müssen aufhören, gute Menschen sein, und im Befreiungskampf für die Tiere stattdessen zu einem scharfen Schwert werden. Wir müssen das Kämpfen lernen.
Die Tierrechtsbewegung in Deutschland begann Anfang der 80er Jahre, sie veganisierte sich in den 90ern. Sie starb langsam, als ihr Erfolg sich marktwirtschaftlich manifestierte und sich Geschäftsfelder eröffneten: vegane Kochbücher, vegane Restaurants, vegane Schuhgeschäfte, Hotels, Ernährungsberatungen. Man filmte Sterbende und verkaufte die Bilder ans Fernsehen, Influencer versuchten ihr monetäres Glück in den sozialen Netzwerken. Für Klickzahlen verkauft man den Anspruch und haut nichtsagende und wohlfeile Phrasen raus.
Und ja: man gründete auch spendenfinanzierte Lebenshöfe, die den Tierrechtsgedanken in die Praxis umsetzen und einzelnen todesbedrohten Rindern, Schweinen, Hühnern und anderen „Nutztieren“ ein Leben in Sicherheit und unter Wahrung ihrer natürlichen Rechte ermöglichen. In diesen neugeschaffenen Reservaten für die Überlebenden des Holocausts bewahrte sich der Geist des Tierrechts, wie er in den 80ern und vor allem 90ern in die Welt getragen wurde, und wird in seiner reiner Form umgesetzt. Doch ansonsten ging der geistige Anspruch des Tierrechtsgedankens gründlich verloren. Die in den 90ern geformten zentralen Begriffe wie Tierrechte, Veganismus und Speziesismus wurden umgedeutet, man protestiert heutzutage vorzugsweise dort, wo man sich der (oberflächlichen) Zustimmung der Bevölkerung eigentlich sicher sein kann. Nicht mehr vor Zoos, aber beim Zirkus. Nicht mehr für Lebensrechte der Tiere, aber gegen die grausame Massentierhaltung. Man traut sich noch nicht einmal mehr, klare Forderungen für die Tiere zu erheben. „Schließung aller Schlachthäuser“ steht auf den Transparenten und der Passant stimmt zu: Weideschlachtungen sind wirklich viel humaner. Stünde da „Lebensrecht für alle Tiere“ auf den Schildern, wäre so ein Missverständnis nicht mehr möglich. Aber warum schreibt man es dann nicht? Weiß man überhaupt noch, dass es beim Kampf um Tierrechte zentral um das Existenz- und Lebensrecht der Tiere geht und nicht um die Umgestaltung von Verhältnissen nach unseren Vorstellungen?
Als der vegane Koch und Hans im veganen Glück Attila Hildmann seine Frittenbude in Berlin bewarb, indem er einen Bauern mit einem Kalb und einer Ziege im Hänger für 500 Euro vor seinen Imbiß fahren ließ und die beiden für eine fragwürdige Wette und Selbstdarstellernummer missbrauchte, feierte ihn die Szene, weil er angeblich die Heuchelei anprangerte, dass die Leute zwar Fleisch essen, aber „die Pussys selbst nicht töten können“. Als ob es die Sache besser machen würde, wenn sie töten könnten! So entkernt ist das Tierrecht, dass man noch nicht mal selber merkt, dass bereits der Begriff Heuchler für Tatbeteiligung an einem Mord eine groteske Verharmlosung ist.
Maximale Empörung hingegen löste in dieser opportunistischen und weichgespülten Zeit ein Facebook-Post aus, in dem ein Bulle zum Helden erklärt wurde, weil er seinen Sklavenhalter getötet hatte. Geschlossen stand die Szene mit allen Funktionären auf der Seite der wutschäumenden Bauern – und gegen den Bullen. Spätestens ab diesem Moment war klar, dass das Tierrecht in Deutschland wirklich mausetot war.
„Wohlfühldemonstranten“ nannte Rezzo Schlauch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung entradikalisierte Protestler auf allen Ebenen. „Pickme-Veganer“ heißt es über die gefall- und harmoniesüchtigen Vertreter der Szene – zumindest bei den Radikaleren, die seit kurzem endlich wieder Land gewinnen. Es weht ein Hauch der 90er Jahre durch die Straßen. Man wird wieder radikaler mit den Strategien und den Argumenten aus den Anfängen der Tierrechtsbewegung. Die Vermarktung des Veganismus hatte eine Zäsur geschlagen und nun fängt man von vorne an, statt aufzubauen.
Dieses Buch soll helfen, ein vertieftes Verständnis für strategisches Arbeiten zu entwickeln und das Bewusstsein für die Fallen, leeren Phrasen und Denkfallen zu schärfen – um an das bisher Geleistete anknüpfen zu können und das Rad nicht wieder neu erfinden zu müssen. Es ist ein langer Marsch auf den Himalaya. Aber es liegt auch an uns, wie schnell wir vorankommen.
1 Dieses und die folgenden Zitate aus Max Frisch, Tagebücher, 1946-1949 Tgb. I, 565
TEIL 1
Grundsätzliches
In diesem ersten Teil des Buches geht es um die Grundfragen der Tierrechtsbewegung – und die Konflikte, die durch unreflektierte Perspektiven und Zielsetzungen innerhalb der Bewegung selbst entstehen.
Die Kapitel beschäftigen sich mit den Begriffen, die die Tierrechte definieren und hinterfragen gleichzeitig, wie diese Begriffe von der Gesellschaft und der Bewegung selbst ausgelegt werden.
Es geht nicht um das Warum der Tierrechte, sondern um das Wie: Wie setzen wir Tierrechte in einem gespaltenen und widersprüchlichen Umfeld um, von dem wir selbst so geprägt wurden? Welche ethischen und politischen Prinzipien tragen wir in die Bewegung, und welche hindern uns am Fortschritt? In den kommenden Kapiteln werden wir sehen, wie sich scheinbar einfache Differenzen zu tiefen Spaltungen entwickeln können und wie diese Spaltungen oft als Hindernis für eine effektive Veränderung wirken.
Tierfreunde, Tierschützer, Tierrechtler –Der kleine Unterschied und seine großen Folgen
Tierfreunde, Tierschützer, Tierrechtler – immer sind sie es, die den Mund aufmachen, wenn einem Tier Unrecht geschieht. jedenfalls, wenn man der öffentlichen Wahrnehmung und den Medien glauben will. Damit wird signalisiert: Es handelt sich um ein Spezialthema – ein Anliegen dieser einen Gruppe. Dass sich auch ganz normale Bürger mit einem Rest an moralischem Anstand empören könnten, wenn Tieren Gewalt angetan wird – das scheint unvorstellbar. Es geht sie ja schließlich nichts an.
Halten sich die so Etikettierten nicht an die ihnen auferlegten Anstandsregeln und sind zu laut, zu fordernd, eben irgendwie unangemessen störend, werden sie schnell zu ‚selbsternannten‘ Tierschützern erklärt – als hätten sie sich ein Amt angemaßt, das eigentlich jemand anderem zustünde. Doch wer wäre überhaupt legitimiert, solche Titel zu vergeben?
Die Etiketten sind flexibel einsetzbar: mal abschätzig, mal abwertend, mal verharmlosend – je nachdem, in welche Ecke man die Betroffenen drängen will. Man könnte solche scheinbaren Nebensächlichkeiten achselzuckend übergehen – aber Sprache wirkt. Worte formen Wirklichkeit. Deshalb hier ein paar Gedanken zum Inhalt dieser Begriffe und dem, was sie mittransportieren:
TIERFREUND
Tierfreund – das will jeder sein, wer bezeichnet sich schon freiwillig als Tierfeind? Und doch: sich als Tierfreund zu fühlen, tut nur einem selbst gut. Wer Tiere süß und putzig findet, kann doch kein schlechter Mensch sein! Es ist einfach herrlich bequem, Tierfreund zu sein. und es verpflichtet zu nichts.
Wie skurril dieser Begriff klingt, wenn er – in einer Art Lackmustest – auf Menschen angewendet wird, die das Unrecht an den Tieren nicht kaltlässt, zeigt ein Blick in die Geschichte. Die Ökonomie der Antike beruhte auf der Sklaverei. Im ersten und zweiten Jahrhundert begann sich jedoch ein Missgefühl zu regen. Forderungen wurden laut, man solle die Sklaven, die im römischen Recht als Sache eingeordnet wurden, doch bitte schonender behandeln. Philosophen appellierten ans Mitgefühl und rieten gewissermaßen zu artgerechter Haltung. „Sklaven wären es?“, ruft Seneca aus, „Nein! Vielmehr sind es ...Freunde!“ Ein emotionaler und zugleich wohlfeiler Aufruf – zu wenig und doch zu viel. Er erlaubt feuchte Augen, zwingt aber nicht zu grundsätzlichen Erwägungen. Er ist einfach nur sentimental.
Genauso verhält es sich mit der Titulierung Tierfreund, wenn Menschen gemeint sind, die sich ernsthaft für die Belange der Tiere einsetzen. Die Sache der Tiere wird bagatellisiert. Und das Engagement von Menschen, die keine Mühen scheuen, Tieren zu einem besseren Leben zu verhelfen, wird zum sentimentalen Zeitvertreib rührseliger Spinner trivialisiert.
TIERSCHÜTZER
Beschützen ist ein Urbedürfnis. Und es ist ein großes Glück, wenn einem in der Bedrängnis jemand zur Seite springt. Aber: Beschützen heißt auch, Macht haben. Wer schützt, hat die Kontrolle – wer beschützt wird, ist ausgeliefert. Das ist die Grundlogik jeder asymmetrischen Beziehung: Ein klassisches Macht-Ohnmacht-Verhältnis. Schützen kann nur der Mächtige, beschützt wird der Schwächere. Ob das nun gewollt ist oder nicht. Wenn der Tierschützer über das Tier spricht, sieht man in Gedanken die streichelnde Hand. Doch diese Hand schützt nicht vor dem Unrecht, das Menschen den Tieren täglich antun. Sie mildert höchstens die Qual – vielleicht auch nur, weil sie ihn selbst schmerzt.
Der Tierschutz bewegt sich innerhalb des gesellschaftlich akzeptierten Rahmens, der festlegt: Tiere sind für uns auf der Welt sind – nicht um ihrer selbst willen. Deshalb dürfen wir Tiere für unsere Bedürfnisse nutzen und auch ums Leben bringen, wenn es für uns einen Sinn ergibt.
Tierschutz fordert Gnade statt Gerechtigkeit. Er stellt die Machtverhältnisse nicht infrage – er verwaltet sie. Und gerade deshalb ist „Schutz“ ein fragwürdiger Begriff. Er festigt das Gefälle zwischen Mensch und Tier – der eine entscheidet, der andere hat zu erdulden. Denn eines glaubt der Tierschützer zu wissen: Das Tier steht unter dem Menschen. Würde es sich sonst beschützen lassen?
TIERRECHTLER
Tiere sind um ihrer selbst willen auf dieser Welt. Sie fühlen und denken, nehmen wahr, was um sie geschieht. Sie bewerten, entscheiden, handeln. Sie wissen, was sie tun. Sie streben nach Glück und Erfüllung und fürchten den Schmerz und den Tod. Als empfindsame und strebende Wesen haben sie ein unveräußerliches Recht – auf ihr Leben, auf Freiheit, auf Unversehrtheit. Was also unterscheidet den Menschen von den anderen Tieren? Nicht die Fähigkeit zu denken oder zu empfinden! Der Unterschied liegt allein im Anspruch: Der Mensch nimmt sich selbstverständlich, was er den Tieren selbstgerecht verweigert.
Der Tierrechtler widerspricht diesem Machtanspruch. Er fordert nicht Mitleid, sondern Gerechtigkeit. Nicht Gnade, sondern Gleichberechtigung. Tiere sind keine Mittel zum Zweck, sondern Subjekte mit eigener Würde. Sie leben mit dem gleichen Existenzrecht auf dieser Welt, das wir für uns selbst in Anspruch nehmen. Ihr Dasein hat einen Wert – für sie selbst – nicht nur einen Preis – für uns. Wir Menschen haben kein Anrecht auf sie, sondern die Pflicht, ihre natürlichen Rechte zu respektieren – so wie uns unter Menschen das Gesetz dazu zwingt.
ZOOPOLIST
Jedes fühlende, denkende Individuum ist – unabhängig von seiner Artzugehörigkeit – Träger natürlicher und unveräußerlicher Rechte. Doch mehr noch: Es ist ein genuin politisches Wesen. Denn jedes Tier ist eingebunden in ein soziales Beziehungs- und Machtgeflecht, das sein Leben beeinflusst – durch unsere Haltung, unsere Lebensweise, unsere Grenzziehungen. Daraus ergibt sich der Anspruch auf rechtlichen Schutz vor Diskriminierung und auf gleichberechtigte Berücksichtigung seiner elementaren Interessen in der Gemeinschaft.
Zoopolisten fordern daher für Tiere nicht nur negative Rechte – Schutz- und Abwehrrechte –, sondern auch positive: das Recht auf Mitbestimmung über die Bedingungen ihres Lebens.
Je nach Verhältnis zur menschlichen Gesellschaft ergeben sich daraus unterschiedliche Formen der Zugehörigkeit: Tiere, die mit uns leben – wie sogenannte Haustiere – sind Mitbürger mit Anspruch auf Teilhabe. Tiere, die sich an menschliche Lebensräume angepasst haben – wie Stadttauben oder Füchse – sind Kulturfolger, die das Recht auf respektvolle Koexistenz und Lebensraum haben. Und Tiere in der freien Wildbahn haben Anspruch auf Souveränität: das Recht, in Frieden und Freiheit jenseits menschlicher Einmischung zu leben.
Von Nacktaffen und anderen Tieren – Warum ‚Mensch‘ und ‚Tier‘ keine harmlosen Begriffe sind
Seit einiger Zeit sorgt der Begriff „nackter Affe“ bzw. „Nacktaffe“ als Synonym für „Mensch“ für Irritationen. Manche wittern gar Menschenfeindlichkeit und trivialisieren damit den Einsatz des Begriffs als Ventil für ein allgemein geächtetes Gefühl. Diese Einordnung greift jedoch zu kurz, denn hinter diesem Begriff stehen tiefere Überlegungen – mit dem Ziel, alle fühlenden und denkenden Arten rechtlich gleichzustellen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Mensch“ und „Tier“ als Antagonisten verwendet: Hier der Mensch, dort alle Anderen, vom Schwamm bis zum Schimpansen, zusammengefasst unter dem Oberbegriff „Tier“. Dabei sind Menschen, biologisch betrachtet, selbst Tiere – nicht mehr oder weniger als Marienkäfer, Molche oder Mäuse. Sie sind eine von fünf bis 50 Millionen Arten.
Der Begriff ‚Tiere‘ stammt aus der biologischen Systematik, und er bezeichnet Lebensformen, die bestimmte Merkmale teilen – in Abgrenzung zu den anderen Lebewesen in der biologischen Einordnung: Pflanzen, Pilze, Protisten, Bakterien und Archaeen. Darwin wird oft als der „böse Bube“ der Wissenschaft bezeichnet, weil seine Theorie der Evolution den Menschen als Teil der Tierwelt präsentierte – eine Erkenntnis, die als eine der größten narzisstischen Kränkungen der Menschheit gilt – neben Kopernikus (kein Mittelpunkt des Kosmos) und Freud (kein Herr im eigenen Haus). Doch bereits 100 Jahre vor ihm hatte der schwedische Naturforscher Carl von Linné den Tabubruch begangen und den Menschen als eine eigene Art im Tierreich eingeordnet. Linné wollte ursprünglich Menschen und Schimpansen in einer Gattung zusammenfassen, beugte sich jedoch dem Druck der Kirche und brach beim Menschen die regularien der Taxonomie. Seitdem gehören Menschen und Schimpansen – trotz der Nähe in ihrer biologischen Verwandtschaft – zu verschiedenen Gattungen.2
In seiner Selbstwahrnehmung aber bleibt der Mensch das ganz besondere Tier. Während die biologische Wissenschaft längst anerkennt, dass wir Tiere sind, haben juristische und kulturelle Vorstellungen nach wie vor einen anderen Anspruch: der Mensch wird als das Maß aller Dinge betrachtet. Diese Trennung, die sich in der Sprache manifestiert, unterhält ein System, das seine eigene Sonderstellung betont und den Kontakt zu den anderen Tieren ständig relativiert. Es ist ein Konzept, das tief in der westlichen Denkweise verankert ist und auf eine Hierarchie zurückgeht, die im 4. Jahrhundert v. Chr. von Aristoteles formuliert wurde. Die Vorstellung eines anthropozentrischen Weltbildes – des Menschen als Zentrum aller Dinge – hat nicht nur die Wissenschaft geprägt, sondern auch unseren Umgang mit der Welt.
Durch unsere Sprache wird diese Hierarchie immer wieder neu etabliert. Sie baut Barrieren, die nicht nur die Natur, sondern auch das Denken der Menschen prägen. Ludwig Wittgenstein formulierte es unmißverständlich: „Sprache schafft Wirklichkeit“. Und diese Wirklichkeit ist gegenüber den Tieren vermessen, arrogant und anthropozentrisch – ebenso, wie es die Sprache ist. So drängt sich die Frage auf: Sollte diese Selbstverherrlichung weiterhin von uns sprachlich aufrecht erhalten werden, oder ist es nicht vielmehr notwendig, sprachlich eine neue Ordnung zu schaffen, um eine neue Wirklichkeit zu schaffen?
Das Begriffspaar „Mensch und Tier“ dient der Ausgrenzung, der Abgrenzung und der Selbsterhöhung, und gleichzeitig werden über die gedankliche Trennung hinaus auch mit den Begriffen selbst, von uns hoffentlich unerwünschte Assoziationen und Informationen – eigentlich Vorurteile – transportiert. So ist der Begriff „Mensch“ mit Wertzuschreibungen und Fähigkeiten ideologisch aufgeladen, die tatsächlich gar nicht exklusiv menschlich sind. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Tier“, wann auch diesbezüglich die damit verbundenen Zuschreibungen eher abwertend sind. Mit den Begriffen Mensch und Tier wird ein trennender Graben aufgerissen – schon alleine über die darin innewohnenden Konnotationen, die mit beiden Begriffen verbunden sind. „Menschen“ sind „Wir“, die „Vernünftigen“, „Edlen“, „Hilfreichen“, „Guten“, die „Gottgleichen“, die „Krone der Schöpfung“, die „Kulturwesen“, gesegnet mit herausragenden Befähigungen, mit Würde und unzählbaren narzisstisch aufgeladenen Selbstbeweihräucherungen. Alle diese Botschaften transportieren wir – absichtlich und unabsichtlich, bewusst oder unbewusst – mit der Verwendung des Begriffs „Mensch“.
Die „Tiere“ sind bestenfalls „die Anderen“, eigentlich ja eher „niemand“, sie sind „unbewusst“, „niedrig“, „instinktgesteuert“, eine Erscheinungsform der „Natur“ und letztlich ein Gegenentwurf zum Menschen, über den wir uns evolutionär hinweggehoben haben. Auch diese Informationen transportieren wir, wenn wir den Begriff Tier verwenden, ob wir das nun wollen oder nicht. Das Begriffspaar „Mensch und Tier“ ist die doppelte Unterstreichung der Ideologie, aus deren Schoß die Massenvernichtung gekrochen ist. Aber wer bestimmt eigentlich, wer „Wir“ ist, und wer „ein Anderer“? Und vor allem: Cui bono? Wem nützt dieses Denken? Und wem schadet es?
Die Trennung in „Mensch“ und „Tier“ ist Ausdruck einer tieferliegenden Problematik: der menschlichen Neigung zur Kategorisierung. Kategorien ordnen die Welt, aber sie formen sie auch – und sie schaffen Hierarchien. Jede Einteilung in ein „Wir“ und ein „Sie“, ein „oben“ und „unten“, erzeugt Machtgefälle. Besonders wirksam sind diese Kategorisierungen, wenn sie sich natürlich anfühlen – so wie der Gegensatz zwischen Mensch und Tier, der uns heute als selbstverständlich erscheint, obwohl er historisch konstruiert ist. Wer aber in solchen Dichotomien denkt, verlernt, das Gemeinsame und Verbindende zu sehen. Kategorisierungen sind keine neutralen Ordnungswerkzeuge. Sie sind immer auch Werkzeuge der Ausgrenzung – und oft der Gewalt.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, formulierte es Ludwig Wittgenstein. Seine Entdeckung der Sprache als Ursprung unserer Erkenntnis stellte die gesamte Philosophie infrage. Denn unabhängig davon, was Denker von der Antike bis heute als das Wesen der Wirklichkeit erkannt zu haben glauben – ihre Erkenntnis bleibt im Käfig der jeweils herrschenden Sprache gefangen.
Sprache ist nicht nur ein neutrales Werkzeug zur Beschreibung der Welt, sie ist ein Machtinstrument. Das weiß auch die Politik, die sich der bewussten sprachlichen Rahmung – dem sogenannten Framing – längst gezielt bedient. Kaum jemand hat diese manipulative Kraft der Sprache so scharfsinnig analysiert wie Noam Chomsky: Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert das Denken – und damit auch die Wirklichkeit, wie sie in unseren Köpfen existiert.
Wenn wir also die Wirklichkeit der sogenannten „Tiere“ nicht nur beschreiben, sondern aktiv mitgestalten wollen, dann müssen wir uns aus dem sprachlichen Korsett lösen, das ihre Herabsetzung und Unterwerfung unbemerkt mittransportiert. Die Realität setzt sich nicht von allein durch. Sie braucht eine Stimme – und diese Stimme darf keinen Bruch zwischen Aussage und Ausdruck enthalten. Denn sobald wir das Richtige im falschen sprachlichen Rahmen sagen, konterkarieren wir unsere eigene Botschaft. Sprache ist nicht nur Träger von Argumenten. Sie ist Teil des Arguments selbst.
Wenn wir die Wirklichkeit der sogenannten „Tiere“ nicht nur abbilden, sondern aktiv gestalten wollen, dann ist es entscheidend, sich aus dem sprachlichen Käfig zu befreien, der ihre Unterwerfung verkörpert. Denn mit unserer Art, zu sprechen, transportieren wir Weltbilder – subtil oder direkt. Sprache prägt, was denkbar, sagbar und letztlich auch machbar ist.
Die Realität setzt sich nicht von allein durch. Sie braucht eine Stimme – und diese Stimme darf keinen Bruch zwischen Aussage und Ausdruck enthalten. Wer im richtigen Anliegen die falsche Sprache wählt, schwächt sich selbst.
Zentral für eine solche sprachliche Emanzipation ist der Abschied von den Begriffen „Mensch“ und „Tier“. Denn beide sind bis zur Unkenntlichkeit ideologisch aufgeladen – mit diskreditierenden Lügen über andere Tierarten und idealisierenden Lügen über die eigene. Sie reproduzieren das Machtgefälle, das eigentlich überwunden werden soll. Wer es ernst meint mit der Gerechtigkeit gegenüber allen fühlenden Lebewesen, sollte nicht nur Argumente prüfen – sondern zuerst die eigene Sprache. Denn Sprache schafft Herrschaft – und sie kann sie auch beenden.
Lasst uns konkret werden: Ich schlage für den Menschen die Bezeichnung „Nacktaffe“ vor. Warum genau Nacktaffe? Zum einen, weil wir – biologisch unstrittig – zur Ordnung der Affen gehören. Zum anderen, weil der Begriff ein doppeltes Zeichen gegen die Überheblichkeit setzt, mit der sich der sogenannte „Mensch“ über seine Stammesbrüder erhebt. Kaum eine Tiergruppe gilt in unserer Sprache als „tierischer“ als die Affen. Die Selbstabgrenzung des Menschen vollzieht sich besonders scharf gerade gegenüber ihnen – jenen, die ihm am nächsten stehen.
Zudem ist der Begriff Nacktaffe kulturhistorisch bereits eingeführt. 1967 erschien Desmond Morris’ Weltbestseller Der nackte Affe, der mit der phantasierten Sonderstellung des Menschen gründlich aufräumte. Er lenkte den Blick auf das Gemeinsame im Verhalten von Menschen und anderen Affenarten – und der provokante Titel wurde zum sprechenden Symbol für das Ende des Hochmuts. Dieses Buch schenkte uns eine Bezeichnung, die den ausgrenzenden Dünkel vermeidet und dabei an ein kollektives kulturelles Wissen anschließt. Und da – wie dargelegt – Sprache ein Schlüssel zur Veränderung ist, solten wir den Begriff künftig bewusst und regelmäßig verwenden, um mit ihm eine neue Wirklichkeit zu formen – mit weniger menschlichem Dünkel.
Den Begriff Tier aus unserem Wortschatz zu tilgen oder durch wertschätzendere Alternativen zu ersetzen, ist ungleich schwerer – aber mindestens genauso wichtig wie die sprachliche Entthronung des Menschen. Die ideologische Rationalisierung der systematischen Unterwerfung anderer Arten beginnt geschichtlich betrachtet mit der Erfindung des Sammelbegriffs Tier. Für die sogenannten Vorsokratiker war der Mensch noch ein Teil der Natur – kein Gegenentwurf zu ihr. Er lebte in ihr und aus ihr, eingebettet in eine umfassende Ordnung, die bis zu den Sternen reichte. Die frühgriechische Kultur – als sogenannte Wiege des Abendlandes – grenzte den „Menschen“ ursprünglich nicht von den „Tieren“ ab. Bei Homer etwa kommt ein zusammenfassender Begriff wie Tier noch gar nicht vor. Man sprach von Hunden, Rindern oder Pferden. Es gab auch noch keine erfundenen Eigenschaften, die den Menschen grundlegend von allen anderen Arten unterscheiden sollten.
Der Dichter und Philosoph Hesiod beschrieb bereits um 800 v. Chr. – also etwa zur gleichen Zeit wie die homerischen Epen – ein sich wandelndes Verhältnis des Menschen zu den anderen Tieren. Er war einer der ersten, der eine Trennung vornahm: Was den Menschen auszeichne, so Hesiod, sei sein Rechtsempfinden, seine Fähigkeit zur Rechtsordnung. Damit war ein erster Trennstrich gezogen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. setzte sich dazu die Vorstellung durch, die Gabe der Vernunft unterscheide den Menschen grundsätzlich von allen anderen Arten. Hier wird der ideologische Rahmen sichtbar, in dem sich die Begrifflichkeit „Tier“ fortan entfalten konnte: als Negativfolie des Menschen, als minderwertiger Gegenentwurf.
Von da an zieht sich der Begriff Tier wie ein roter Faden durch die Geschichte des Abendlandes – jedoch nie als Begriff der Wertschätzung, sondern immer als Marker des Mangels: mangelnder Vernunft, mangelnder Sprache, mangelnder Moral. Er steht für Abgrenzung und Ausschluss. Wer ihn verwendet, ruft die gesamte Geschichte der Entwertung und Entfremdung mit auf. Der Begriff trägt den ideologischen Überbau in sich, der die Herrschaft über die anderen Tierarten geistig vorbereitet, absichert und legitimiert.