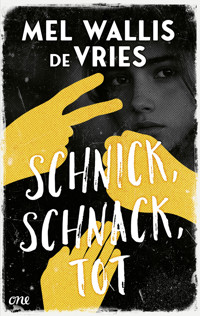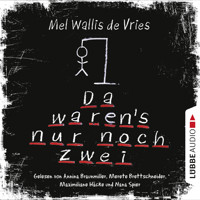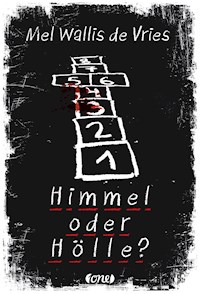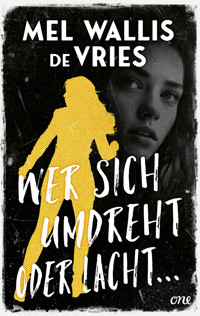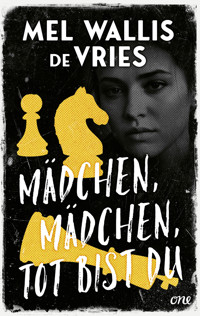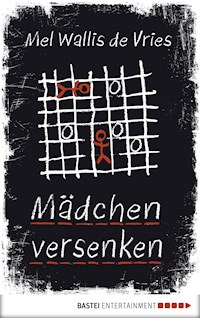6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: deVries-Thriller
- Sprache: Deutsch
Die sechzehnjährige Nikki wacht blutüberströmt in einem Park auf. In den Händen hält sie ein Messer, und etwas weiter liegt ein anderes Mädchen - schwerverletzt und bewusstlos. Nikki hat keine Ahnung, wer sie ist oder was geschehen ist, aber alles deutet darauf hin, dass sie selbst dieses Mädchen niedergestochen hat. Verzweifelt versucht Nikki herauszufinden, was in dieser Nacht passiert ist, und ihre eigene Unschuld zu beweisen. Doch die Verdachtsmomente häufen sich. Wie kann es sein, dass sie sich an nichts erinnert? Und wem kann sie noch vertrauen? Nikki macht sich auf die Suche nach der Wahrheit - und findet Verstörendes heraus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Triggerwarnung
Widmung
Wer flüstert, der stirbt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
TRIGGERWARNUNG
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Mel Wallis de Vries
Wer flüstert, der stirbt
Übersetzung aus dem Niederländischen von Verena Kiefer
Liebe Leser:innen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr eine Triggerwarnung auf S. 213. ACHTUNG: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis. Euer Team vom ONE-Verlag
»No one is born hating another person.«
Nelson Mandela
Sie steht vor mir und sieht mich aus großen Augen an. Zu Tode verängstigt. Doch fliehen kann sie nicht mehr. Und das weiß sie auch.
Einen Moment zögere ich. Dann denke ich wieder an alles, was geschehen ist. Ohne weiter nachzudenken, stoße ich das Messer durch ihre Jacke. Die Klinge gleitet durch den Stoff, ihre Kleidung, ihre Haut. Sie stöhnt und versucht, das Messer wegzuschieben. Aber ich hole noch einmal aus. Und noch einmal. Das hat etwas Schönes. Etwas Gerechtes.
Dreckige! Schlampe! Das! Ist! Dein! Verdienter! Lohn!
Plötzlich ist es vorbei. Sie stürzt zu Boden, direkt auf einen merkwürdig geformten Hubbel im Gras. An ihrer seltsamen Haltung – Arme gespreizt und die Beine seitlich abgewinkelt – kann ich sehen, dass sie nicht mehr da ist. Ihre Jacke färbt sich blitzschnell dunkel. Eher schwarz als rot. Ich denke an ihre Augen, die aufs Gras starren, ohne etwas zu sehen.
Ich schaue noch einige Sekunden hin. Mein Kopf füllt sich mit Bildern, und auf meiner Kleidung sind Blutspritzer. Etwas in mir will nach ihrem Handgelenk fassen, um zu prüfen, ob ihr Herz noch schlägt. Aber ich kann nicht länger bleiben. Ich muss mich beeilen.
Unsicher werfe ich einen Blick über die Schulter. Der Park ist dunkel, nass und verlassen. Die Schattengestalten der hohen Bäume sind die einzigen Zeugen. Ich weiß, dass sie nichts verraten werden.
Lebwohl, denke ich, als ich mich umdrehe. Niemand wird sich an mich erinnern. Und am besten vergesse ich mich auch gleich selbst.
Plötzlich registriere ich eine Bewegung zwischen den Bäumen. Einen Augenblick lang weiß ich nicht, was ich machen soll, und gerate in Panik. Aber dann kommt alles wieder zurück. Ich atme tief ein und verberge mich in den dunklen Schatten.
Kapitel 1
Eine Stimme, irgendwo aus der Finsternis. »Mädchen! Mädchen, schau mich mal an!«
Aber es gelingt mir nicht. Es fühlt sich an, als wären meine Augenlider mit Leim verklebt. Mit aller Kraft versuche ich, meinen Körper zu bewegen, doch alles ist so schwer, so unendlich weit weg. Selbst das Atmen strengt mich an.
Jemand zieht an meinem Arm. Wieder dieselbe Stimme: »Hallo, hörst du mich?«
Lass mich in Ruhe, denke ich und gleite wieder tiefer in das Dunkel in meinem Kopf. Ich bin so müde, so ...
»Bleib bei mir, Mädchen! Nicht einschlafen!« Die Person zieht noch fester an meinem Arm.
Ich versuche, die Augen zu öffnen. Einen Spalt breit. Und durch diesen Spalt sehe ich Schuhe. Braune Schuhe mit Schnürsenkeln.
Plötzlich habe ich Angst. Ekelerregende Angst. Ich fange an zu husten und muss mich fast übergeben.
»Nur ruhig«, sagt die Stimme. Ich schaue nach oben, aber ich kann meinen Blick nicht fokussieren. Das verschwommene Gesicht eines älteren Mannes schwebt über mir.
In Panik versuche ich aufzustehen.
»Das halte ich nicht für vernünftig«, sagt er. »Bitte bleib liegen.«
Aber ich höre nicht auf ihn und setze mich auf. Alles dreht sich. Schwindelig lasse ich meinen Kopf zwischen den Beinen hängen. Meine Arme um die Unterschenkel. Als Erstes sehe ich Blut. Meine Hände sind dunkelrot vor Blut.
Nein! Jemand ist verletzt! Ich bin verletzt! Was ...
»Wir haben den Notruf verständigt«, höre ich die Stimme des älteren Mannes sagen. »Ihr habt richtig viel Glück gehabt, dass wir hier vorbeigegangen sind. Meistens ist dieser Park abends wie ausgestorben, erst recht bei solchem Wetter. Meine Frau sitzt bei deiner Freundin.«
Freundin? Ich verstehe es nicht. »Ich ... Es ...«, stöhne ich.
»Psst, nur ruhig, alles wird gut.«
In der Ferne höre ich das Heulen der Sirenen. Sie kommen immer näher, bis mein Schädel von dem Lärm fast platzt und ich nicht mehr nachdenken kann. Blaulicht zuckt durch den Park und macht große schwarze Schemen aus den Bäumen. Es fühlt sich an, als würden mich Dutzende von Gestalten beobachten.
Die Sirenen werden abgeschaltet. Türen aufgeschlagen.
»Wir sind hier!«, ruft der ältere Mann.
Zwei Sanitäter, ein Mann und eine Frau, eilen mit einer Trage zu uns. Ihnen folgen zwei Polizisten. Ein Stückchen entfernt parkt ein weiterer Rettungswagen. Ich höre Stimmen, die schnell und aufgeregt rufen. Polizisten rennen über die Wiese. Es sind mindestens vier, wenn nicht noch mehr.
»Das andere Mädchen ist schlimmer dran«, sagt der ältere Mann.
»Dort sind auch Helfer«, antwortet die Sanitäterin, während sie in die Hocke geht, damit sie mich anschauen kann. »Mädchen, wir bringen dich ins Krankenhaus. Weißt du deinen Namen noch?«
Ich nicke.
Sie sieht mich weiterhin an, und ich verstehe, dass ich antworten soll.
»Nikki Mulder«, sage ich heiser.
»Gut, Nikki. Wir legen dich jetzt auf diese Trage. Versuch, dich möglichst wenig zu bewegen. Verstehst du, was ich sage?«
Ich nicke wieder.
Dann packen mich Hände unter den Achseln und den Beinen. »Eins, zwei, ...« Bei drei heben mich die Sanitäter auf die Trage. Der Reißverschluss meiner Jacke wird geöffnet, und sie ziehen sie mir aus. Zwei Gurte werden festgezurrt – einer um die Beine, einer um die Brust –, und über meine Beine wird eine Decke aus Silberfolie gelegt.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass der ältere Mann mit einem der Polizisten spricht. Der andere Polizist kauert im Gras.
»Wie fühlst du dich?«, fragt der Sanitäter.
»Mein Kopf tut weh«, sage ich leise.
Ich sehe, dass die Helfer einen schnellen Blick wechseln.
»Weißt du, wo du bist?«, fragt die Frau.
Ich schaue um mich. Aber ich weiß es nicht, weiß es wirklich nicht mehr. »Ich ... Ich muss zum Tanztraining«, stammele ich. »Sonst komme ich zu spät und ...«
»Wir bringen dich so schnell wie möglich in die Uniklinik«, unterbricht sie mich. »Dort wirst du weiter untersucht.«
Ich werde samt Trage hinten in den Rettungswagen gehoben. Ein straffes Band um den Oberarm, eine Infusionsnadel in meiner Hand.
»Blutdruck stabil«, sagt die Frau. »Und es gibt keine sichtbaren Blutungen.«
Das Blut an meinen Händen ... Ich will nicht daran denken, was passiert ist. Noch nicht.
Ich meine, draußen jemanden sagen zu hören: »He, hier liegt was, sieht aus wie ein ...«
Aber dann werden die Türen des Rettungswagens zugeschlagen, und ich höre nichts mehr.
TAG 1
Es hat angefangen.
Es gibt kein Zurück mehr.
ABER ES FÜHLT SICH ERLEICHTERND AN ...
Kapitel 2
Das Licht der Straßenlaternen zuckt durch die Fenster des Rettungswagens. Hin und wieder erhasche ich einen Blick auf ein Gebäude, eine Ampel, einen Laden. Wir fahren überall gleich schnell vorbei.
Ich höre, wie der Fahrer etwas in ein Funksprechgerät sagt. »28 unterwegs zur NA der Uniklinik, Code 414, Priorität A2.«
Knacken, danach eine Stimme, die antwortet: »Zentrale an 28, die Daten wurden der Klinik übermittelt.«
»Wir sind in zwei Minuten da, fahren jetzt über die Kreuzung zur De Boelelaan.«
»Verstanden, ihr werdet erwartet.«
Die Sanitäterin sitzt neben mir und lächelt. »Wir sind fast da.«
»O-okay.«
Sie scheint es nicht schlimm zu finden, dass ich kaum etwas sage, und richtet den Blick auf einen Monitor über ihrem Kopf, auf dem jede Menge Linien und Zahlen zu sehen sind.
Alles ist so unwirklich. Ich versuche verzweifelt, eine logische Erklärung zu finden für das, was hier passiert. Eine andere Erklärung als die, dass ich verrückt geworden sein könnte.
Ich spüre, dass der Rettungswagen langsamer wird, eine Rampe hinunterfährt und parkt. Die Türen öffnen sich, ich werde mitsamt Trage in ein Parkhaus gefahren. Die Luft ist kalt und stinkt nach Abgasen.
Die Rettungssanitäter rollen mich durch zwei Schiebetüren in die Notaufnahme. Wir fahren durch einen Flur, an einem überfüllten Wartebereich vorbei. Alle starren mich schweigend an. Ich komme mir lächerlich vor und schaue schnell zur anderen Seite.
Die Krankentrage wird gedreht und in einen hell erleuchteten Raum mit einem Behandlungstisch und einem Stuhl geschoben. Ein Arzt und eine Pflegerin eilen zu mir, als hätten sie nur auf diesen Moment gewartet.
»Hallo, Nikki«, sagt der Arzt.
Merkwürdig, dass er meinen Namen weiß.
»Wir heben dich jetzt auf den Behandlungstisch«, fährt er fort. Ohne meine Antwort abzuwarten, nimmt er meine Beine.
Der Sanitäter greift unter meine Achseln. »Und hopp«, sagt er.
In einer fließenden Bewegung heben sie mich auf den Behandlungstisch.
Die Pflegerin deckt mich mit einer Decke zu.
»Alles Gute, Nikki«, sagt der Sanitäter, während er die Krankentrage zur Tür schiebt.
Die Frau hebt ihren Daumen, als wollte sie sagen: Das wird schon wieder.
Sie verschwinden im Gang.
»So, Nikki«, sagt der Arzt und lächelt. Er zieht sich den Stuhl neben den Behandlungstisch und setzt sich. »Wo tut es denn weh?«
»M-mein Kopf.«
»Hm-m.« Er nickt, als hätte ich die richtige Antwort gegeben, und wirft einen Blick auf meinen Scheitel. »Du hast tatsächlich eine Kopfwunde.«
Es ist, als würde ich die Kopfschmerzen gleich noch intensiver fühlen.
»Und deine Hände?«, fragt er weiter.
Ich schaue darauf. Das Blut ist in dicken schwarzen Krusten getrocknet.
»Ich spüre nichts«, sage ich zögernd.
Der Arzt winkt der Pflegerin. »Würden Sie ihre Hände vorsichtig mit sterilem Wasser und einem Tupfer säubern?«
Die Pflegerin rollt einen kleinen Materialwagen zu mir hinüber. »Ich bin Tineke«, sagt sie lächelnd, als würde das eine Rolle spielen. Sie streift Latexhandschuhe über und tröpfelt ein wenig Wasser aus einer Plastikflasche auf einen Tupfer. »Sag bitte sofort, wenn es wehtut.« Vorsichtig nimmt sie meine Hände.
Der nasse Tupfer fühlt sich kalt an auf meiner Haut. Das Blut lässt sich auflösen, als wäre es Farbe.
Die Pflegerin legt die benutzten Tupfer in einen Plastikbehälter. »Fertig«, sagt sie.
Wir starren alle drei auf meine sauberen Hände. Keine Wunde zu sehen. Nicht mal eine kleine Schramme. Das sollte eine Erleichterung sein, aber seltsamerweise ist es das nicht. Warum klebte dieses Blut dann an meinen Händen?
Der Arzt scheint dasselbe zu denken. »Vielleicht hast du deine Kopfwunde angefasst«, sagt er zweifelnd. Er wirft der Pflegerin einen Blick zu.
Ich sehe, dass sie den Behälter mit den Tupfern in eine Plastiktüte steckt und einen Sticker aufklebt. Warum wirft sie die Tupfer nicht einfach weg?
»Sag mal, Nikki.« Der Arzt räuspert sich. »Könntest du uns erzählen, was da im Park passiert ist?«
Ich beiße mir auf die Lippe. Diese Frage habe ich mir im Rettungswagen schon hundertmal gestellt. Ich weiß noch, dass ich durch den Park ging, über die Brücke zu dem dicht bewachsenen Stück mit den Bäumen, und dass es sehr dunkel war, weil es regnete – aber da hören die Bilder auf.
»Ich ... Ich war auf dem Weg zum Tanztraining«, sage ich leise.
»Und dann?«
»Das ... Das weiß ich nicht mehr.«
»Erinnerst du dich wirklich an nichts mehr?« Er sagt das in einem Ton, als würde er an meinen geistigen Fähigkeiten zweifeln.
Ich schüttle den Kopf.
»Bewusstseinsverlust oder Gedächtnisverlust kann auf eine Gehirnerschütterung hinweisen. Oft weiß man dann vorübergehend nichts mehr von dem Zeitraum kurz vor und kurz nach dem Schlag.« Der Arzt sieht mich bedächtig an.
Die Pflegerin tut so, als hätte sie viel aufzuräumen, aber ich habe den Eindruck, sie lauscht bloß.
»Ich werde noch eine weitere Untersuchung vornehmen.« Der Arzt tastet meinen Nacken ab, bewegt vorsichtig meinen Kopf. »Sehr gut«, murmelt er. Aus der Brusttasche seines weißen Kittels zieht er eine Art eisernen Stift. »Schau bitte mal in die Lampe.«
Ein grelles Licht leuchtet plötzlich in mein Auge.
»Deine Pupillen reagieren normal«, murmelt der Arzt, während er auch mein anderes Auge kontrolliert. »Jetzt schließe die Augen bitte einmal und berühre mit dem Zeigefinger die Nasenspitze.«
Ich tue, was er sagt, und tippe meine Nase an.
»Großartig«, sagt er sehr übertrieben, als hätte ich einen schwierigen Test bestanden.
Ich hoffe immer noch, dass das hier nicht wirklich passiert. Innerlich kämpfe ich gegen den Drang, aufzustehen und wegzulaufen. »Ich möchte nach Hause«, sage ich leise.
»Wir haben deine Eltern angerufen«, antwortet er. »Sie kommen gleich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du nicht lieber eine Nacht zur Beobachtung hierbleiben solltest.«
»Nein, nein«, sage ich schnell. »Es ist wirklich alles gut.« Zur Demonstration schiebe ich mich hoch und schwinge meine Beine über den Rand des Behandlungstisches. Etwas zu schnell, denn ich spüre, wie mich eine Welle der Übelkeit überspült.
Der Arzt schaut mich besorgt an. »Geht es?«
Ich presse die Zähne aufeinander. »Ja, ja, kein Problem.«
»Hm«, sagt er und seufzt tief. »Ich werde jetzt erst die Wunde an deinem Kopf nähen. Danach schauen wir, ob du nach Hause kannst. Tineke!«
Die Pflegerin rollt wieder einen Materialwagen zu uns. Sie lächelt mich an.
Dieses ganze Lächeln macht mich nervös.
Der Arzt schiebt die Haare auf meinem Scheitel vorsichtig zur Seite. »Es tut mir leid, aber wir müssen ein Stück wegrasieren, sonst kann ich nicht gut nähen.«
Ohne weitere Diskussion schmiert er mir einen Klecks Rasierschaum in die Haare. Mit einem Messer entfernt er sorgfältig ein paar Haare. Ich sehe lange dunkelblonde Strähnen auf den Boden fallen. Seine Fingerspitzen befühlen meine Haut.
Ich stoße einen kleinen Schrei aus.
»Tut das weh?«, fragt er. »Es ist eine ziemliche Beule. Aber halb so schlimm. Ich glaube, du hast sehr viel Glück gehabt. Jetzt musst du noch kurz den Kopf stillhalten, dann kann ich die Stelle betäuben.«
Ich sehe, dass er eine Injektionsnadel und eine Ampulle vom Tisch nimmt. Mein Magen dreht sich um.
Die Pflegerin versucht mich abzulenken. »In welche Klasse gehst du?«
»Äh, in die Zehnte.«
»Gehst du gern zur Schule?«
Nein, natürlich nicht, denke ich. »Geht so«, murmele ich. »Letztes Jahr bin ich sitzen geblieben.«
»Das tut mir leid.«
Ich zucke mit den Schultern. Schon okay, es gibt schlimmere Dinge in meinem Leben. Ich spüre die Nadel und krümme mich zusammen.
Die Pflegerin nimmt meine Hände. Meine rosafarbenen, sauberen Hände. Ich versuche, nicht draufzuschauen.
»Hast du viele Freundinnen in deiner neuen Klasse?«, fragt sie.
Was für ein dämliches Gespräch. »Ja«, sage ich widerwillig.
»Das ist schön.« Sie nickt und fängt an, von ihrer Tochter und deren Schule zu erzählen. Das interessiert mich nicht die Bohne, aber ich versuche, mich auf ihre Stimme zu konzentrieren, während der Arzt prüft, ob die Betäubung wirkt, und danach zu nähen beginnt.
»So, das hätten wir«, sagt er nach einer Weile und rollt auf seinem Stuhl von mir weg. Beim Mülleimer streift er seine Latexhandschuhe ab. »Deine Freundin hat weniger Glück gehabt.« Er sieht mich fast übertrieben mitfühlend an. »Sie liegt auf der ITS, weil sie das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt hat.«
Meine Kehle ist trocken, als ich sage: »Ich ... Ich weiß nicht, wer sie ist.«
»Wie meinst du das?« Er runzelt die Stirn. »Hast du vergessen, wie sie heißt – oder kennst du sie gar nicht?«
Meine Wangen werden rot, und ich wende den Blick ab.
»Ich kenne sie nicht.«
»Oh.«
Eine Stille tritt ein. Sein Gesichtsausdruck hat sich plötzlich verändert: Er wirkt grübelnd und distanziert. Er hält das für eine sehr merkwürdige Geschichte, glaube ich.
»Gut«, sagt er schließlich langsam. »Aus meiner Sicht darfst du nach Hause, wenn dich deine Eltern heute Nacht ein paarmal wecken, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und du kannst den Tag auch ganz normal verbringen, zumindest, wenn es sich für dich gut anfühlt. Es ist nicht bewiesen, dass Bettruhe die Genesung bei einer Gehirnerschütterung beschleunigt.« Er sagt noch etwas zu den Fäden, die nach einer Woche rausmüssen, zur Dosierung der Schmerztabletten und dass mein Gedächtnisverlust durchaus noch ein paar Tage anhalten kann, aber wahrscheinlich langsam nachlassen wird. »Komm bitte wieder zu uns, wenn dir schwindelig oder übel wird oder wenn du merkst, dass du nicht gut sehen kannst«, sagt er abschließend und geht zur Tür. »Aber das erwarte ich eigentlich nicht. Hast du sonst noch Fragen?«
Ich schüttle den Kopf.
»Dann wünsche ich dir alles Gute. Du kannst hier warten, bis deine Eltern da sind. Tineke bleibt bei dir.« Er schaut mich einige Sekunden lang an und schüttelt dann den Kopf, als wollte er einen schrägen Gedanken verdrängen.
Kapitel 3
Meine Eltern treten zögernd ein, als hätten sie Angst, am falschen Ort zu sein. Mein Vater hält meiner Mutter die Tür auf und sagt zur Pflegerin: »Wir sind auf der Suche nach Nikki Mulder. Laut der Dame am Empfangsschalter ist sie in diesem ...«
»Nikki!«, ruft da meine Mutter, als sie mich auf dem Behandlungstisch sitzen sieht, und läuft auf mich zu. »Liebes.« Sie legt die Arme um mich und betrachtet mich anschließend aus kurzer Distanz. »Wir haben so einen Schrecken gekriegt.«
Mein Vater umarmt mich ein wenig ungeschickt. »Ein Glück«, ist das Einzige, was er sagt.
Ich schaue sie an. Meine Mutter. Meinen Vater. Sie sehen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Mir wird klar, dass ich dieses Gespenst bin. »Mama, Papa, ich ...«, setze ich an. Aber dann schnürt sich mir die Kehle zu, und ich bringe kein Wort mehr heraus. Ich versuche, meine Tränen wegzublinzeln, aber sie laufen mir schon über die Wangen.
Meine Mutter nimmt mich wieder in den Arm. Sie zieht meinen Kopf an ihre Schulter und streichelt mir sanft über den Rücken. »Pst, nur ruhig. Nicht weinen, Liebes.«
Aber ich weine weiter, als hätte ich alle Tränen bis zu diesem Moment aufgespart.
»Wir haben uns solche Sorgen gemacht.« Der warme Atem meiner Mutter streicht durch meine Haare. »Die Polizei hat bei uns angerufen. Sie sagten, es hätte einen Unfall gegeben, und wir sollten sofort in die Klinik kommen.«
»Ihre Tochter hat sehr großes Glück gehabt«, wiederholt die Pflegerin die Worte des Arztes. »Sie musste nur mit einigen Stichen am Kopf genäht werden, und sie hat eine Gehirnerschütterung. Der Doktor sagt, sie darf nach Hause.«
Meine Mutter lässt mich los. »Nikki ... Was ist denn passiert?«
Ich wische meine Tränen weg. Plötzlich bin ich todmüde. Mein Kopf fühlt sich wattig an, und mir ist schrecklich kalt.
»Ich war auf dem Weg zum Tanztraining ... durch den Park, und dann ... Es war dunkel ... und ich war zu spät dran ... Vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst ...« Ich höre, dass meine Stimme immer leiser wird. »Und dann lag ich plötzlich auf dem Boden.«
»Aber warum denn?«
»Das weiß ich nicht mehr ...« Noch während ich das sage, zweifele ich an meiner eigenen Antwort. Als würde ich mir selbst nicht glauben.
Meine Eltern starren mich an. Ich sehe die Verwirrung in ihrem Gesicht.
Meine Mutter schlägt eine Hand vor ihren Mund. »Die Polizei sagte auch etwas von einer Freundin? Warst du mit Manouk oder Lisa im Park? Sind sie auch verletzt?«
»Nein, ich weiß nicht, wer das andere Mädchen ist ...« Ich kann sie nicht länger ansehen und schaue zu Boden.
»Darüber können wir später noch reden«, höre ich meinen Vater sagen. »Kommt, wir gehen nach Hause. Nikki ist bestimmt todmüde.«
Ich nicke und atme erleichtert auf. Vorsichtig rutsche ich vom Behandlungstisch. Meine Beine sind etwas wackelig, aber ich stehe ohne Hilfe aufrecht.
»Mit diesen Sachen bist du eingeliefert worden.« Die Pflegerin reicht mir meine Jacke und den Rucksack mit meiner Trainingskleidung. Meinen Eltern sagt sie noch einmal, was ich alles machen darf und was nicht und dass sie mich heute Nacht regelmäßig wecken sollen. Und dass meine Erinnerungen wahrscheinlich von allein zurückkommen, aber dass das etwas dauern werde. Meine Eltern nicken folgsam.
Unterdessen ziehe ich meine Jacke an. Auf dem Ärmel sind Blutspritzer und Flecken. Sie glänzen seltsam schwarz und dunkel auf dem Nylon. Und in den Jackentaschen fehlt nichts: Handy, Kaugummi, Geldbeutel, Labello – alles noch da.
»Danke, dass Sie sich so gut um sie gekümmert haben«, höre ich meinen Vater zur Pflegerin sagen. Er fasst mich leicht am Arm und stützt mich auf dem Weg zur Tür.
»Alles Gute, Nikki«, sagt die Pflegerin.
Ich winke ihr ein wenig dämlich. Und dann fällt die Tür hinter uns zu, und wir stehen zu dritt auf dem Gang. Schweigend gehen wir zum Parkhaus.
Mein Vater öffnet mir die Tür, und ich lasse mich erschöpft auf die Rückbank fallen. Im Auto ist es angenehm warm. Ich starre durch das Fenster, während wir aus dem Parkhaus fahren und nach rechts in die De Boelelaan abbiegen.
Scheinwerfer vorbeifahrender Autos, Radfahrer, die sich durch den Verkehr schlängeln. Alles ist so beruhigend normal. Wir biegen links ab in den Amstelveenseweg, unter der Brücke durch.
»Nikki ...« Meine Mutter dreht sich auf dem Beifahrersitz um. An ihrem Ton kann ich hören, dass sie etwas beschäftigt. »Die Polizei hat gefragt, ob sie morgen Nachmittag kurz mit dir sprechen dürfen.«
»W-warum?«
»Um zu hören, was passiert ist, Liebes.«
»Aber ... ich erinnere mich an nichts mehr.«
»Das macht ja nichts, dann sagst du ihnen eben das.« Ich sehe, dass sie mir im Licht der Straßenlaternen zulächelt. »Die Polizei möchte den Täter so schnell wie möglich fassen. Es hätte auch ganz anders für euch ausgehen können.«
In der Stille kann ich fast hören, welche schrecklichen Szenarien sie sich gerade ausmalt. »Das weiß ich, Mama«, flüstere ich.
»Du weißt doch, dass du abends nicht allein durch De Braak laufen darfst?« Ihr Ton wird schärfer. »Es ist nicht das erste Mal, dass Mädchen in diesem Park belästigt wurden.«
»Aber Mama, es ist doch nur ein kleines Stück. Alle machen das.« Ich bin wieder kurz vorm Heulen.
»Sabine, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, davon anzufangen.« In der Stimme meines Vaters liegt ein warnender Klang.
Meine Mutter wirft ihm einen starren Blick zu. Ich sehe, dass sie ihm am liebsten etwas an den Kopf werfen würde. Aber sie seufzt und sagt: »Gut, dann reden wir eben später noch einmal darüber.«
Die restliche Fahrt verläuft zum Glück schweigend.
Kapitel 4
»Rufst du, wenn etwas ist?«, höre ich meinen Vater unten an der Treppe sagen.
»Ja.«
»Möchtest du wirklich nichts essen? Oder trinken?«
»Nein.«
»Okay, wir schauen gleich noch einmal nach dir.«
Ich schließe meine Zimmertür hinter mir – gerade ein bisschen lauter als notwendig – und lehne mich an die Wand. Endlich allein. Ich schaue mich in meinem Zimmer um, registriere den Berg Schmutzwäsche auf dem Boden, die Fotos auf meinem Schreibtisch, das Waschbecken, randvoll mit Kosmetika, die Schuhsammlung unter meinem Bett. Das ist mein Leben, und es sollte mich beruhigen. Aber das tut es nicht. Mir ist schwindelig, mein Kopf fühlt sich seltsam leicht an, die genähte Wunde schmerzt.
Was um Himmels willen ist in diesem Park passiert?
Ich versuche mich zu konzentrieren und kneife die Augen fest zusammen im Versuch, ein paar Stunden in der Zeit zurückzugehen: Ich sehe mich wieder durch den Park laufen, die Brücke überqueren. Ich spüre den Regen auf der Haut, den Wind im Gesicht. Irgendwo am Rande meines Bewusstseins sehe ich, wie sich etwas bewegt. Es ist noch weniger als die Andeutung eines Schattens. Und dann wird es plötzlich dunkel, als würde das Licht ausgehen. Jemand ruft: »Mädchen! Mädchen, schau mich mal an!«, und zieht an meinem Arm.
Alles dazwischen ist weg. Verschwunden. Die Polizei denkt morgen wahrscheinlich, dass ich komplett irre bin ... Oh, bitte, Nikki, hör auf, es ist nicht deine Schuld, was da passiert ist.
Meine Beine zittern, als ich zu meinem Schreibtisch gehe. Ich setze mich auf den Stuhl und starre die Wand mit den Dutzenden von Fotos und Polaroids an. Es sind so viele, dass sie kreuz und quer übereinander hängen. Ein Foto von Lisa und mir, auf dem wir uns lachend umarmen. Ein Foto vom Tanzturnier: Mein Team hatte den ersten Preis gewonnen. Die Klassenfotos vom letzten Jahr. Die Berlin-Exkursion.
Ich lache auf allen Fotos. Auf dieser Fotowand wirkt mein Leben perfekt. Aber das ist nur Schein ...
Ich wende den Blick von den Fotos ab und nehme mein Handy. Blind tippen meine Finger das Passwort ein, und der Bildschirm erwacht. In einer fließenden Bewegung öffne ich WhatsApp. Der Chat mit Lisa steht ganz oben. Die letzte Nachricht habe ich ihr heute Abend um acht Minuten vor sieben geschickt, nachdem wir fast eine Stunde gechattet hatten:
Fck, Zeit vergessen 😲 Muss los, Tanztraining ♥♥
😂😂😂 Omg, Nikki, das schaffst du im Leben nicht mehr, nerddd
Es schien ein so normaler Abend zu sein. Aber innerhalb von zwei Stunden hat sich die Welt verändert. Ich denke lange nach, bevor ich Lisa schreibe:
Ich hatte einen Unfall und war im Krankenhaus! 😬😬 Aber jetzt bin ich wieder zu Hause.
Es erscheinen keine blauen Häkchen hinter der Nachricht. Lisa ist offline. Kurz schließe ich die Augen. Ich hatte so gehofft, dass sie da wäre ...
In meinen Kontakten scrolle ich runter zu Timo und drücke auf das Telefonsymbol hinter seinem Namen.
Es läutet durch, aber er geht nicht dran, und ich rufe sofort noch einmal an. Meine Hände zittern, während ich seiner Stimme auf der Voicemail lausche: »Jo, ich bin nicht da. Sag was nach dem Piep, dann rufe ich dich vielleicht zurück.«
Ich widerstehe dem Drang, eine hysterische Nachricht zu hinterlassen, und schreibe ihm stattdessen auf WhatsApp:
Es ist was Schlimmes passiert ...
Aber auch er ist nicht online.
Ich lehne mich zurück und schalte mein Handy aus. Mein Kopf tut so weh, dass ich kurz vorm Zusammenklappen bin. Ich sollte lieber schlafen gehen.
Von unten höre ich Fetzen des Streits zwischen meinen Eltern.
»Warum muss ich immer ...«, ruft meine Mutter.
»Verdammt, Sabine!«, brüllt mein Vater. »Nicht alles ist meine Schuld ...«
»Kannst du dich nicht ein einziges Mal entschuldigen ...«