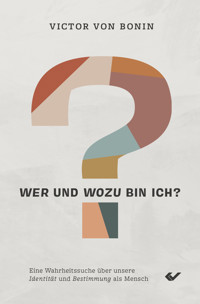
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist das Ergebnis einer langen gedanklichen Reise des Autors. Vermutlich wird es jeden ansprechen, der sich mit dem Sinn und Wert seines eigenen Daseins beschäftigt. Die Tatsache, dass Menschen mit einem Bewusstsein ausgestattet sind, nimmt sie in die Pflicht, sich mit dem Ursprung und dem Ziel ihres Lebens auseinanderzusetzen. Victor von Bonin betrachtet den Sachverhalt aus den verschiedensten Blickwinkeln (Physik, Biologie, Philosophie, menschliche Erfahrung, Bibel). Welche Erkenntnisse zur Entstehung unseres Universums liegen derzeit vor? Und wie erklärt sich der geheimnisvolle Übergang von der toten Materie zur ersten lebenden Zelle? Auf unterhaltsame Weise führen die Kapitel den Leser durch die Welt der Physik, Biologie und Philosophie. Aha-Erlebnisse sind garantiert, unabhängig davon, ob der Leser naturwissenschaftlich vorbelastet ist oder nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor von Bonin
Wer und wozu bin ich?
Eine Wahrheitssuche über unsere Identität und Bestimmung als Mensch
Best.-Nr. 275529 (E-Book)
ISBN 978-3-98963-529-6 (E-Book)
Folgende Bibelübersetzungen (bei Zitaten) wurden verwendet(siehe auch das Bibelstellenverzeichnis im Anhang 4):
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (LUT 2017)
Hoffnung für alle © 1983, 1996, 2002, 2015.
Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Fontis – Brunnen Basel. (HFA)
Die in diesem Dokument angegebenen Links wurden zuletzt im Oktober 2024 auf Verfügbarkeit geprüft.
1. Auflage (E-Book)
© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg
Satz und Umschlaggestaltung:
Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]
Für alle,die sich fragen,ob es Gottwohl geben mag
Inhalt
VORWORT
EINLEITUNG:Wer und wozu bin ich?
Eine persönliche Fragestellung mit überraschenden Einsichten
Was ist Wahrheit?
Gibt es eine Wahrheit?
Platons Höhlengleichnis
Schritt für Schritt – Aufbruch zu einer Gedankenreise
TEIL IKann der Materialismus das menschliche Dasein erklären?
Was kann uns die Physik über unser Lebensumfeld sagen?
Von der Entstehung des Universums, der rätselhaften Feinabstimmung und über das Wesen von Raum und Zeit
Was untersucht die Physik?
Die „Welt im Kleinen“: Die fundamentalen Kräfte in der Physik
Die „Welt im Großen“: Über die Entstehung des Universums
Das Wunder der Feinabstimmung
Das Wunder der Relativitätstheorie
Offene Fragen
Fazit zu den Erkenntnissen der Physik
Die Physik und das Leben – kurz und bündig
Was kann uns die Biologie über das Leben sagen?
Vom Wunder der Entstehung des Lebens bis zum Bewusstsein
Was untersucht die Biologie?
Die grundlegenden Fragen an die Biologie über das Leben
Frage 1: Wie entstand das erste Leben, und wie sah es aus?
Frage 2: Wie entstand aus dem ersten Leben die heutige Lebensvielfalt?
Frage 3: Wie entsteht Bewusstsein?
Die Darstellung der Entstehung des Lebens und der Lebensvielfalt in der Medienlandschaft
Fazit zu den Erkenntnissen der Biologie
Die Biologie und das Leben – kurz und bündig
Zwischenfazit: Wie kann ich mich aufgrund des materialistischen Weltbilds als Mensch verstehen?
Was kann uns die Philosophie über das Selbstverständnis des Menschen sagen?
Nachdenken des Menschen über sich selbst
Die Aufklärung: „Wir denken alles neu!“
Aufklärung in England: John Locke (1632–1704)
Aufklärung in Frankreich: Voltaire (1694–1778)
Aufklärung in Deutschland: Immanuel Kant (1724–1804)
Ein neues Gedankengebäude: Nietzsche, Darwin, Freud, Feuerbach, Marx
Die Aufklärung und die Reaktion der Kirche in Deutschland
Kritische Stimmen zur Aufklärung
Matthias Claudius (1740–1815)
Heinrich Heine (1797–1856)
Fazit zu den Gedanken der Philosophen
Philosophie und die Deutung des Lebens – kurz und bündig
TEIL IIDen Denkhorizont erweitern
Gibt es Hinweise auf ein „Mehr“?
Menschliches Fühlen und Erleben
Ist die Welt mehr als ein „Abspulen“ von Naturgesetzen?
Haben wir Denkalternativen?
Ein Theaterbesuch
Eine überraschende Heilung
Fazit zu Erlebnissen, die über das materialistische Weltbild hinausgehen
Ist da jemand?
Einmal angenommen, Gott existierte!
Wissenschaft und Gott – ein Widerspruch?
Können wir etwas über Gott herausfinden?
Ist der Gott der Bibel ein Kandidat für „den Gott“?
Fazit zu den Gedanken über die Existenz Gottes
TEIL III:Die Bibel und die Frage nach dem menschlichen Dasein
Was sagt uns die Bibel über den Menschen?
Herausfordernd und verheißungsvoll
Die Bibel – ein polarisierendes Buch
Die Bibel aus sich selbst heraus verstehen
1. Die Bibel verweist auf sich selbst
2. Die erstaunliche Aussage der Bibel
3. Die erstaunliche Geschichte des Volkes Israel
4. Die erstaunliche Prophetie in Bezug auf Jesus
5. Die erstaunliche Prophetie der Bibel bezüglich der Welt
Fazit zu den Aussagen der Bibel
Ist die Bibel ernst zu nehmen?
Wunder, Prophetie und Worte für die Ewigkeit
Die Bibel – göttlich inspiriert?
Ist Prophetie möglich?
Weitere Indizien für göttliche Inspiration
Biblische Wundergeschichten
Sind die biblischen Geschichten belegbar? Bibel und Archäologie
König Hiskia und die Rettung von Jerusalem
Biblische Wunder schaffen erstaunliche Sinnbezüge
Die Wunder Jesu
Das Wunder der Auferstehung
Fazit zur Zuverlässigkeit der Bibel
Was bedeutet „Glauben“?
Blaise Pascal und die Minus-minus-Falle
Zwei Ebenen der Wirklichkeit
Die Beziehung zwischen Mensch und Gott
Mensch und Gott: Trennung und Überwindung
Gott und die Beziehung des Menschen zu ihm
Gerechtigkeit und Vergebung
Gottes Eingreifen und Nicht-Eingreifen
Die Bibel und ihre Verkündigung in der heutigen Zeit
Was hält uns vom Glauben ab?
Was ist die Hoffnung, die der Glaube an Gott gibt?
Glaubenswege
Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde
Denn Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich umringt
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer
Wir vertrauen auf Gott
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt
Fazit zum christlichen Glauben
RESÜMEE:Wer und wozu bin ich?
Eine Gedankenreise geht zu Ende
Wer bin ich – Zufall oder Ebenbild Gottes?
EPILOG
ANHANG 1: QR-Codes für vertiefende Quellen
ANHANG 2: Crash-Kurs Bibel
ANHANG 3: Zeittafel biblischer Ereignisse
ANHANG 4: Bibelstellenverzeichnis
DANKSAGUNG
ENDNOTEN
Vorwort
Das vorliegende Buch „Wer und wozu bin ich? – Eine Wahrheitssuche über unsere Identität und Bestimmung als Mensch“ ist das Ergebnis einer langen gedanklichen Reise des Autors. Vermutlich wird es jeden ansprechen, der sich mit dem Sinn und Wert seines eigenen Daseins beschäftigt. Mich hat es auf jeden Fall ins Grübeln gebracht.
Da ich Arzt bin, habe ich wohl öfter als die meisten meiner Zeitgenossen am Bett von Sterbenden gestanden. Unwillkürlich drängen sich in solchen Ausnahmesituationen Fragen nach dem Woher und Wohin auf. Als Student war ich einmal live dabei, als ein Alkoholiker an einer geplatzten Krampfader in der Speiseröhre verblutete. Seinen letzten Satz werde ich nie vergessen: „Was wird jetzt aus mir?“ Nicht nur der Patient, der in meiner Gegenwart sein Leben aushauchte, wollte die Antwort wissen, sondern ich auch.
Ich meine, die Tatsache, dass wir Menschen mit einem Bewusstsein ausgestattet sind, nimmt uns in die Pflicht, uns mit dem Ursprung und dem Ziel unseres Lebens auseinanderzusetzen.
Victor von Bonin betrachtet den Sachverhalt aus den verschiedensten Blickwinkeln. Welche Erkenntnisse zur Entstehung unseres Universums liegen derzeit vor? Und wie erklärt sich der geheimnisvolle Übergang von der toten Materie zur ersten lebenden Zelle? Auf unterhaltsame Weise führen die Kapitel den Leser durch die Welt der Physik und Biologie. Aha-Erlebnisse sind garantiert, unabhängig davon, ob der Leser naturwissenschaftlich vorbelastet ist oder nicht.
Nach einem interessanten Ausflug in den Bereich der Philosophie beschreibt der Autor eine Reihe von Argumenten, die für bzw. gegen die Existenz Gottes sprechen. Victor von Bonin verliert sich nicht in unwesentlichen Details, sondern stellt den Bezug zum Ausgangspunkt auf verständliche Weise her. Angst vor kontroversen Positionen hat er keine. Warum sollte er auch? Die geäußerten Einsichten werden auch für Andersdenkende schwer zu entkräften sein.
Nach einem Exkurs über die Bedeutung des Buchs der Bücher beschreibt von Bonin mit sehr persönlichen Worten seine eigenen Schlussfolgerungen. Dabei beruhen seine Erkenntnisse auf einer soliden argumentativen Basis. Noch viele Tage nach dieser Lektüre gingen mir die verschiedenen Aspekte seiner Beweisführung durch den Kopf. Und ich begann darüber nachzudenken, wie man das Buch nach seiner Veröffentlichung möglichst vielen Lesern zugänglich machen könnte. Ich bin überzeugt, es wird Ihnen wertvolle Impulse auf Ihrer Suche nach der Wahrheit über Gott und sich selbst liefern.
Klaus-Dieter John, Gründer Hospital Diospi Suyana in PeruCurahuasi, Peru, im Februar 2024
Einleitung:Wer und wozu bin ich?
Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, sondern wir müssen uns nach ihr richten.
(Matthias Claudius, deutscher Dichter und Journalist1)
Eine persönliche Fragestellung mit überraschenden Einsichten
Das Thema dieses Buches beschäftigt mich seit meiner Kindheit. Schon immer wollte ich wissen, was ich eigentlich hier auf der Erde mache und welchen Sinn mein und unser aller Leben hat. Vielleicht geht es Ihnen ja von Zeit zu Zeit genauso. Mir zumindest ließ diese Frage keine Ruhe mehr, und so überlegte ich immer wieder, ob ich dem Ganzen nicht irgendwie auf den Grund gehen könne.
Auch wenn es wohl kaum eine grundlegendere Frage gibt, im Alltag drängen wir diese mehrheitlich beiseite: Als jugendlicher Mensch haben wir andere Interessen und wollen die Welt kennenlernen, als junger Erwachsener möchten wir im Beruf vorankommen und eine Familie gründen, als gestandener Erwachsener möchten wir finanzielle Ziele erreichen und das Haus abbezahlen, im Rentenalter möchten wir die restlichen Jahre noch ein wenig genießen und unser gelebtes Leben nicht mehr infrage stellen. Weil somit andere Fragen immer wichtiger erscheinen, nehmen wir uns nicht die Zeit für diese entscheidende Lebensfrage.
Einmal abgesehen davon: Die Frage scheint auch nicht beantwortbar. Oder ist sie vielleicht dahingehend geklärt, dass die Existenz des Menschen das Ergebnis vieler Zufälle ist und ihr somit kein Sinn zugrunde liegt? Mit dem Tod wäre dann letztendlich alles vorbei. Somit wäre das Rezept für ein gutes Leben: Genieße den Tag, denn du weißt nicht, was morgen ist. Ganz nach dem Motto: Carpe diem! oder YOLO (You only live once – Du lebst nur einmal!). Für denjenigen, der etwas feinsinniger veranlagt ist, kann man noch hinzufügen: Man lebt weiter in den Gedanken der anderen. Wer dennoch nach einem Sinn fragt, erhält die Frage auch gern zurückgespiegelt: „Das Leben hat den Sinn, den du ihm gibst.“
So könnte es vielleicht sein: Das materialistische Weltbild beruft sich auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaften und auf rationales Denken. Demnach ist alles Geschehen auf der Welt, und insbesondere der Mensch, vollumfänglich determiniert durch naturgesetzliche Prozesse. Das klingt so vernünftig, dass sich dieses Weltbild in den letzten Jahrzehnten in Europa und den USA immer weiter durchgesetzt hat und kaum noch infrage gestellt wird. Wenn es stimmt, sind wir einfach ein Zufallsprodukt absichtsloser chemischer Reaktionen und es gibt keinen tieferen Sinn des menschlichen Lebens.
Daneben gibt es noch die Vorstellung eines Gottes als Schöpfer des Universums. Bei uns ist am verbreitetsten das Christentum, das dem Gott vertraut, der sich in der Bibel offenbart hat.
Ist es nicht eigentümlich, dass die gängigsten Denkmodelle bei uns in Europa etwas völlig Gegensätzliches über den Menschen aussagen? Wenn der Materialismus recht hat, sind wir letzten Endes eine Laune der Natur und ein Produkt des Zufalls. Wenn das Christentum recht hätte, wäre jeder Mensch in Relation zu Gott, also dem größten Denkbaren, zu sehen. Eine größere Diskrepanz kann man sich fast nicht vorstellen. Schon deshalb ist es spannend, dieser Frage nachzugehen.
Wie kann man vorgehen, um die richtige Antwort zu finden? Ein Ansatzpunkt ist, dass man dem materialistischen Weltbild auf den Grund geht. Schließlich behauptet dieser Ansatz, alle Phänomene dieser Welt zumindest dem Wesen nach beantworten zu können. Da ich als Physiker selbst Naturwissenschaftler bin, liegt mir dieses Vorgehen. Diesen Ansatzpunkt verfolge ich auch in den ersten Kapiteln dieses Buches:
Kann das materialistische Weltbild, basierend auf der Wissenschaft, die Welt, und hier vor allem das Leben, angemessen beschreiben? Und wenn nicht: Was kann die Wissenschaft denn beschreiben, und an welchen Stellen kommt sie nicht weiter? Diese Frage werde ich in Teil 1 dieses Buches angehen. Im Ergebnis wird sich herausstellen, dass insbesondere die Beschreibung von Leben durch die Wissenschaft außerordentlich unbefriedigend ist. Die Wissenschaft kann weder die Frage beantworten, wie Leben überhaupt entstanden ist, noch, wie so ein kompliziertes informationstragendes Molekül wie die menschliche DNA (menschliche Erbinformation) entstehen konnte – welches gewissermaßen das längste Wort der Welt ist mit mehreren Milliarden Buchstaben –, und auch nicht die Frage nach der Entstehung von menschlichem Bewusstsein. Offenbar fehlt etwas Wesentliches. Und offensichtlich bedarf es auch beim Materialismus eines „großen Glaubens“, um dieses Weltbild für sich zu übernehmen.
Dennoch ist dieses Weltbild das vorherrschende in unserem Kulturkreis. Woher kommt das? Eine Antwort liefert die Philosophie. Die Philosophie kann die offenen Fragen zwar nicht auflösen, aber sie hilft nachzuvollziehen, warum der Mensch heutzutage das materialistische Weltbild bevorzugt.
Das führt zurück zu der Frage, ob es nicht doch einen Gott gibt. Ich suche nach Anhaltspunkten im zweiten Teil. Die finden wir z. B. in persönlichen Erlebnissen, die Sie und ich machen. Gibt es Erfahrungen, die über ein materialistisches Verständnis des Menschen hinausweisen? Ist es sinnvoll, über die Existenz eines Gottes nachzudenken? Wenn ja, wie könnte man etwas über ihn herausfinden?
Im dritten Teil beschäftige ich mich mit der Bibel und dem christlichen Glauben. Ich kann Ihnen versprechen, dass dies sehr spannend werden wird, ganz im Gegensatz zum verbreiteten Glauben, dass die Bibel eine Ansammlung von Legenden sei. Ich war selbst überrascht, als ich langsam in die Faszination der Bibel eintauchte. Ich lade Sie ein, mich dabei zu begleiten.
Was ist Wahrheit?
Gibt es eine Wahrheit?
Ich habe den Titel dieses Buches mit dem Untertitel „Eine Wahrheitssuche …“ versehen. Jetzt könnte man kritisch fragen, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt, und wenn ja, ob sie für den Menschen auch zugänglich ist. Mit „Wahrheit“ meine ich das, was hinter allen Erscheinungen dieser Welt steckt. Die Frage nach der Wahrheit ist somit die Frage nach dem Urgrund allen Seins. Die Hoffnung ist: Wenn man darüber etwas wüsste, dann kann man auch etwas über unsere Bestimmung als Mensch sagen.
Wie kann man sich an diese Wahrheit herantasten? Der logische Weg, um ihr nachzuspüren, ist sicherlich, mit dem anzufangen, was wir über die Welt zu wissen glauben. Damit sind wir im Bereich der Naturwissenschaften. Als Wissenschaftler ist man doch überrascht, wie „vernünftig“ die Welt ist und dass man sie überhaupt in gewissen Grenzen naturwissenschaftlich verstehen und in mathematische Formeln kleiden kann. Bereits Albert Einstein sagte: „Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen können.“2 Ich würde noch ergänzen wollen: dass wir es ansatzweise verstehen können. Aber immerhin: Es gibt eine gewisse Logik in der Welt, und hinter einer Logik gibt es Regeln, und dies weist auf die Existenz einer Wahrheit hin.
Es gibt jedoch auch viel Erstaunliches und Geheimnisvolles in der Wissenschaft. Das macht auch ihren Reiz aus. Albert Einstein sagte: „Das Schönste, das wir erfahren können, ist das Geheimnisvolle.“3 Das Geheimnisvolle gehört zur Wissenschaft, und das Wundern darüber ist Teil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Daher ist wissenschaftliche Erkenntnis immer vorläufig, und es gehört zum wissenschaftlichen Denken dazu, immer wieder zurückzutreten und neu darüber nachzudenken, was man wirklich weiß.
Es ist aber auch offensichtlich, dass eine Wahrheitsdefinition etwas Manipulierbares ist. Ein Mensch oder eine Institution wird gern das als Wahrheit bezeichnen, was ihm oder ihr nützt. Deshalb wird Wahrheit mitunter manipuliert, um das eigene Tun zu rechtfertigen. Vielleicht sind es andere Menschen, die in Form von Macht, die sie innehaben, auf diese Weise über uns verfügen. Vielleicht sind es aber auch wir selbst, denn als Menschen sind wir genauso dafür anfällig, das als wahr anzunehmen, was für uns selbst angenehm ist.
Platons Höhlengleichnis
Schon Platon (428–348 v. Chr.), der griechische Philosoph, machte sich Gedanken darüber, wie die Welt beschaffen ist. Er kam zu dem Schluss, dass wir Menschen womöglich eine nur sehr eingeschränkte Sicht einer größeren Wirklichkeit haben. Infolgedessen würde sich der Mensch eine Wahrheit auf der Grundlage unvollständiger Informationen selbst zusammenreimen, die aber nicht der Wahrheit aufgrund einer objektiven äußeren Sicht entspricht. Nach Platon hat sich der Mensch aber in seiner eingeschränkten Welt eingerichtet und bezeichnet das als Wahrheit, was ihm in dieser Situation am meisten nützt. Würde eine andere, größere Wahrheit an ihn herangetragen werden, würde er den Überbringer womöglich töten. Diese Sichtweise fasste Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis zusammen. Nach Platon sind die Menschen so sehr in ihrer Sichtweise gefangen, dass sie auch nur diese als ihre Realität gelten lassen würden. Wir müssen in unsere Überlegungen einbeziehen, dass die Realität anders und überraschender sein könnte, als wir dies in unserem Alltag normalerweise erfahren.
Das Höhlengleichnis nach Platon
Platon stellte sich Gefangene in einer Höhle vor. Sie sitzen auf dem Boden der Höhle und sind so festgebunden, dass sie sich nicht bewegen und auch ihre Köpfe nicht drehen können. Folglich blicken sie gezwungenermaßen immer auf die gegenüberliegende Höhlenwand. Hinter den Gefangenen lodert ein Feuer, und der Schein des Feuers fällt auf die Wand. In dieser fixierten und starren Haltung können sich die Gefangenen zwar nicht bewegen, wohl aber sich miteinander unterhalten. Allerdings erleben sie sich gar nicht als Gefangene. Sie kennen es gar nicht anders, dies ist ihr normaler Seinszustand. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen verläuft ein Weg mit einer niedrigen Mauer. Hinter dieser laufen Menschen entlang, die Gegenstände hin und her bewegen, z. B. Nachbildungen von Menschen und Tieren oder anderen Gegenständen. Das Feuer im Hintergrund projiziert deren Schatten auf die Wand. Die Gefangenen sehen also nur diese Schatten und interpretieren sie. Teilweise reden die Menschen, welche die Figuren tragen, auch. Und obwohl die Gefangenen die Träger nicht sehen können, so hören sie doch ihre Worte. Die Gefangenen beginnen zu diskutieren. Sie versuchen, das gemeinsam Erlebte – die Stimmen und die Schatten der Figuren – zu deuten und Vorhersagen zu treffen, also eine Art „Schattenwissenschaft“ zu betreiben. Wem dies am besten gelingt, dem gebührt die meiste Ehre.
Einem der Gefangenen werden nun die Fesseln abgenommen, und er wird aus der Höhle ins Tageslicht herausgeführt, wo er die Wirklichkeit erkennen könnte: dass die Gefangenen lediglich die Schatten von Figuren sehen, die von Menschen hin und her getragen werden. Allerdings wird der Gefangene so sehr von dem Licht geblendet, dass er erst einmal gar nichts erkennen kann und wieder an seinen Höhlenplatz zurückgeführt werden möchte. Er will lieber seine alte Sichtweise beibehalten, als die Wahrheit zu erkennen.
In einem zweiten Schritt wird derselbe Gefangene gezwungen, aus der Höhle herauszutreten. Man gibt ihm Zeit, sich an das Licht zu gewöhnen. So erkennt er nun nach und nach die Wahrheit über die Höhle und die Situation der Gefangenen. Würde man ihn nun wieder an seinen alten Platz zurückführen, so käme er dort erst einmal gar nicht zurecht: zum einen wegen der Dunkelheit, an die sich seine Augen erst wieder gewöhnen müssten. Zum anderen hätte er aber auch gar keine Freude mehr an der „Schattenwissenschaft“, da diese im Licht der ihm offenbar gewordenen Wirklichkeit nur eine Spielerei wäre. Beides zusammen würde dazu führen, dass er an seinem alten Platz nicht mehr richtig „lebensfähig“ wäre. Seine Mitgefangenen würden ihn eher auslachen und urteilen, dass es ihm offenbar nicht gut bekommen sei, hinausgeführt worden zu sein. Zudem wären sie der Ansicht, dass man jeden, der einen hinausführen wolle, umbringen müsse.4
Schritt für Schritt – Aufbruch zu einer Gedankenreise
Die Gliederung dieses Buches folgt einer Gedankenreise durch die Themengebiete Physik, Biologie, Philosophie, Intuition, Bibel und christlicher Glaube. Jedes Themengebiet steuert zur Frage „Wer bin ich?“ seinen Blickwinkel und seine Erkenntnisse bei. Ich habe mich bemüht, die Recherchen und Argumente jeweils nachvollziehbar in Form von Fußnoten, Literaturverweisen, ergänzenden Informationen im Anhang und QR-Codes zu weitergehenden Informationen so zu belegen, dass der Leser und die Leserin die angesprochenen Themen nach Bedarf selbst noch vertiefen können.
Die beiden naturwissenschaftlichen Kapitel enthalten naturgemäß manche Fachbegriffe und Überlegungen, die diesen Wissenschaftsdisziplinen zu eigen sind. Dennoch habe ich versucht, die Sachverhalte gut nachvollziehbar zu erklären. Die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen/philosophischen Kapitel sind zudem in Übersichten zusammengefasst, um die wesentlichen Aussagen auf den Punkt zu bringen. So haben Sie alles auf einen Blick und können auch zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls noch einmal nachlesen.
Ich möchte Ihnen als Leserin oder Leser Denkanregungen geben zu der Frage, wie Sie sich als Mensch begreifen dürfen. Ich glaube, jeder hat, wenn auch unbewusst, diese Frage für sich ohnehin bereits beantwortet, und zwar durch sein gelebtes Leben. Schließlich setzt jeder Mensch Prioritäten in seinem Leben, die darauf hinweisen, wie er sich als Mensch versteht. Wäre es nicht besser, diese Frage bewusst anzugehen auf Basis von Erkenntnissen und Erfahrungen, die der Menschheit vorliegen? Ich selbst war überrascht, wohin mich meine Recherche getragen hat, und ich bin dankbar für die gewonnenen Einsichten, die mein Leben verändert haben.
Irgendwann ist das Nachdenken über dieses Thema nicht mehr möglich – spätestens nach dem Tod. Ich denke dabei auch an Menschen, die ich gekannt habe und die vorzeitig aus dem Leben gerissen wurden. Sie haben sich vielleicht nie bewusst mit dieser Frage auseinandergesetzt. Vielleicht hätten sie ihr Leben und auch das Sterben aus einem anderen Blickwinkel gesehen?
So also ist der Plan! Auf geht’s!
TEIL I
Kann der Materialismus das menschliche Dasein erklären?
Was kann uns die Physik über unser Lebensumfeld sagen?
Von der Entstehung des Universums, der rätselhaften Feinabstimmung und über das Wesen von Raum und Zeit
Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
(Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter5)
Was untersucht die Physik?
Die Physik untersucht Phänomene der unbelebten Natur und versucht herauszufinden, wie man Erscheinungen und deren Verhalten in Raum und Zeit beschreiben kann, und zwar indem man die Erscheinungen auf elementare Grundbausteine und Wechselwirkungen zurückführt.
Der Wissenschaftler befragt dabei mithilfe von Experimenten die Natur, und diese wiederum geben ihm auf seine Fragen Antworten. Idealerweise kann das Ergebnis im Anschluss in einer Theorie und in einer mathematischen Ausformulierung zusammengefasst werden. Diese Theorie und die daraus resultierenden Vorhersagen müssen dann natürlich erneut experimentell überprüft werden. Danach wird die Theorie entweder bestätigt oder aber bei Widersprüchen modifiziert bzw. durch eine bessere ersetzt.
Dass die Physik uns viele Fortschritte ermöglicht hat, ist kein Geheimnis. Ein paar Beispiele: Durch das Verständnis grundlegender physikalischer Gesetzmäßigkeiten gelang es im Zusammenspiel mit dem einhergehenden technologischen Fortschritt, immer leistungsfähigere Computer und Smartphones mit früher nicht für möglich gehaltenen Fähigkeiten zu entwickeln. Beides ist heute nicht mehr wegzudenken. Oder denken Sie an die großartigen technischen Herausforderungen wie beispielsweise die Raumfahrt oder die Satellitentechnologie. Ohne die Physik wären sie nicht zu meistern gewesen. Nicht zuletzt deswegen vertraut zumindest der größte Teil der Bevölkerung darauf, dass der Mensch die Natur offenbar gut verstanden hat. All das hat dazu geführt, dass die Naturwissenschaften große Anerkennung erfahren haben.
Die Erkenntnisse der Physik brachten der Menschheit aber nicht nur die genannten technischen Errungenschaften, sondern sie gaben auch Antworten auf Fragen, die man sonst vielleicht gar nicht gestellt hätte: „Was ist Zeit?“ Oder: „Was ist Raum?“ Über diese Fragen kam man dann zu den noch grundlegenderen Fragen: „Wieso gibt es überhaupt etwas?“ Oder: „Wie ist die Welt um uns herum entstanden?“ Somit sind wir in der Physik auch der Menschheitsfrage auf der Spur.
Bei letzteren Fragen hat die Physik das Problem, dass sie diese nicht in einem Experiment direkt untersuchen kann: Der Physiker kann die Entstehung des Weltalls beispielsweise nicht im Experiment nachstellen. Um über das Universum zu forschen, ist der Astronom vielmehr darauf angewiesen, das zu untersuchen, was als Strahlung aus den Tiefen des Weltalls auf die Erde trifft. Hier ist der Mensch mit unfassbar großen Skalen konfrontiert, deren Größenordnungen für uns nur schwer vorstellbar sind: So haben wir es bei der Zeit mit Milliarden von Jahren zu tun, während die räumliche Distanz die Wegstrecke umfasst, die das Licht in diesen Milliarden von Jahren zurücklegt. Es stehen hier also nur beschränkt auswertbare Informationen zur Verfügung, auf die sich der Physiker dann irgendwie einen Reim machen muss. Dennoch können plausible Theorien aufgestellt werden. Allerdings sind diese in der Regel nicht so gut abgesichert und lassen immer noch Raum für Spekulationen.
Die Physik ist eine Wissenschaft, die die Phänomene der Natur nur beschreibt, aber nicht erklärt. Natürlich kann man, wenn man verschiedenartige Phänomene untersucht und diese trotz ihrer Verschiedenartigkeit auf grundlegendere Mechanismen zurückführen kann, auch von einem Verständnis sprechen. Als Beispiel sei hier der englische Physiker Isaac Newton (1643–1727) genannt, der herausfand, dass die Kraft, die den Apfel vom Baum auf die Erde fallen lässt, dieselbe ist, die auch den Mond um die Erde kreisen lässt, nämlich die Gravitationskraft. Newton hatte auf diese Weise ein tieferes Verständnis der Gravitation gewonnen. Aber woher die Gravitationskraft kommt und warum sie gerade so ist, wie sie vermessen wird, darüber kann die Physik keine Aussage machen. Das sah Newton auch selbst so. Am Ende seines berühmten Werkes „Principia Mathematica“ schreibt er: „Ich habe bisher die Erscheinungen der Himmelskörper und die Bewegungen des Meeres durch die Kraft der Schwere erklärt, aber ich habe nirgends die Ursache der letzteren angegeben.“6
Die Physik handelt von Teilchen, die auf irgendeine Weise (die zu erforschen ist) miteinander wechselwirken. In der Regel sind dies Elementarteilchen, also Teilchen, die man nicht weiter in kleinere Teilchen zerlegen kann. Im Idealfall kann man über das Erforschen des Verhaltens der kleinen Teilchen dann auch Aussagen darüber machen, wie sich die „Welt im Großen“ verhält. Abgesehen davon gibt es dann noch die „Bühne“, auf der die Teilchen miteinander agieren. Man würde vermuten, dass diese „Bühne“ einfach das Universum ist, das sogenannte Raum-Zeit-Kontinuum. Wir werden sehen, dass es sich aber um eine sehr spezielle „Bühne“ handelt.
Sehen wir uns die Resultate der Physik nun einmal näher an. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich auf diesen Reiseabschnitt einzulassen. Sie werden staunen! Wem die Denkweise der Physik allerdings zu fremd ist, der kann gegebenenfalls auch gleich zum „Fazit“ vorblättern.
Die „Welt im Kleinen“: Die fundamentalen Kräfte in der Physik
Eine erste erstaunliche Aussage der Physik ist, dass man genau vier bestimmte Kräfte in der (unbelebten) Natur identifizieren kann. Diese vier Kräfte wirken auf unterschiedlichen Ebenen und haben verschiedene Eigenschaften. Es lohnt sich, sich diese vier Kräfte einmal vor Augen zu führen. Die Physik bezeichnet sie als Wechselwirkungen und identifiziert folgende:
•Gravitation: Diese Kraft ist uns geläufig. Die Gravitation bewirkt, dass wir von der Erde angezogen werden – so wie der berühmte „Newtonsche Apfel“, der zu Boden fällt. Die Gravitation ist aber auch verantwortlich dafür, dass Himmelskörper umeinanderkreisen (wie die Erde um die Sonne) oder Sternensysteme sich zu Galaxien zusammenballen. Die Gravitation ist sehr langreichweitig (über sehr große Distanzen wirksam) und somit die einzige Wechselwirkung, die bei großen Distanzen relevant ist. Diese Wechselwirkung spielt immer dann eine Rolle, wenn massebehaftete Körper oder Teilchen (d. h. Körper und Teilchen, die ein Gewicht haben) involviert sind. Die Gravitationskraft kann nicht abgeschirmt werden.
•Elektromagnetische Wechselwirkung: Auch diese Kraft ist uns im Alltag geläufig. Wir kennen elektrischen Strom und auch Magnetismus. Beide Kräfte bedingen einander, denn fließender Strom erzeugt ein Magnetfeld, und ein sich veränderndes Magnetfeld induziert umgekehrt elektrischen Strom. Diese Wechselwirkung spielt aber nur dann eine Rolle, wenn man Teilchen mit einer elektrischen Ladung hat.
•Schwache Wechselwirkung: Diese ist weniger anschaulich. Sie spielt bei Zerfallsprozessen oder Umwandlungen von Elementarteilchen eine Rolle. Für unser Leben ist vor allem der Fusionsprozess in der Sonne relevant, bei dem Wasserstoff zu Helium unter Beteiligung der schwachen Wechselwirkung fusioniert. Bei diesem Prozess wird Energie frei, die die Sonne leuchten lässt und bei uns auf der Erde Leben ermöglicht.
•Starke Wechselwirkung: Diese Wechselwirkung ist sehr stark, aber nur bei sehr, sehr kurzen Distanzen innerhalb eines Atomkerns wirksam (kurzreichweitig). Sie führt dazu, dass sich Materie zu Atomkernen verdichtet (obwohl in den Atomkernen starke positive Ladungen konzentriert sind, die sich eigentlich abstoßen). Somit führt die starke Wechselwirkung dazu, dass stabile Atomkerne existieren, was eine Voraussetzung dafür ist, dass wir als Menschen existieren können. Wegen der Kurzreichweitigkeit spielt diese Kraft aber in unserem Alltag ansonsten keine Rolle.
Das sind also die fundamentalen Wechselwirkungen, die die Physik identifiziert hat. Sie untersucht ausschließlich die nicht belebte Materie, und man scheint grundsätzlich alles auf Basis dieser Kräfte und der Teilchen, auf die die Kräfte wirken, erklären zu können.
Die Kräfte sind aber nicht ohne die sogenannten Austauschteilchen zu denken, welche die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen, die der jeweiligen Kraft unterliegen, „vermitteln“. Im Fall der elektromagnetischen Wechselwirkung ist das Austauschteilchen das Photon bzw. Licht (wir können uns Licht als Welle vorstellen oder als Teilchen, in dem Fall spricht man von Photonen). Die Physik liefert zur Konstruktion der Welt also einen Baukasten mit Bausteinen sowie mit Wechselwirkungen zwischen diesen Bausteinen.
Allerdings kann die Physik nicht begründen, warum diese Bausteine und Kräfte so und nicht anders sind und warum sie gerade die Stärke haben, die sie haben, und nicht stärker oder schwächer sind. Die Physik kann also nur beschreiben, was sie herausgefunden hat, nicht aber, warum dies so ist. In der Beschreibung der Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen tauchen verschiedene Größen auf, die man nur experimentell ermitteln kann. Diese geben z. B. die Geschwindigkeit des Lichts an oder aber, wie stark die einzelnen Kräfte sind oder wie groß die Ladung eines Elektrons ist. Diese Größen bezeichnet man als Naturkonstanten. Man kann sie nicht herleiten, sondern muss sie als gegeben hinnehmen.
Wir haben nun gesehen, wie die „Akteure“, d. h. die Elementarbausteine, agieren und wechselwirken. Kann die Physik auch etwas über die „Bühne“, auf der dies geschieht, aussagen?
Die „Welt im Großen“: Über die Entstehung des Universums
Wenn wir von der Erde ins Weltall schauen, können wir dort nirgends eine Grenze erkennen. Das ändert sich auch dann nicht, wenn wir statt mit dem Auge mit leistungsfähigen Teleskopen ins Weltall blicken. Das Weltall ist riesengroß. Es stellt sich die Frage: War das schon immer so? Oder ist das Weltall irgendwann einmal entstanden? Wie ist das mit Raum und Zeit?
Aber: Sind all diese Frage nicht überflüssig? Es scheint doch klar zu sein, dass es die Zeit schon immer gegeben haben muss. Sich vorzustellen, dass die Zeit einmal einen Anfang gehabt haben soll, fällt schwer. Genauso der Raum: Ist er nicht einfach da, und zwar schon immer?
Wer so denkt, geht von einem statischen Universum aus und ist in guter Gesellschaft mit Albert Einstein. Der stellte einst Gleichungen über die Gesetzmäßigkeiten des Universums auf, wobei die mathematische Ausformulierung ihm gewisse Freiheiten bei der Ausgestaltung der Lösung gab. Mit dieser Gestaltungsfreiheit konnte er entweder ein statisches Universum, ein expandierendes Universum oder ein kontrahierendes Universum prognostizieren. Er entschied sich für das statische Universum. Erst später war man in der Lage, zu vermessen, dass sich Objekte, die sich weit von uns entfernt im Weltraum befinden, von uns wegbewegen, und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Dies kann man nur so deuten, dass das Universum expandiert. Das bedeutet also, dass es heute größer ist als noch zu einem früheren Zeitpunkt. Wenn man nun zurückrechnet, muss man schließlich annehmen, dass das Universum einmal als „Punkt“ begonnen haben muss: mit dem sogenannten Urknall.
Aber das Universum begann nicht als „Punkt“ im existenten Raum, sondern der Raum selbst entstand erst in diesem Moment. Und die Expansion des Universums bedeutet, dass der Raum selbst sich aufbläht und dabei die im Raum verteilten Massen mitnimmt. Man kann es sich ähnlich vorstellen wie bei einem gepunkteten Luftballon: Wenn der Luftballon sich aufbläht – analog zur Expansion des Universums –, entfernen sich auch die Punkte auf dem Luftballon immer weiter voneinander – analog zu den Galaxien im Weltraum, die sich immer weiter von uns entfernen.7 In der Annahme des statischen Universums hatte Einstein sich also geirrt und soll dies später seine größte Eselei genannt haben.8
Jetzt haben wir also etwas über die „Bühne“ erfahren, auf der sich das „Schauspiel der Geschichte des Universums“ ereignet hat, und überraschenderweise ist die „Bühne“ selbst erst entstanden und war nicht schon immer da.
Das Wunder der Feinabstimmung
Wenn wir das Vorhergehende zusammenfassen, legt uns die Physik also nahe, dass das Universum einen Anfang hatte (auch wenn wir nicht wissen, wodurch dieser Anfang ausgelöst wurde). Die Physik hat dazu ein Modell entwickelt: Das Universum entstand als Urknall aus Gründen, die wir nicht kennen, und blähte sich auf. Es entstanden Teilchen, die sich unter dem Einfluss der Gravitation zu wachsenden Materieverdichtungen zusammenballten. Diese wurden immer schwerer, sodass schließlich unter dem immensen Druck der Gravitation Fusionsreaktionen der Art stattfanden, dass die einfachsten Atome (Wasserstoff) miteinander verschmolzen und so zum zweit-einfachsten Atom (Helium) fusionierten. Dabei wurde Energie frei, die als Strahlung in den umgebenden Raum emittiert wurde.
Damit ist die Aktivität einer Sonne beschrieben, wie wir sie im Sonnensystem bei „unserer“ Sonne beobachten können. Ihre Strahlung macht als Licht und Wärme Leben auf der Erde möglich. Es gibt noch unzählige weitere Sonnen, die wir aufgrund der großen Distanz als Sterne wahrnehmen.
Nach der ersten Fusionsreaktion kam es zu weiteren Fusionsprozessen, und zwar von Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff und weiteren noch schwereren Atomen. An diesem Punkt entstanden also die Atome, aus denen unsere Erde und wir Menschen aufgebaut sind. Da der Mensch überwiegend aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist, kann man zu Recht sagen, dass jeder Mensch aus Sternenstaub besteht, entstanden in den Fusionsreaktionen eines Sterns in der Endphase seines Lebenszyklus.
Beim sogenannten Heliumbrennen9 zu Kohlenstoff müssen sich drei Helium-Ionen so treffen, dass daraus ein Kohlenstoff-Ion wird. Da man Helium-Ionen auch als Alpha-Teilchen bezeichnet, spricht man von einem Drei-Alpha-Prozess. Mathematisch dürfte das gar nicht funktionieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass drei Teilchen innerhalb des erforderlichen Zeitfensters aufeinandertreffen, zu klein ist.
Dieser Vorgang war für die Wissenschaftler ein Problem, denn offensichtlich existiert Kohlenstoff. Aber wie war er entstanden? In der Not, eine Erklärung liefern zu wollen, prognostizierte der britische Wissenschaftler Fred Hoyle (1915–2001) daher, dass es einen angeregten Energiezustand des Kohlenstoff-Atoms geben müsse. Dieser müsse identisch sein mit dem Energieniveau eines Zwischenzustands aus zwei Alpha-Teilchen und der Energie eines dritten Alpha-Teilchens. Nach den Gesetzen der Physik hat dieser Zustand eine längere Lebensdauer, und der Wirkungsgrad der Reaktion steigt beträchtlich, sodass laut Hoyle Kohlenstoff entstehen kann. Tatsächlich wurde diese von Fred Hoyle aus der Not geborene Annahme später bestätigt. Experimentell wurde dies durch den amerikanischen Physiker William Alfred Fowler (1911–1995) nachgewiesen, der dafür 1983 den Nobelpreis erhielt.
Die Existenz dieses angeregten Energieniveaus, und zwar gerade auf dem notwendigen Niveau, mag als spitzfindiges Detail erscheinen. Aber Fred Hoyle war klar: Die ganze Existenz unseres Universums in der uns bekannten Form hing daran, dass die Fusion von Kohlenstoff durch den „Flaschenhals“ des Heliumbrennens über dieses angeregte Kohlenstoff-Energieniveau möglich war.
Fred Hoyle verwunderte dieser Umstand sehr. Die Tatsache, dass das angeregte Energieniveau des Kohlenstoffatoms exakt so vorlag, dass die Welt, so wie wir sie kennen, entstehen konnte, ließ ihn glauben, dass unsere Welt vielleicht durch einen Superintellekt „gewollt“ sei oder einen „Zweck“ habe.10
Nun ist dies nicht der einzige seidene Faden, an dem die Existenz unserer Welt hängt. Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Konstanten in der Physik, die sich nicht herleiten, sondern nur messen lassen. Dazu gehören z. B. die Newtonsche Gravitationskonstante (die die Stärke der Gravitation festlegt), die Lichtgeschwindigkeit, die Elementarladung, die Ruhemassen von Elektron und Proton, das Plancksche Wirkungsquantum und weitere.
Warum haben diese Größen gerade die Werte, die gemessen werden? Ist es einfach Zufall? Was würde denn passieren, wenn diese Größen andere Werte hätten? Letzteres kann man berechnen und kommt zu dem verblüffenden Ergebnis, dass all diese Parameter mit sehr hoher Präzision genau so sein müssen, wie sie sind. Wenn sie auch nur geringfügig davon abweichen würden, könnte das Universum nicht existieren. Es würde in der Folge z. B. sofort viel zu stark expandieren, sodass sich keine Massen verdichten könnten, oder aber es würde sofort kollabieren. Eine andere Folge wäre, dass sich gar keine stabilen Teilchen bilden würden. Und dies sind nur einige mögliche Folgen.
Dieser Befund, dass diese Konstanten gerade so sind, wie sie sein müssen, wird „Feinabstimmung“ genannt. Muss man sich darüber wundern, dass es so ist? Ich würde sagen, man sollte sich zumindest wundern. Nun lässt sich natürlich einwenden, dass wir Menschen aber nun einmal da sind – unter der notwendigen Voraussetzung, dass ein lebensfreundliches Universum existiert. Aber ich möchte hier ja gerade der Frage nachgehen, wie man die Existenz des Menschen verstehen muss. Und dann muss man sich fragen, warum es überhaupt ein lebensfreundliches Universum gibt.
Die gängigste Begründung für die Feinabstimmung ist die sogenannte Multiversentheorie. Demnach gebe es zahllose Universen, die dauernd mit den unterschiedlichsten Parametern gebildet würden. Die allermeisten so entstandenen Universen könnten aber nicht existieren, weil die Parameter nicht passten. Nur einige wenige kämen in die Existenz, nämlich dann, wenn die Parameter „zufällig“ so passten, dass ein langlebiges Universum entstünde. Notwendigerweise leben wir in genau solch einem Universum, also in einem, in dem Leben auch möglich ist. Natürlich mag es sein, dass es noch andere Universen gibt, allerdings könnten wir über diese prinzipiell nichts erfahren.
Nun kann man zu Recht fragen: Wenn doch schon einmal ein existenzfähiges Universum entstanden ist, warum sollte das dann nicht laufend geschehen? Allerdings verschiebt man das Problem der Frage nach der Existenz unseres Universums damit in einen Bereich, der nicht beweisbar ist. Denn ein Beweis der Existenz anderer Universen ist prinzipiell nicht möglich. Zudem müsste man dann auch wieder postulieren, dass, wie in einem fortlaufenden Roulette-Prozess, ständig Universen generiert werden. Dafür gibt es jedoch keinerlei Anhaltspunkte. Die Lösung für das Problem lautet also einfach, dass es purer Zufall sei, dass unser Universum entstanden ist. Wir behalten diese Argumentation einfach mal im Hinterkopf.
Das Wunder der Relativitätstheorie
Die Physik macht noch eine weitere sehr erstaunliche Aussage, die auch die Entstehung des Universums betrifft, vor allem aber unser Verständnis von Raum und Zeit in Verbindung mit Energie und Masse. Diese erstaunliche Entdeckung hat ihren Ausgangspunkt in der Vermessung der Geschwindigkeit, mit der sich Licht durch den Raum ausbreitet. Denn auch Licht breitet sich nicht instantan, d. h. ohne Zeitverzug, aus, sondern hat eine Ausbreitungsgeschwindigkeit. Diese ist mit ca. 300 000 Kilometern pro Sekunde zwar sehr hoch, aber eben nicht unendlich hoch. Für unsere Entfernungen auf der Erde spielt das in der Regel keine Rolle11, aber immerhin braucht das Licht ca. acht Minuten, um von der Sonne zur Erde zu gelangen.
Wenn wir von den Größenordnungen des Weltalls reden, dann ist die gebräuchliche Längeneinheit das Lichtjahr. Das ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das Alter des Universums wird auf 13,8 Milliarden Jahre geschätzt. Somit beträgt die maximale Entfernung, aus der Licht bisher auf die Erde treffen konnte, 13,8 Milliarden Lichtjahre. Die Größe des Universums wird jedoch größer geschätzt.
Aber nun zurück zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Diese hat nämlich eine interessante Eigenschaft. Hier kann uns ein Gedankenexperiment helfen.
Stellen wir uns vor, dass jemand eine Lichtquelle hat und die Geschwindigkeit des ausgesendeten Lichts misst. Er misst die Lichtgeschwindigkeit von 300 000 Kilometern pro Sekunde (km/s). Angenommen, diese Person bewegt sich nun auf uns zu. Welche Geschwindigkeit des Lichts werden wir dann messen? Man sollte annehmen, dass sich die von der Person gemessene Lichtgeschwindigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit der Person addieren. Alles andere wäre paradox. Aber tatsächlich messen wir immer 300 000 km/s – egal, wie schnell sich die Person auf uns zu bewegt. Dieses erstaunliche Ergebnis hängt damit zusammen, dass Strecke und Zeit in zueinander bewegten Systemen nicht identisch sind, was für unsere Vorstellung paradox ist.12 Dieser Befund hat weitreichende Konsequenzen, wenn man es zu Ende denkt.
Bereits 1887 wurde diese Konstanz der Lichtgeschwindigkeit durch den deutsch-amerikanischen Physiker Albert A. Michelson und den amerikanischen Chemiker Edward M. Morley im berühmten Michelson-Morley-Experiment bestätigt.13 Wie oben beschrieben, hebelt dieser Befund unser gängiges Verständnis von Raum und Zeit aus. Das Problem mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in zueinander bewegten Systemen14 war also seit 1887 bekannt. Man tat sich aber schwer damit, diesen Befund irgendwie sinnvoll zu erklären.
Erst Albert Einstein kam 18 Jahre später zu einer Lösung, indem er das Beobachtete ernst nahm und zu Ende dachte. Wenn man so will, könnte man sagen: Er nahm das Paradoxon ernst und erlangte dadurch eine grundlegende Erkenntnis in der Physik. Das war im Jahr 1905.15 Wir nennen es heute die Spezielle Relativitätstheorie. Diese besagt, dass Raum und Zeit tatsächlich relativ sind. Demzufolge gehen bewegte Uhren langsamer (Zeitdilatation): Könnte man sich selbst mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, würde die Zeit sogar gar nicht mehr vergehen. Man wäre also in einem zeitlosen Zustand! Eine Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit ist für Menschen aber nicht möglich. Teilchen oder Körper, die eine Masse haben, können niemals auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Wenn man versucht, ein massebehaftetes Teilchen in den Grenzbereich der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und ihm mehr Energie zuführt, nimmt stattdessen die Masse des Teilchens immer weiter zu, aber die Lichtgeschwindigkeit kann nicht erreicht werden.
Die Spezielle Relativitätstheorie kann man in einem Gedankenexperiment veranschaulichen, dem sogenannten Zwillingsparadoxon: Man geht von einem Zwillingspaar auf der Erde aus. Der eine Zwilling reist mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zu einem anderen Stern und kehrt danach wieder zur Erde zurück. Dort stellt man fest, dass der gereiste Zwilling weniger gealtert ist als der auf der Erde verbliebene Zwilling.16 Paradox!
Albert Einstein erweiterte die Spezielle Relativitätstheorie im Jahr 1915 zur Allgemeinen Relativitätstheorie, indem er die Relativitätstheorie auf das Verhalten in Gravitationsfeldern erweiterte (also unter dem Einfluss eines Schwerefeldes, z. B. von der Erde oder der Sonne). So vergeht die Zeit auf einem Berg (weniger Gravitation) schneller als im Tal.
All das wurde auch praktisch vermessen, indem man Flugzeuge starten ließ, die mit äußerst genauen Uhren ausgestattet waren und die eine Weile flogen (Hafele-Keating-Experiment, 197117). Dabei gibt es zwei Zeiteffekte: zum einen aufgrund der Bewegung der Uhren zueinander (auf dem Boden und im Flugzeug) und zum anderen dadurch, dass sich das Flugzeug in ca. 10 000 Meter Höhe bewegte. Tatsächlich stellte man fest, dass die Uhr im Flugzeug gegenüber der Uhr am Boden unterschiedlich schnell lief, und die Abweichung der Uhren bestätigte die Berechnungen der Allgemeinen Relativitätstheorie.
Die Effekte sind natürlich nur sehr klein. Aber immerhin müssen sie z. B. bei satellitengestützten Navigationssystemen (GPS) berücksichtigt werden, weil es hier auf maximale Präzision ankommt.
Dieser Befund führte Einstein dazu, dass er auch die Gravitation neu interpretierte, nämlich als eine Krümmung des Raumes: Auch Licht wird von schweren Massen (z. B. der Sonne) abgelenkt, bzw. – in der Sprache der Relativitätstheorie – folgt es der Raumkrümmung um diese Massen herum. Wenn man das Licht eines Sterns auf der Erde beobachtet, müsste man eine scheinbare Positionsveränderung des Sterns feststellen, wenn sich z. B. die Sonne in den Strahlengang des Sterns schiebt und dessen Licht ablenkt.
Normalerweise kann man das schlecht messen, weil die Sonne das Licht des Sterns weit überstrahlt. Am 29. Mai 1919 gab es jedoch die Möglichkeit einer experimentellen Überprüfung, weil an diesem Tag eine Sonnenfinsternis stattfand: Durch die Abdunklung der Sonne konnte das Licht eines hinter der Sonne positionierten Sterns analysiert werden. Man wollte überprüfen, ob das Licht des Sterns durch die in den Strahlengang wandernde Sonne abgelenkt wurde. Nach der Theorie sollte es sich auf der Erde so darstellen, dass sich die scheinbare Himmelsposition des Sterns verschieben würde. Der britische Astrophysiker Arthur Stanley Eddington (1882–1944) reiste dazu auf die Insel Príncipe, die vor der westafrikanischen Küste liegt und im Kernschatten der Sonnenfinsternis lag. Er konnte nach Auswertung der fotografischen Aufnahmen die Vorhersagen Einsteins bestätigen, und seitdem war Einstein ein Star. Einen Tag nach der Bestätigung der Vorhersagen Einsteins titelte die englische Tageszeitung The Times am 7. November 1919: „Wissenschaftliche Revolution – Neue Theorie vom Universum“18.
Im Jahr 1921 erhielt Albert Einstein den Nobelpreis, allerdings nicht für die Allgemeine Relativitätstheorie. Diese tauchte in der Begründung des Nobelpreis-Komitees gar nicht auf. Offenbar erschien dem Komitee die Theorie immer noch zu revolutionär und zu wenig bestätigt. Einstein erhielt den Nobelpreis für den photoelektrischen Effekt, bei dem er das Licht „gequantelt“ gedacht hatte, d. h., er hatte eine Teilchenvorstellung für das Licht formuliert. Das war aber schon im Jahr 1905 gewesen.
Für die Zwecke meiner Fragestellung ist mir Folgendes besonders wichtig: Einstein zeigte, dass Raum und Zeit nicht absolut sind und dass beide auch abhängig sind von den sie umgebenden Massen. Somit bedingen Zeit, Raum, Masse und Energie einander. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Ich hatte das Kapitel mit der normalerweise logischen Unterscheidung zwischen „Bühne“ und „Akteuren“ eingeleitet, also den Teilchen, die miteinander wechselwirken. Sie erinnern sich. Jetzt zeigt sich jedoch: „Bühne“ und „Akteure“ sind eins und bedingen einander! Eine erstaunliche Feststellung über die Welt!
Offene Fragen
Wie ich oben dargelegt habe, scheint sich aus Sicht der Physik alles ganz gut zusammenzufügen, sodass man den Ursprung und die Entwicklung der unbelebten Welt beschreiben kann. Man kann einen solch einmaligen Vorgang wie die Entstehung des Universums aber nicht im Labor nachstellen, sondern nur die Signale (in Form von Strahlung) auswerten, die uns aus dem Weltraum erreichen. Aus diesen Informationen muss man dann das Szenario der Weltentstehung konstruieren. Somit gibt es keinen wirklichen Beweis für dieses Szenario.
Es gibt viel Unverstandenes in der Physik. Ein Beispiel ist die ominöse Dunkle Materie: Wenn man sich eine Galaxie19 wie die Milchstraße ansieht (im Fall der Milchstraße sind wir auf der Erde mittendrin, insofern haben wir keinen Blick von außen auf die Galaxie), so hat diese ein ausgeprägtes Zentrum, dem Spiralarme entspringen. Das ganze Gebilde ist riesengroß (die Milchstraße hat einen Durchmesser von 100 000 Lichtjahren), eher flach und rotiert um den Mittelpunkt. Bei diesen großen Entfernungen ist die Gravitation die einzige Kraft, die die Galaxie „zusammenhält“. Wenn man eine solche Struktur wie die Milchstraße durchrechnet, stellt man allerdings fest, dass diese gar nicht so aussehen dürfte, wie sie aussieht. Die Sterne, die sich außen in der rotierenden Galaxiescheibe befinden, müssten eigentlich viel langsamer um den Mittelpunkt der Galaxie rotieren, als es beobachtet wird. Man postuliert daher Dunkle Materie, die man so unmittelbar nicht beobachten kann. Diese soll dafür sorgen, dass die äußeren Sterne der Galaxie sich dennoch so bewegen, wie man es beobachtet. Dieser Effekt ist auch nicht klein, im Gegenteil: Die Dunkle Materie müsste fünfmal so häufig vorkommen wie die uns bekannte Materie. Damit sich Vorhersage und Beobachtung wieder decken, versucht man nun, zu berechnen, wie die Dunkle Materie innerhalb einer Galaxie verteilt sein muss. Aber ehrlich gesagt ist das ein recht unbefriedigender Vorgang. Man muss eine unbekannte Materie fordern und so räumlich im Universum „verteilen“, dass das Modell wieder stimmt. Elegant ist das jedenfalls nicht.
Ein anderes Beispiel ist die sogenannte Dunkle Energie. Wie bereits erwähnt, expandiert das Universum. Man sollte eigentlich erwarten, dass das Universum sich möglicherweise wieder zusammenziehen könnte, weil die Gravitationskraft kontrahierend wirkt. Zumindest sollte sich die Expansion tendenziell verlangsamen. Stattdessen hat man festgestellt, dass die Expansionsgeschwindigkeit sogar zunimmt. Was ist das für eine Kraft, die das Universum weiter aufbläht? Diese müsste ja der Schwerkraft entgegenwirken! Deshalb wird eine Dunkle Energie postuliert, die dafür sorgen soll, dass das Universum schneller expandiert. Diese Dunkle Energie soll nach aktuellen Berechnungen rund 70 Prozent der Energie im Universum ausmachen, hinzu kommen rund 25 Prozent Dunkle Materie, und nur 5 Prozent verbleiben für die uns bekannte Materie.20
Ein solcher Befund ist doch etwas ernüchternd. Ohne Zweifel: Die Physiker leisten hochqualifizierte Arbeit, und was man alles messen kann, ist enorm. Aber man muss sich eingestehen: Jede Messung, die etwas erklären soll, wirft auch wieder neue Fragen auf. Dies lehrt uns, bei aller Euphorie über den Fortschritt der Technik demütig zu bleiben, wenn daraus scheinbare Gewissheiten über die Welt abgeleitet werden. Es sind noch viele Fragen offen. Möglicherweise würden wir sehr überrascht sein, wenn wir jetzt durch eine Eingebung plötzlich die Antworten auf alle Fragen der Physik wüssten.
Fazit zu den Erkenntnissen der Physik
Die wesentlichen Erkenntnisse der Physik würde ich aufteilen in solche, die durch entsprechende Erkenntnisse verifiziert sind, und solche, die ich eher als „begründete Vermutung“ bezeichnen würde.
Weiter ist gut abgesichert, dass die Physik in der unbelebten Materie vier Kräfte identifizieren konnte, über die Teilchen in der physikalischen Welt miteinander wechselwirken. Die Kräfte unterscheiden sich in ihrer Reichweite oder auch darin, ob die Kräfte abschirmbar sind (elektrische Ladungen können sich z. B. ausgleichen und haben dann keine Wechselwirkung mehr, die Gravitation hingegen wirkt immer und kann nicht abgeschirmt werden). Die Teilchen agieren auf der „Bühne“ der Raumzeit, mit der sie aber auch selbst wechselwirken.
Eine sehr überraschende Erkenntnis der Physik ist, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass es überhaupt ein Universum gibt. In der Physik gibt es viele Naturkonstanten, deren jeweilige Größe nicht erklärt werden kann. Man hat festgestellt, dass diese Naturkonstanten exakt so sein müssen, wie sie sind, damit überhaupt ein Universum entstehen kann. Dies nennt man das Wunder der Feinabstimmung.
Zu den „gut begründeten Vermutungen“ würde ich den Befund zählen, dass das Universum einen Anfang hatte. Vor ca. 13,8 Milliarden Jahren gab es einen Beginn, ausgehend von einem „Punkt“. Erst ab diesem begann dann auch die Zeit zu laufen, das Universum dehnte sich aus und erzeugte massebehaftete Teilchen, aus denen dann im Laufe von Milliarden von Jahren Galaxien mit Sonnen und Planeten entstanden. Und auf einem dieser Planeten, der Erde, leben wir!
Apropos „leben“: Dazu kann die Physik keine Aussage treffen. Das ist die Aufgabe der Biologie. Damit beschäftigen wir uns im folgenden Kapitel.
Die Physik und das Leben – kurz und bündig
1
Die Ergebnisse der Physik legen nahe, dass das Universum vor ca. 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Es hat demnach einen Anfang.
2
Zeit, Raum, Energie und Masse bedingen einander. Entweder sind alle diese Größen da oder keine von diesen. Unser Universum entstand offenbar aus einem Zustand ohne Zeit, Raum, Energie und Masse. Die Zeit fing erst mit der Entstehung des Universums an zu laufen.
3
Wie das Universum entstand, ist nicht bekannt.
4
Es ist nicht selbstverständlich, dass das Universum überhaupt entstanden ist. Es gibt viele Naturkonstanten, die „kunstvoll“ so aufeinander abgestimmt sind, dass das Universum existieren kann. Das nennt man das Wunder der Feinabstimmung. Wären die Naturkonstanten nur ein wenig anders, wäre kein stabiles Universum entstanden.
5
Die Physik hat vier verschiedene Kräfte identifiziert, wozu auch Teilchen gehören sowie Austauschteilchen, die Kräfte „übertragen“. Mit diesen Kräften und dem zugehörigen „Teilchenzoo“ kann man die materielle Welt befriedigend beschreiben. Warum die Kräfte genau so beschaffen sind, wie sie sind, kann die Physik nicht erklären.
6
Es gibt in der Astrophysik aber noch viele unverstandene Phänomene. Deshalb werden eine Dunkle Energie und eine Dunkle Materie postuliert. Diese beiden hypothetischen Energieformen (Masse ist auch eine Energieform) sollen zusammen 95 Prozent der Energie des Universums ausmachen.
Was kann uns die Biologie über das Leben sagen?
Vom Wunder der Entstehung des Lebens bis zum Bewusstsein
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
(Psalm 139,14)
Was untersucht die Biologie?
Die Biologie ist die Lehre vom Leben. Sie beschäftigt sich also mit den Lebewesen. Diese wiederum zeichnet aus, dass sie einen Stoffwechsel haben, sich fortpflanzen und sterben. Gleichzeitig können sie sich aber auch neuen Bedingungen in gewissen Grenzen anpassen. Es ist somit klar, dass die Biologie einen völlig anderen Blick auf die Natur hat als die Physik. Dennoch übernimmt die Biologie aus der Physik, was dort über die wirksamen Kräfte in der Natur herausgefunden wurde. Es ist eine plausible, aber dennoch gewagte Annahme, dass die in der Physik identifizierten Kräfte auch Leben erklären können. Es könnte ja auch Kräfte geben, die nur bei lebenden Organismen auftreten bzw. diese überhaupt erst entstehen lassen. Aber solch eine Herangehensweise wäre schwierig. Deshalb versucht man, von den bekannten Kräften der Physik ausgehend auch das Leben zu beschreiben und zu erklären.
Laut der Physik gibt es vier Wechselwirkungen: Gravitation, elektromagnetische Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung und starke Wechselwirkung. Dabei ist die starke Wechselwirkung ursächlich dafür, dass es überhaupt Teilchen gibt. Die Gravitation sorgt dafür, dass es einen Planeten wie die Erde gibt. Die schwache Wechselwirkung ist für die Umwandlungen von Teilchen untereinander verantwortlich. Nach dem Ausschlussprinzip ist die einzige Kraft, die aus dieser Sicht21 für die Entstehung und Entwicklung von Leben infrage kommt, somit die elektromagnetische Wechselwirkung. Damit ist man im Bereich der Chemie, denn die Chemie beschäftigt sich damit, wie Teilchen oder Moleküle unter dem Einfluss ihrer elektrischen Ladung oder ihrer Ladungsverteilung reagieren. Wenn sich Moleküle bilden, dann geschieht das nur deshalb, weil es für die einzelnen Bestandteile des Moleküls energetisch sinnvoll ist, sich aneinander zu lagern. „Energetisch sinnvoll“ bedeutet, dass ein niedrigerer Energiezustand erreicht wird. Das ist ein ungerichteter Prozess, der von sich aus nichts „will“.
Man kann das mit einem Ball vergleichen, den man die Straße hinunterschubst. Auch der „sucht sich“ eine energetisch günstige Position, indem er so lange rollt, bis er eine Senke erreicht hat, von der aus seine Bewegungsenergie nicht mehr ausreicht, um diese wieder zu verlassen. Der Ball „will“ nichts, in diesem Sinne ist seine Bewegung „ungerichtet“, sie hat kein Ziel. Der Ball nimmt nur eine energetisch günstige Position im Gravitationsfeld ein. Ebenso nehmen die Moleküle in der Biochemie „ungerichtet“ energetisch günstige Positionen im elektromagnetischen Feld ein. Weil aber nur die elektromagnetische Wechselwirkung für die Bildung von Leben infrage kommt, müsste die Biochemie alle in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen erklären können.
Die materialistische Denkrichtung geht genau davon aus. Ihr zufolge beruhen alle Erscheinungen im Zusammenhang mit Leben letztendlich auf ungerichteten biochemischen Prozessen und sind somit auf einer molekularen Ebene zu erklären. Deshalb geht man bei der Suche nach einem Verständnis von Leben so vor, dass man sich die elementaren molekularen Prozesse in den kleinsten Einheiten des Lebens, den Zellen, ansieht. Dieses Vorgehen nennt man Reduktionismus: Man versucht, das „Große“ zu verstehen, indem man das „Kleine“ erforscht und beschreibt.
Weltweiter Vorreiter der materialistischen Denkrichtung ist Richard Dawkins (geb. 1941). Da er im populärwissenschaftlichen Bereich am meisten publiziert hat, werde ich mich im Rahmen dieses Buches häufiger mit ihm auseinandersetzen.
Wer ist Richard Dawkins? Dawkins ist ein britischer Zoologe und Evolutionsbiologe und der bekannteste Vertreter der Neuen Atheisten und der Brights-Bewegung22. Die nicht ganz unbescheidene Bezeichnung „Brights“ (deutsch: hell, klar, aufgeweckt) soll suggerieren, dass diese Bewegung ein besonders fortschrittliches Weltbild vertritt. So lehnen sie auf vehemente Weise jegliches Übernatürliche ab und vertreten das materialistische Weltbild, welches sie als umfassend und ausreichend zur Erklärung aller Phänomene unserer Welt ansehen. Dawkins ist sozusagen Vordenker für diese Weltsicht und deswegen auch häufig in den deutschen Medien präsent. Er hat zahlreiche Bücher zu diesem Thema geschrieben, u. a. „Das egoistische Gen“ (1976), „Der blinde Uhrmacher“ (1986), „Und es entsprang ein Fluß in Eden“ (1995), „Gipfel des Unwahrscheinlichen“ (1996), „Der Gotteswahn“ (2006) und „Die Schöpfungslüge“ (2009).23





























