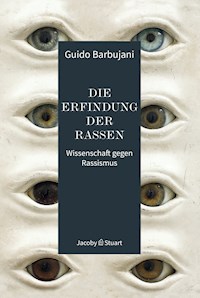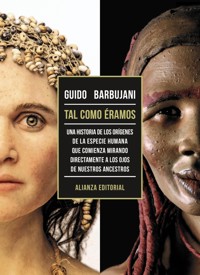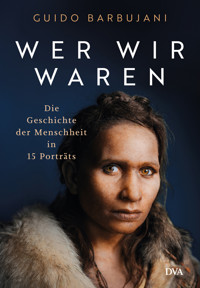
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Drei Millionen Jahre Evolution in 15 faszinierenden Gesichtern: Guido Barbujani erzählt anschaulich die Geschichte unserer Vorfahren und ihrer Lebensweisen
Über die evolutionäre Reise der Menschheit ist schon viel geschrieben worden. Der italienische Genetiker Guido Barbujani blickt so tief hinein in den Alltag unserer Vorfahren wie niemand zuvor. Anhand von fünfzehn lebensechten Rekonstruktionen von Steinzeitmenschen entführt er uns in die Welt von Homo erectus, der als Erster das Feuer zu beherrschen wusste. Wir tauchen ein in das Leben der kleinen Hominiden der Insel Flores in Indonesien, die später als »Hobbits« bezeichnet wurden, begleiten einen Neandertaler bei der Großwildjagd und staunen über die einzigartige und vielfältige Ausrüstung, die sich in Ötzis Gürteltasche fand. Auf der Grundlage von fossilen Funden, jahrtausendealten Gebrauchsgegenständen und Genomanalysen gewährt Barbujani vollkommen neue Einblicke in die Lebensweisen dieser frühen Menschen und führt uns zugleich vor Augen, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. In geschenkfähiger Ausstattung mit 15 Farbabbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Über die evolutionäre Reise der Menschheit ist schon viel geschrieben worden. Der italienische Genetiker Guido Barbujani blickt so tief hinein in den Alltag unserer Vorfahren wie niemand zuvor. Anhand von fünfzehn lebensechten Rekonstruktionen von Steinzeitmenschen entführt er uns in die Welt von Homo erectus, der als Erster das Feuer zu beherrschen wusste. Wir tauchen ein in das Leben der kleinen Hominiden der Insel Flores in Indonesien, die später als »Hobbits« bezeichnet wurden, begleiten einen Neandertaler bei der Großwildjagd und staunen über die einzigartige und vielfältige Ausrüstung, die sich in Ötzis Gürteltasche fand. Auf der Grundlage von fossilen Funden, jahrtausendealten Gebrauchsgegenständen und Genomanalysen gewährt Barbujani vollkommen neue Einblicke in die Lebensweisen dieser frühen Menschen und führt uns zugleich vor Augen, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind.
Zum Autor:
Guido Barbujani, geboren 1955, ist ein renommierter italienischer Populationsgenetiker, Evolutionsbiologe und Autor. Er hat für die State University of New York sowie die Universitäten von Padua und Bologna gearbeitet und lehrt seit 1996 an der Universität von Ferrara. Auf Deutsch erschien von ihm bislang Die Erfindung der Rassen. Wissenschaft gegen Rassismus (2021).
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
GUIDO BARBUJANI
WER WIR WAREN
Die Geschichte der Menschheit in 15 Porträts
Aus dem Italienischen von Enrico Heinemann
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Come eravamo. Storie della grande storia dell’uomo bei Guis. Laterza & Figli, Bari/Rom.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Gius. Laterza & Figli, All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Carola Köhler
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildung: Julien Faure / Homo Sapiens sculpture by Élisabeth Daynès
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30886-5V001
www.dva.de
Für Luca Bazooka
… weil ich wie er war, so wie ich meine Mutter war und mein Vater und mein Großvater Paco und meine Urgroßmutter Carolina, in gleicher Weise, wie ich alle die Vorfahren war, die in meiner Gegenwart zusammenfließen, wie eine Menge oder eine unzählige Legion aus Verstorbenen oder ein Wald aus Gespenstern, wie alle in mein Geschlecht einmündenden Geschlechter, die aus den unergründlichen Tiefen unseres Unwissens über die Vergangenheit heraufsteigen.
Javier Cercas, El monarca de las sombras (Der Monarch der Schatten)
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Anrufung und Einleitung
1. Auf zwei Beinen: Australopithecus afarensis
Lucy lvor 3,3 Millionen Jahren
2. Mit zwei Händen: Homo ergaster
Turkana Boy lvor 1,6 Millionen Jahren
3. Oben im Kaukasus: Homo georgicus
Dmanisi 2 lvor 1,8 Millionen Jahren
4. Unten in Asien, das Feuer: Homo erectus
Trinil lvor 500 000 Jahren
5. Genealogischer Dschungel: Homo heidelbergensis
Steinheim lvor 350 000 Jahren
6. Ein uriger Typ: Homo neanderthalensis
Feldhofer 1 lvor 40 000 Jahren
7. Der Mensch in den Tropfsteinen: Homo neanderthalensis
Altamura lvor 150 000 Jahren
8. Die Großmutter aller Großmütter: Homo sapiens
Mitochondriale Eva lvor 200 000 Jahren
9. Mischlinge: Homo sapiens
Oase 2 lvor 37 000 Jahren
10. Klitzeklein: Homo floresiensis
Flo lvor 60 000 Jahren
11. Kunst und Weisheitszähne: Homo sapiens
Abri von Cap Blanc lvor 15 000 Jahren
12. Amerika: Homo sapiens
Luzia lvor 11 500 Jahren
13. Europäer mit dunkler Haut: Homo sapiens
Cheddar Man lvor 10 000 Jahren
14. Brot, Wein, Milch: Homo sapiens
Ötzi lvor 5200 Jahren
15. Beschreiben, klassifizieren, verstehen: Homo sapiens
Charles Darwin lvor 200 Jahren
Abgesang
Dank
Kleines Glossar
Weiterführende Literatur
Bildnachweis
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Drei Jahre sind vergangen, seitdem dieses Buch in Italien erschienen ist, und knapp vier, seitdem es geschrieben wurde: an sich ein kurzer Zeitraum, und zwar ein äußerst kurzer, wenn man ihn mit dem Alter der Fossilien aus den hier erzählten Geschichten vergleicht, von denen manche einige Millionen Jahre alt sind. Und doch hat sich in dieser wenigen Zeit in der wissenschaftlichen Forschung viel getan, sodass schon jetzt Korrekturen anstehen und einige Details berichtigt werden müssen. Der großflächige Einsatz von Techniken zur Erforschung alter DNA stellt einen großen Schritt nach vorn dar. Weil sich heute aus fossilen Überresten relativ einfach genetische Informationen gewinnen lassen, können wir uns von der Vergangenheit unserer Spezies eine immer genauere Vorstellung machen. Alte DNA hat ans Licht gebracht, dass die Menschheit tiefgreifende genetische Veränderungen durchlaufen und Migrationsbewegungen hinter sich gebracht hat, die die archäologischen Daten und die Ergebnisse von Untersuchungen moderner DNA nur in groben Zügen erahnen ließen.
Die Vermutung, dass sich die europäischen Bevölkerungen keineswegs geradlinig, sondern durch einen vielfältigen Austausch und über große Wanderungen entwickelt haben, gab es schon lange, aber heute haben wir dafür die Beweise. Auf Sardinien und im heutigen Dänemark, auf der italienischen Halbinsel wie auf den Britischen Inseln sehen wir einen genetischen Bruch zwischen den mesolithischen und den neolithischen Bevölkerungen, zwischen den Jägern und Sammlern auf der einen und den Viehzüchtern und Ackerbauern auf der anderen Seite: Letztere stammen nicht oder höchstens in geringem Umfang von den Erstgenannten ab. Auf die klassische Frage, woher unsere Vorfahren kamen, können wir endlich einige gute Antworten geben: im Allgemeinen von zahlreichen unterschiedlichen Orten. Aber während unsere Ahnen von vor 100 000 Jahren in Afrika zu finden sind, hielten sich die von vor 10 000 Jahren – vor allem die der Südeuropäer und bis zu einem gewissen Maß auch die aller anderen – überwiegend in Anatolien auf.
Doch damit nicht genug: Heute können wir das physische Erscheinungsbild unserer prähistorischen Blutsverwandten mit einer Genauigkeit rekonstruieren, die vor zehn Jahren noch undenkbar war. Weder die Frau von Cap Blanc noch Ötzi – die Gletschermumie vom Similaun –, zwei Protagonisten dieses Buchs, sahen genau so aus, wie wir sie uns bis vor Kurzem vorstellten. In Europa tauchten helle Hauttypen erst in neuerer Zeit und nicht schon vor Hunderttausenden von Jahren auf – mit Einwanderern aus Anatolien, die von dort eine innovative Kultur, die landwirtschaftliche Erzeugung von Nahrungsmitteln, mitbrachten. Bis ihre Migrationswelle Skandinavien und die Iberische Halbinsel erreichte, vergingen Jahrtausende, und bis dahin hatten viele Europäer immer noch eine dunkle, manche eine sehr dunkle Haut. Diese Erkenntnis zu unserer Vergangenheit zwingt uns zu einem neuen Nachdenken über uns selbst und wirft die Frage auf, wie begründet bestimmte Überzeugungen sind.
Nicht von ungefähr bekam 2022 der Forscher Svante Pääbo, einer der meistangeführten Namen in diesem Buch, verdient den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zuerkannt. Diese Auszeichnung honoriert nicht nur Pääbos entscheidenden Beitrag zur Erforschung der menschlichen Evolution, sondern sie ist auch die Anerkennung dessen, dass seine Ergebnisse von viel weiter reichender Bedeutung sind: Sie stellt klar, dass die Erforschung der Vergangenheit unserer Spezies nicht nur höchst interessante historische Fragen beantwortet, sondern auch konkret in der medizinischen Praxis hilft: Um zu verstehen, wie unser Organismus funktioniert, müssen wir nachvollziehen, wie wir uns zu denen entwickelt haben, die wir sind. Am Schluss dieses Buchs hatte ich darauf hingewiesen, dass die Rekonstruktion der Geschichte unserer Spezies dabei hilft, Menschenleben zu retten. Die Jury des Nobelpreiskomitees mit ihrer weitaus gewichtigeren Autorität hat dies bestätigt und dabei hervorgehoben, dass die Erforschung der Unterschiede zwischen uns Sapiens und unseren ausgestorbenen Verwandten die einzige Möglichkeit ist, um nachzuvollziehen, warum wir uns zu einer so einzigartigen Spezies im Tierreich entwickelt haben.
Aber die Forschung bleibt nicht stehen, und ich wette, dass es in zwei, in vier und wieder in zehn Jahren notwendig sein wird, diesem Buch weitere neue Erkenntnisse hinzuzufügen, wenn wir mit der Entwicklung Schritt halten wollen. Das ist das Schöne an dieser Arbeit: Sie ist nie zu Ende. Ich möchte hier allerdings auch einige Worte zur Kehrseite der Medaille sagen. Wenn man die Schlagzeilen in den Zeitungen verfolgt, gewinnt man fast den Eindruck, dass ungefähr jeden Monat eine neue Entdeckung alles, was wir bisher zu wissen glaubten, infrage stellt und uns zwingt, unser Wissensgebäude von Grund auf neu zu errichten. Und dies könnte den Verdacht wecken, dass die Erforschung der menschlichen Evolution auf einem schwankenden Boden steht, auf dem sich das, was heute noch gilt, vielleicht schon morgen als falsch oder bedeutungslos herausstellt. Doch dieses Misstrauen ist unbegründet. Wir lassen uns manchmal dazu verleiten, weil in der Wissenschaftswelt neue Player Einzug gehalten haben: die Pressestellen der wissenschaftlichen Einrichtungen. Da Forschung Geld kostet, müssen alle diese Institute ständig neue Finanzierungen auftreiben. Und genauso haben sich alle rasch darauf geeinigt, dass Artikel in auflagenstarken Zeitungen und auf häufig besuchten Websites ihren Ruf verbessern. So hat sich der Stil, in dem Wissenschaft kommuniziert wird, in kurzer Zeit verändert: Wurden bis vor wenigen Jahren aus Vorsicht noch eher die Grenzen unserer Methoden und Ergebnisse hervorgehoben, geht es heute vor allem um Marketing, dem sich darauf spezialisierte Fachleute mit viel Einsatz widmen. Und so triumphieren am Ende insbesondere in der allgemeinen Presse, aber nicht nur dort, Übertreibungen und Schlagzeilen, als ob schon jede Entdeckung den Keim einer wissenschaftlichen Revolution in sich trüge.
Dem ist nicht so, zumindest nicht auf dem Gebiet, mit dem ich mich befasse. Die Evolutionslehre steht auf einer soliden Basis, und diese zu revolutionieren, wird schwierig, sogar sehr schwierig. Ihr Fundament bildet Charles Darwins Theorie, der wir seit eineinhalb Jahrhunderten Stück um Stück hinzufügen, was wir an Neuem entdecken. Im Vergleich zu uns verfügte Darwin über so gut wie keine Daten: Er hatte keine Ahnung, dass es die DNA oder Gene gibt, und er kannte nur ein einziges menschliches Fossil, und das auch nur von Zeichnungen. Dennoch gelang es ihm mit beneidenswerter Intelligenz, die Grundregeln festzulegen, nach denen wir immer noch die Millionen neuer Daten interpretieren, die uns die paläontologische und die genetische Forschung liefern: dass der Ausgangspunkt biologische veränderliche Organismen sind, dass sie unterschiedliche Merkmale haben, die an die Umwelt mehr oder weniger gut angepasst sind und diese mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit weitervererben, sodass sich am Ende die günstigen ausbreiten. Auch wenn die heutige Evolutionsbiologie deutlich mehr als Darwins Lehre umfasst, entwickelt sie sich auf dem Fundament weiter, das ihr Begründer weitblickend angelegt hat. Jede neue Entdeckung fügt ein weiteres Steinchen hinzu und beseitigt einige Irrtümer, aber die grundlegenden Mechanismen sind gut verstanden, und sie ändern sich nicht einfach nur dadurch, dass ein etwas anders gestaltetes Fossil oder ein leicht abweichendes Genom auftaucht. Allen, die dieses Buch zur Hand nehmen, also viel Spaß beim Lesen – mit der Bitte um etwas Nachsicht für seine Unzulänglichkeiten: Wenn die Forschung weiter so voranschreitet, wie wir alle hoffen, werden es Jahr für Jahr mehr werden.
Guido Barbujani
Anrufung und Einleitung
Singe, oh Göttin, von Barbuglio. Barbuglio ist ein Ortsteil der Gemeinde Lendinara in der venetischen Provinz Rovigo in Norditalien. Wer ein wenig mit den Dialekten Venetiens vertraut ist, ahnt sofort, dass dieses gl im Ortsnamen nicht wie im Hochitalienischen ausgesprochen wird – also nicht wie ein »lj«, bei dem der Zungenrücken an den weichen Gaumen gedrückt wird. Ich glaube, »Barbuglio« wurde von seinen Einwohnern noch nie »Barbuljio« ausgesprochen, sondern immer »Barbujo«. Und barbujo bezeichnet im Dialekt der dortigen Gegend, die Polesine genannt wird, die Rispe an der Sprossspitze der Maispflanze (die sogenannte Fahne). Aber hier beginnen die Verwicklungen. Mein 1986 verstorbener Onkel Renzo hat in Kirchenbüchern nachgeforscht: Geburten, Taufen, Hochzeiten und Todesfälle. Wie er entdeckte, war im 16. Jahrhundert einer unserer Vorfahren von Barbuglio in die nahe gelegene Kleinstadt Adria übergesiedelt und erhielt dort den Familiennamen Barbujani. Dieser erste Barbujani, den er aufgespürt hat, war meiner Erinnerung nach Glöckner – in krassem Gegensatz zu seinen heutigen Nachfahren, die mit Sakristeien wenig am Hut haben. Dieses j im Nachnamen ist heute ein Archaismus. Je mehr Barbujani in andere Städte (nach Monza, Rom, Biella, Zürich …) zogen, desto häufiger meinten bebrillte Beamte in Meldeämtern, es korrigieren zu müssen. Deswegen gibt es in der Familie manche, vornehmlich in Adria und Umgebung wohnhafte, die sich mit j, und andere, vornehmlich abgewanderte Verwandte, die sich mit i schreiben. Aber es gibt noch eine weitere Version zu den Fakten, die die Nachforschungen meines Onkels Renzo zutage gefördert haben. Enzo und Giorgio Barbujani haben mir einen Druck unseres Familienstammbaums geschenkt, aus dem hervorgeht, dass wir einen gemeinsamen Urgroßvater, Antonio, aber keine gemeinsame Urgroßmutter haben. Gerüchten, allerdings unbestätigten, zufolge soll Renzo am Ende zu dem Schluss gelangt sein, dass die Ortschaft Barbuglio ihren Namen durch uns, die barbuti (die »Bärtigen«), erhalten habe: Als eine Familie geschickter Baumeister seien diese in die Polesine aus der Lombardei zugewandert, in die sie in noch früherer Zeit aus Südfrankreich gekommen seien. Mein Vater war tatsächlich Ingenieur, aber von dieser Theorie hatte ich noch nie gehört, und falls mein Onkel Renzo wirklich etwas Schriftliches zu ihr hinterlassen hat, so wissen weder Enzo noch Giorgio oder ich, wo wir danach suchen sollten.
Die Umkehr von Ursache und Wirkung – der Ortsname leitet sich vom Familiennamen her und nicht umgekehrt – beinhaltet interessante Aspekte, aber die sind schwer nachprüfbar und noch schwieriger gründlich zu erforschen. Halten wir uns an die Fakten: In Barbuglio sind unsere Vorfahren jedenfalls durchgekommen. Als ich fünf Jahre alt war, zogen wir von Adria nach Ferrara um, also auf die andere Seite des Po, aber immer noch in die nähere Umgebung. Es hat also vier Jahrhunderte gedauert, bis sich einige Barbujani von ihrem angestammten Siedlungsort um 46 Kilometer weiterbewegten, durchschnittlich gerade einmal gut 100 Meter pro Jahr. Wenn man sich ausrechnet, dass seit Mitte des 16. Jahrhunderts rund zwanzig Generationen aufeinanderfolgten, wären das für jede von ihnen 2300 Meter. Ich würde mich leidenschaftlich gern auf den Weg machen, um mit ihnen ein Schwätzchen zu halten: mit meinem Vater Fernando (am Ende der Stadt, bei den Tankstellen) oder mit meinem Großvater Gino (in der Ortschaft Barco). Was aber hätten ich und mein Urururgroßvater Matteo (ein kurzes Stück hinter der Pobrücke) uns noch zu sagen? In Adelsfamilien ist es einfacher: Von ihrem Vorfahren gibt es vielleicht ein gemaltes Porträt, oder man weiß, dass er Marchese war und auf einem Schlachtfeld umgekommen ist. Der Name lädt sich mit Bedeutung auf, und irgendwie wird eine familiäre Zusammengehörigkeit spürbar. Aber für die anderen, tatsächlich für fast alle, endet die – nachvollziehbare – Vergangenheit mit der Generation der Großeltern: Wie viele erinnere ich mich nicht daran, dass irgendeiner meiner Urgroßväter jemals namentlich erwähnt worden wäre. Und dabei verdanke ich es doch ihnen, dass ich auf der Welt bin. Die Farbe meiner Augen, die Form meiner Nase oder die Art, wie ich mir in die Nase kneife, wenn ich nach einem Wort suche, habe ich von einem von ihnen. Wenn ich einem von ihnen begegnen würde, verstünden wir uns? Wie weit könnte ich in die Vergangenheit zurückgehen, bis ich das Gefühl bekäme, dass es keinen Unterschied mehr machte, wenn der Betreffende nicht zu meinen Vorfahren gehören würde?
In Wahrheit mache ich es mir jedoch allzu einfach. Beeinflusst von den Adelsgenealogien stellen wir uns Abstammungslinien als Geraden vor, die von der Gegenwart aus, streng von den Söhnen zu den Vätern, in die Vergangenheit zurückführen. Wenige Zeilen weiter oben habe auch ich eine solche Linie gezogen. Aber so funktioniert es nicht – Stammbäume verzweigen und vervielfältigen sich: zwei Elternteile, vier Großeltern und acht Urgroßeltern, von denen alle jeweils acht Urgroßeltern hatten … Wenn wir zwanzig Generationen zurückverfolgen, landen wir in einer Vergangenheit, in der wir 220 Vorfahren hatten (oder ein paar weniger), das sind also (glauben Sie mir) eine Million: die ungefähre Einwohnerzahl von Turin. Folglich ist der erwähnte Glöckner, der von Barbuglio nach Adria übergesiedelt ist, einer von vielen, ja einer aus einer gewaltigen Masse an Vorfahren. Wahrscheinlich hat er eine Ortsansässige in Adria geheiratet, und wenn nicht er, dann haben sein Sohn und dessen Kinder in Adria eingeheiratet. Mit jedem Mal wurde sein Erbgut in meinem Blut (wie man es früher ausdrückte) oder in meiner DNA (wie man heute sagt) etwas mehr verwässert, sodass es in meinem jetzt nur noch ein Millionstel vom Ganzen ausmacht. Was bleibt uns an Gemeinsamkeiten außer dem Familiennamen?
Streng genetisch betrachtet, haben wir sehr wenig gemein. Aber in anderer Hinsicht sehr viel: Immerhin heißen wir beide Barbujani, stammen aus Barbuglio, sind Polesaner, Veneter, italienischsprachig, Italiener, Europäer und Menschen. Wir sprechen also die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Sprache, mit der wir kommunizieren könnten. Und wir kennen beide eine Landschaft aus Ebenen, Gewässern und Kanälen und fühlen uns größeren Gemeinschaften zugehörig. Wer weiß, ob sich dieser Ahn irgendwie für seine fernen Vorfahren interessiert hat. Aber würde es bei genauerem Nachdenken eigentlich etwas ändern, wenn ich anstelle mit diesem ersten historisch belegten Barbujani mit jemand anderem plaudern würde, mit dem ich mich verständigen könnte und bei dem ein wechselseitiges Interesse aneinander bestünde? Wie wichtig ist überhaupt dieses Viel oder Wenig an DNA, das ich von diesem Vorfahren geerbt habe? Während mich noch solche Gedanken beschäftigten, stieß ich in der Zeitung auf eine computergenerierte Rekonstruktion des Gesichts von Kaiser Nero. Er wirkte sympathisch mit seinem angedeuteten Lächeln. Anstatt als verschlagenes konnte man es auch einfach als das eines Mannes sehen, der sagt: Schaut her, ich bin nicht so übel, wie mich manche hinstellen. Sich ins Gesicht zu sehen, ist doch sehr wichtig, oder?
Dieses Buch handelt in gewissem Sinn von der Bedeutung, einander ins Gesicht zu blicken. Buchstäblich: Unser Familienalbum, das Festgehaltene und die Gesichter derer, die vor uns auf dem Planeten lebten, bergen eine Botschaft, die über die Generationen hinweg bis zu uns gelangt ist und davon erzählt, wer wir waren. Dank unserer heutigen Fähigkeiten, massenhaft die DNA längst Verstorbener oder noch Lebender gründlich zu lesen und die Unterschiede zwischen ihnen zu deuten, geben uns diese Relikte eine Vorstellung davon, welche Wanderungen, welche Arten von Austausch und welche Anpassungen an die Umwelt uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind.
Aber sich ins Gesicht zu blicken, heißt noch mehr, wie ich meine. Der Plan zu diesem Buch entstand Ende 2020 in der finstersten Zeit der Covid-19-Pandemie. Nach einem Sommer des prekären Optimismus, in dem viele meinten, das Schlimmste sei überstanden, stiegen die Ansteckungsraten erneut: die sogenannte zweite Welle. Ab dem 8. Oktober 2020 galt in Italien Maskenpflicht, ab dem 13. Oktober mussten Restaurants, Kinos und Theater ihren Betrieb einschränken und am Ende des Monats dann ganz schließen. Reisen ohne triftigen Grund waren nicht mehr möglich. Zu den Belastungen, die sich schon während der ersten Welle aufgetürmt hatten und die noch nicht bewältigt waren, kam jetzt die Aussicht auf eine extrem schwierige Zeit hinzu. In jenen Tagen rief mich Raffaele Ghirardi an, ein enger Freund, der in einem Krankenhaus in der Provinz Mantua die Covid-19-Abteilung leitete. Er musste mit jemandem reden, und ich hörte zu. Am Ende sagte er mir schlicht, er schaffe es nicht mehr.
Schließlich hat Raffaele, wie viele von uns, es doch geschafft: gerade so, indem wir uns mit letzter Kraft in die Arbeit stürzten und uns über Wasser zu halten versuchten. Aber manche schafften es nicht. Am 15. Juni 2020 starb Giulio Giorello an Covid-19, jemand, der mir sehr wichtig war. Freunde waren wir eigentlichen nicht. Ich würde sagen, dass unser Verhältnis eher auf einem gegenseitigen Vertrauen als auf dem beruhte, was wir voneinander wussten. Aber wir hatten viele gemeinsame Interessen und unterhielten uns gern miteinander über Wissenschaft. In den Wochen, in denen wir regelmäßig auf die 17-Uhr-Meldungen der Ansteckungsraten und Todeszahlen warteten – immer mit einer Schlussbilanz wie bei einem Flugzeugabsturz –, erschienen die Opfer der Pandemie nicht wie Personen, nicht wie ein Giulio Giorello oder die vielen anderen: Sie waren zu einer abstrakten Nummer geworden. Ich glaube, allen ging es so. Die Verstorbenen verwandelten sich augenblicklich in Geschöpfe der Vergangenheit, die zählbar waren, aber niemals nahe kamen. Dann veröffentlichte eine Zeitung einzelne Fotos mit Geschichten: Jetzt gelang es mir eine Zeitlang, die erschreckende Tragweite der Ereignisse zu erfassen. Giulio Giorello, Lidia Menapace, der Filmregisseur Kim Ki-Duk, meine Kollegen, die Genetiker Luciano Terrenato und Michele Stanca. Einer der Ersten, den es traf, war der Friseur an der Ecke, dann folgte seine Frau. Wir hatten uns nie gegrüßt, obwohl wir uns täglich begegnet waren: Sie alle sind, waren vertraute Figuren, jetzt aufgelöst in den Statistiken, die die Ausmaße des Ereignisses festhielten. An sie zu denken, sie sich in Erinnerung zu rufen, ihnen gedanklich ins Gesicht zu blicken, das kostete Mühe. Aber wenn wir unseren Vorfahren irgendwie ins Gesicht blicken könnten, dachte ich mir, würden wir uns dabei auch selbst ins Gesicht sehen und uns in dem spiegeln, was wir waren und sind: Glieder einer genealogischen Kette, die aus den Tiefen der Vergangenheit bis zu uns in die Gegenwart reicht und weiter in die Zukunft führt, sollten wir nicht so dumm sein, unseren Planeten unbewohnbar zu machen.
Einverstanden, die Idee ist verrückt, aber so verrückt nun auch wieder nicht. Obwohl ihre Namen im Lauf der Jahrhunderte untergingen, ist uns von unseren Vorfahren doch etwas geblieben: Ihre fossilen Knochen und die DNA, die sich aus diesen oftmals noch extrahieren lässt, können uns viele Geschichten erzählen. Und es gibt Künstler, die mit Methoden der wissenschaftlichen Forensik und der notwendigen Fantasie, wenn Erkenntnisse fehlen, von diesen Ahnen wunderbare dreidimensionale Rekonstruktionen erschaffen: die Zwillingsbrüder Adrie und Alfons Kennis sowie Élisabeth Daynès. Wenn man ihren Plastiken ins Gesicht blickt, überschreitet man eine Brücke und tritt in einen fragilen, aber wertvollen Kontakt zu unserem Stammbaum, zu dem, was wir als Menschheit vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen waren. Dank der Bravour dieser Künstler trifft unsere Neugier auf ein Objekt, und dank der Paläontologen, die uralte Skelette ausgruben und liebevoll wieder zusammensetzten, sowie der Genetiker, die deren DNA auslasen, nimmt dieses Objekt in unseren Augen menschliche Züge an: Es ist konkreter und schafft es, noch mehr Wissbegier hervorzurufen und sogar ein paar Gefühle zu wecken. Vielleicht stellt man sich sogar ihre Stimmen vor: Als könnten sie sich nach so langer Zeit wieder Gehör verschaffen und etwas von ihrem ungewöhnlichen Schicksal erzählen …
1.Auf zwei Beinen:Australopithecus afarensis
Lucylvor 3,3 Millionen Jahren
Lucy ist eine Berühmtheit. Von allen Vertretern von Australopithecus ist einzig von ihr heute noch die Rede, und das will einiges heißen. Doch zu Lebzeiten war sie nur eine von vielen. Dass ihr Schicksal, wie übrigens auch das der anderen Protagonisten in diesem Buch – außer dem Darwins –, in den Medien Furore machte, hat mit ihrem Tod zu tun, also damit, wie und wo sie gestorben ist. In Lucys Fall erscheinen die Umstände, unter denen sie ums Leben kam und durch die sie zu postumem Ruhm gelangte, besonders unglückselig. Versetzen wir uns in ihre Haut: Ein mühseliger Tag geht zu Ende, aber du fühlst dich wohl. Du hast einen vollen Magen, was nicht an jedem Abend vorkommt. Du gähnst. Mit halb geöffneten Augen überprüfst du ein letztes Mal die Lage in der Umgebung, denn man weiß ja nie. Die anderen sind friedlich und machen es sich zum Schlafen bequem. Jemand schnarcht bereits, während die letzten Sonnenstrahlen die Akazienstämme in ein rötliches Licht tauchen. Alles gut, aber unter deinem Rücken drückt etwas. Du drehst dich um, um dir Erleichterung zu verschaffen. Dein Fuß gleitet vom Ast ab, und plötzlich steht deine Welt kopf, während dein Arm noch einen Viertelkreis beschreibt, deine Hand aber ins Leere greift. Du hörst einen Schrei, wohl deinen eigenen, und schon saust du in einem »tollen Fluge«, wie es bei Dante so schön heißt, deinem letzten, in die Tiefe.
Du verschwendest keinen Gedanken an die Nachwelt, als du am Boden zerschmetterst, aber die Nachwelt wird sich für dich interessieren. Lucy ist ein Star, weil ihre Spezies, Australopithecus afarensis, die Erste ist, von der wir mit Sicherheit sagen können, dass sie wie wir auf zwei Beinen ging. Ob sie wirklich die einzige war, ist keineswegs ausgemacht. Wir wissen es nicht. Und es ist auch nicht gesagt, dass sich ihre Vertreter darin als besonders geschickt erwiesen, trotz Millionen von Jahren, in denen sie sich daran versuchten. Offenbar zogen sie sich in ihrer Unbedarftheit des Nachts wieder auf die Bäume zurück, weil sie sich oben sicherer fühlten. Und so starb Lucy, einer glaubwürdigen Rekonstruktion des Hergangs zufolge, eben durch einen Sturz von einem Baum. Sie blieb auf dem Boden liegen, weil in jener Zeit an eine Bestattung noch längst nicht zu denken war. Über ihr lagerte sich eine geologische Schicht nach der anderen ab, sackte manchmal ab und wurde unter weiteren begraben. Und eines Tages kamen zwei Paläontologen vorbei, von denen sie einer entdeckte. Nach Millionen Jahren ertönte ein zweiter Schrei, aber diesmal keiner aus Todesangst, sondern einer des Triumphs. Und bald wurde Lucy weltberühmt.
Wenn man sie so sieht, scheint Lucy zu lächeln. Sie schmunzelt. Der Anflug von Sympathie, den ihr verschmitzter Gesichtsausdruck auslöst, wird allerdings durch ihre mächtigen, borstigen, nach vorn zulaufenden Koteletten gedämpft. Diese Favoris erinnern an die Mode des späten 19. Jahrhunderts, im Gegensatz zu ihrer stark abgeflachten Nase und ihrer Hautfarbe, die nur um die Lippen herum (auf denen Lucy nachdenklich herumzukauen scheint) etwas heller ist. Und erst die Stirn. Die Rekonstruktion zeigt Lucy kokett: Sie legt den Kopf zurück, wie um zu verbergen, dass diese Stirn zurückweicht und zur Gesichtsebene einen markanten Winkel bildet … Nichts zu machen: Wenn wir Lucy so sehen, erscheint sie uns nahe und fern zugleich. Wie könnte es anders sein? Gut drei Millionen Jahre zeitlicher Abstand sind keine Kleinigkeit. Aber blenden wir ein Stück zurück.
Dass wir über das Äußere und die Lebensweise unserer fernen Vorfahren etwas sagen können, verdanken wir drei Informationsquellen: fossilen Überresten, die aus einem Zeitraum von mehreren Millionen Jahren stammen, archäologischen Artefakten, die bis zu zwei Millionen Jahre alt sind und damit aus einem Zeitraum seit Beginn des Paläolithikums stammen, sowie DNA, die höchstens ungefähr 100 000 Jahre alt ist, weil noch älteres Erbmaterial in zu schlechtem Zustand ist, um es für die Forschung zu verwerten. Aber die herausragende Bedeutung des Australopithecus afarensis für unsere Geschichte beruht auf einem Fund, der in keine dieser Kategorien fällt: auf einer Reihe von Spuren, die über drei Millionen Jahre alt sind.
Entdeckt wurden diese von einer von Mary Leakey geführten Gruppe von Paläontologen im tansanischen Laetoli nahe dem heute erloschenen Vulkan Sadiman. Für lange Zeit war dieser jedoch aktiv gewesen und hatte getan, was feuerspeiende Berge tun: Er stieß immer wieder Lava und Asche aus, die die gesamte umliegende Gegend unter sich begruben. Laut einer Geschichte, die wie erfunden wirkt, aber von verschiedenen Quellen bestätigt wird, wurde Andrew Hill, ein Mitglied von Mary Leakeys Team, von seinen Gefährten mit Elefantendung beworfen. Ablenkungen gab es dort offenbar kaum, sodass nach allem gegriffen wurde, was sich anbot. Tatsache ist, dass sich Hill, um einem Treffer zu entgehen, zu Boden warf, wodurch er die Asche der sogenannten Fundstelle G von Laetoli direkt vor der Nase hatte. Ihm fiel auf, dass die sich darin abzeichnenden Spuren – anders als gedacht – nicht nur von Antilopen und Gazellen stammten: Eine rührte offenbar von einem menschlichen Fuß her. 1978, nach vier Jahren Arbeit, wurde ein 27 Meter langer Brocken aus ausgehärteter Vulkanasche freigelegt, mit 88 erhaltenen Fußspuren von Geschöpfen, die zweifelsfrei auf zwei Beinen gegangen waren. Ihre einstigen Besitzer hatten große Zehen, die nicht wie bei den Schimpansen abgespreizt waren, sondern parallel zu den anderen verliefen. Um das Alter dieser Abdrücke zu bestimmen, standen präzise Methoden zur Verfügung, mit denen sich der Tuff datieren ließ: Sie waren vor 3,6 Millionen Jahren entstanden. Die einzige Kreatur, die zur damaligen Zeit an diesem Ort über diese Asche gegangen sein konnte, war eben der Australopithecus afarensis.
Auch wenn uns Menschen die sogenannte Bipedie – also die Fähigkeit, aufrecht zu stehen und zu gehen – aus Gewohnheit ganz selbstverständlich erscheint, ist sie unter Wirbeltieren wenig verbreitet. Zu den Beispielen außerhalb unseres Stammbaums und ohne die Vögel, die eine andere Entwicklungsgeschichte haben, zählen Kängurus und bestimmte Dinosaurier, aber sie bewegen beziehungsweise bewegten sich zweibeinig anders als wir fort. Sie haben einen massigen Schwanz, der als Gegengewicht dient, wenn sie beim Gehen oder Laufen den Rumpf nach vorn beugen. Ohne Schwanz aufrecht zu gehen, ist eine Besonderheit des Menschen, die enorme Konsequenzen hatte. Dazu brauchte es im Skelett und in der Muskulatur tiefgreifende Veränderungen, die nicht nur von Vorteil waren, wie wir noch sehen werden. Zwar stimmt es, dass auch Schimpansen, Gorillas und Bären einige Schritte auf zwei Beinen gehen können, aber dies ist nicht ihre übliche Art der Fortbewegung. Das Gehen bedeutet einen ständigen Balanceakt, dessen Beherrschung zwangsläufig starke Gesäßmuskeln (die Schimpansen nicht haben), eine andere Ausrichtung des Beckens und vor allem eine veränderte Struktur der Wirbelsäule erfordert. Bei Vierbeinern bildet diese einen horizontal verlaufenden Bogen, unter dem der Brustkorb und die inneren Organe liegen: Das funktioniert gut. Aber mit dem Erwerb des aufrechten Gangs hängt der Brustkorb mit seinem Gewicht nun vorn am Körper, wo es ein einigermaßen gewiefter Konstrukteur niemals platziert hätte. Die Evolution verfährt mit Vorhandenem bekanntlich nach ihren Möglichkeiten: Im Lauf der Zeit krümmte sich die Wirbelsäule im Lendenbereich, um die Lasten klüger zu verteilen, was aber – wie wir nur zu gut wissen – noch nicht ausreicht, um uns Hexenschuss, Ischias und Schmerzspritzen zu ersparen. Damit auch die Gesäßmuskeln Platz fanden, veränderte sich das Becken und wurde schmaler. Dadurch wurde das Gebären beim Menschen schwieriger als bei Gorillas oder Schimpansen. Für den Erwerb des aufrechten Gangs bekamen wir also eine saftige Rechnung serviert: Wenn es uns trotz dieser Kosten heute noch gibt, kann das nur heißen, dass die Vorteile gegenüber den Nachteilen überwogen. Darauf werden wir in den nächsten Kapiteln zurückkommen.
Als bestimmte unserer Vorfahren auf zwei Beinen zu gehen begannen, spaltete sich ihre Entwicklung in zwei Linien auf, von denen die eine zu uns und die andere zu den Schimpansen führt. Wir wissen nicht mit Sicherheit, wann dies geschah. Aber bekannt ist, dass sich in Afrika, wo die gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse lebten, vor sechs Millionen Jahren das Klima veränderte. Statt heiß und feucht wurde es von Osten her immer trockener. Als Folge veränderte sich die Vegetation. Der Wald wich allmählich der Savanne, aus der hohe Bäume weitgehend verschwunden waren. Wie diese Veränderung der Umwelt hat sich auch die Reaktion unserer Vorfahren auf die neuen Verhältnisse über Jahrtausende vollzogen: Ein Teil der gemeinsamen Ahnen von Mensch und Schimpanse wagte sich immer häufiger in die Savanne hinaus und musste sich an die neue Umgebung anpassen, während der andere Teil in den noch bewaldeten Zonen verblieb. Wir stammen von den Erstgenannten ab. Während Baumkronen einen gewissen Schutz bieten, ist es in der Savanne überlebenswichtig, herannahende Fressfeinde möglichst schnell zu entdecken. Wer auf zwei Beinen steht, überblickt das umliegende Gebiet besser und kann rechtzeitig die Flucht ergreifen. Dies war vielleicht (vielleicht) der Hauptgrund, weshalb sich die Bipedie in dieser neuen Umgebung herausgebildet hat.
Vor etwas mehr als 3,5 Millionen Jahren haben drei Individuen mit einem aufrechten Gang und ähnlichen Füßen wie unseren, Vertreter der Gattung Australopithecus, Laetoli durchschritten. Sie waren nicht die Einzigen: In der verfestigten Asche blieben weitere Abdrücke von Säugetieren, Vögeln, Insekten und sogar von Regentropfen zurück. Dass es drei Individuen waren, können wir deshalb sagen, weil ihre Fußspuren unterschiedliche Abmessungen haben. Einige sind groß, andere kleiner und weitere so klein, dass sie erst auf den zweiten Blick inmitten der größeren entdeckt wurden: Dieses kleine Individuum setzte seine Füße wohl in die Fußstapfen der großen, um sich die Fußsohlen nicht zu verbrennen. Dass die Spuren dieser Wanderung bis heute erhalten blieben, ist verschiedenen aufeinanderfolgenden Naturereignissen zu verdanken: Zuerst gab es einen Vulkanausbruch, danach durchweichte Regen den Boden, über den dann diese drei Geschöpfe marschierten, während eine spätere Eruption das Ganze unter Asche begrub und es konservierte, bis Mary Leakeys Gruppe dieses anrührende Fundstück aus unserer Vergangenheit wieder ans Tageslicht holte.
Nach einer groben Berechnung anhand der Größe ihrer Füße könnten die beiden erwachsenen Individuen zwischen 1,30 Meter und 1,45 Meter und das kleine um 1,15 Meter groß gewesen sein. Mann, Frau und Kind? Eine traditionelle Familie im modernen Sinn noch vor Beginn der Vorgeschichte? Abwarten, es gibt weitere Überraschungen. Um diese – durchaus vertretene – Hypothese zu widerlegen, brauchte es eine italienische Expedition, die von Giorgio Manzi geleitet wurde. Der Bericht stammt von ihm persönlich: Im Jahr 2015 kommt in Laetoli, 100 Meter von den in den 1970er-Jahren entdeckten Fußspuren entfernt, ein weiterer Brocken Tuff mit Abdrücken zum Vorschein. Die Forschenden weisen nach, dass auch hier zweibeinige Individuen entlanggegangen sind, zur gleichen Zeit (die Datierung der Asche lügt nicht) und in gleicher Richtung wie die vormals identifizierten. Hier waren es fünf, nicht drei. Aber ein Individuum war größer als die übrigen: Mit 1,65 Meter hatte es nach heutigen Maßstäben Schuhgröße 41 und machte deutlich größere Schritte. Die Individuen von Australopithecus unterschieden sich also stark voneinander. Bei Geschlechtsunterschieden reden Zoologen vom Sexualdimorphismus, der sich bei Primaten in einem Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen äußert. Aller Wahrscheinlichkeit nach, so Giorgio Manzi, stammen die in Laetoli hinterlassenen Spuren von einem männlichen, wohl drei weiblichen (oder womöglich einem heranwachsenden) und einem kleinen Individuum, das bereits laufen gelernt hatte. Kurzum, wer seine Meinung in Bezug auf die Zusammensetzung der »natürlichen« Familie bestätigt sehen will, schaut sich besser woanders um. Die Sozialstruktur des Australopithecus oder zumindest der besagten Gruppe erinnert eher an die der Gorillas, in der sich ein erwachsenes Alphamännchen mit mehreren Weibchen umgibt (und paart).
Aber bislang war nur von Fußspuren die Rede. Von anderem Kaliber ist der Fund eines Fossils: eben Lucy. Lucy war wenige Jahre vor der Zufallsentdeckung der Fußabdrücke von Laetoli aufgetaucht, und auch hier war Glück im Spiel gewesen. Diesmal kein Elefantenkot, sondern die Entscheidung, auf dem Nachhauseweg eine andere Route einzuschlagen. Aber der Reihe nach: Donald Johanson, Paläoanthropologe an der Case Western Reserve University in Cleveland, und sein damaliger Student Tom Gray hielten sich zum Forschungseinsatz in der Gegend von Hadar in der äthiopischen Region Afar auf. Hadar liegt ein gutes Stück nördlich von Laetoli, aber innerhalb derselben geologischen Formation, dem Großen Afrikanischen Grabenbruch, der Ostafrika von Eritrea bis Mosambik in Nord-Süd-Richtung durchzieht. Johanson erzählt, dass er am 24. November 1974 wenig Lust zum Arbeiten verspürt habe, aber Gray es wichtig gewesen sei, wenigstens die Koordinaten einer Fundstelle aufzunehmen, wo sie später Grabungen durchführen wollten. Um auf dem Rückweg zum Land Rover nicht in der prallen Sonne gehen zu müssen, nahmen sie eine Route durch ein Gebiet, durch das sie bislang noch nicht gekommen waren. Wie immer heftete Johanson seine Augen auf den Boden, weil man auf diese Weise Fossilien entdeckt. An einer Stelle stieß er auf einen bestens erhaltenen Ellenbogen, der aus dem Boden ragte, an dem noch die Elle war, einer der beiden Unterarmknochen. In der Region Hadar wimmelt es vor Überresten von Pavianen, aber Johanson erkannte sofort, dass sie es hier mit einem anderen Knochen, dem eines Homininen, zu tun hatten.
(Hier ist jetzt eine kurze fachliche Parenthese fällig. Wir gehören mit den Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans zur Familie der Menschenaffen oder Hominiden. Hominini sind dagegen eine sogenannte Tribus, eine Untergruppe der Hominiden, zu der nur wir Homo sapiens sowie unsere ausgestorbenen Vorfahren der Gattung Australopithecus, Paranthropus, Homo und weitere zählen. Als Australopithecus bezeichnen wir demnach einige kleinwüchsige Hominiden-Arten, von denen wahrscheinlich die Arten der Gattung Homo abstammen.)
Tom Gray war zunächst nicht überzeugt, dass sie eine wichtige Entdeckung gemacht hatten. Aber er änderte seine Meinung, als er kurz darauf beinahe auf einen Schädel trat. Obwohl Tom als stiller Typ bekannt gewesen sei, so erzählt Johanson, habe er auf der gesamten Rückfahrt ständig auf die Hupe gedrückt. Dass sie auf ein besonders altes Fossil gestoßen waren, wussten sie wegen der Elefantenknochen, die sie aus derselben Lagerstätte geborgen und auf ein Alter von über drei Millionen Jahren datiert hatten. Es musste eine neue Spezies der Gattung Australopithecus sein.
Sie benannten sie nach der Region des Fundplatzes, Australopithecus afarensis, aber zur weltweiten Berühmtheit des aufgefundenen Fossils trug vor allem der Spitzname Lucy bei. Dessen Ursprung ist bekannt: Als Johanson die Skelettreste zusammensetzte, hörte er sich eine Kassette der Beatles an, mit seinem Lieblingssong: »Lucy in the Sky with Diamonds«.AL 288 – 1 (so die wissenschaftliche Bezeichnung des Fossils) hätte die Fantasien kaum so stark beflügelt: die von Millionen Kindern, Studierenden, Dokumentarfilmern und Hobby-Anthropologen. Für sein ehrwürdiges Alter ist von Lucys Skelett noch reichlich viel erhalten: ungefähr 40 Prozent, einschließlich eines guten Teils vom Schädel. Insgesamt tauchten in Hadar über 400 Knochenreste von Australopithecus afarensis auf, die besonders wichtige Aufschlüsse lieferten. Der Untersuchung der Atome (fachlich: Isotope) in Lucys Zähnen verdanken wir eine Vorstellung von ihrer Ernährung, die typischerweise vegetarisch war: Früchte und Grünzeug, zuweilen wohl auch Insekten. Auch kamen in der Schicht, in der sie gelegen hatte, zahlreiche Reste von Schildkröten- und Krokodileiern zum Vorschein, sodass diese Eier wahrscheinlich auch zu ihrer Kost gehörten. Etwas weiter vorn war die Rede davon, dass Lucys Spezies vielleicht nicht die einzige mit einem aufrechten Gang gewesen war. Damit meinte ich andere, in Kenia und Äthiopien aufgefundene Fossilien, die auf ein Alter von drei bis vier Millionen Jahren datiert wurden. Die Skelette sind allerdings sehr unvollständig, weshalb beispielsweise die Form der Füße unbekannt ist. Ohne die Sache weiter zu vertiefen, sei nur gesagt, dass sie die Gattungsnamen Kenyanthropus und Ardipithecus erhielten, wobei unklar ist, ob sie ebenfalls Bipeden waren. Aber beim gegenwärtigen Wissensstand zweifeln nur wenige Experten daran, dass die Fossilien des Australopithecus afarensis den Beginn einer Kette biologischer Veränderungen markieren, an deren Ende der anatomisch moderne Mensch steht.