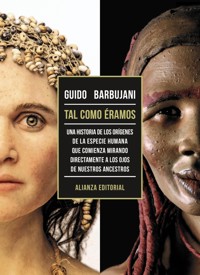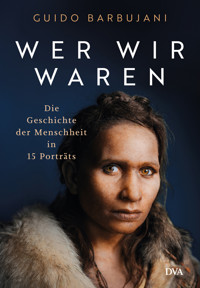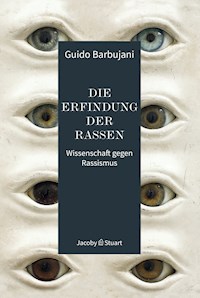
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlagshaus Jacoby & Stuart
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit in Rassen einzuteilen, war eine Obsession der Wissenschaft im 19. Jahrhundert, die im frühen 20. Jahrhundert zu einer mächtigen Bewegung wurde: Politiker, die ihren Anhängern versprachen, dass sie einer höheren Rasse angehörten, hatten allzu oft Erfolg damit. Die Folgen der Rassenideologie waren schrecklich. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hat die biologische Wissenschaft in ihrer modernsten Form, der Genetik, allen Rassentheorien endgültig den Boden unter den Füßen entzogen, doch immer wieder versuchen Vorkämpfer der Überlegenheit der "weißen Rasse" – auch mit scheinbar wissenschaftlichen Argumenten –, rassistische Vorurteile zu schüren. Der prominente Genetiker Guido Barbujani zeigt in diesem Buch, wie mit den Mitteln der Vernunft gegen den tiefverwurzelten rassistischen Unfug argumentiert werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guido Barbujani
Die Erfindung der Rassen
Wissenschaft gegen Rassismus
Aus dem Italienischen von Edmund Jacoby
FÜR ALEXIS ASTRINAKIS, DEN GROSSEN GRIECHEN
INHALT
VORWORT ZUR DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE
1. KapitelGRENZZIEHUNGEN
Worin wir uns fragen, ob es Menschenrassen gibt und was sie sein sollen
2. KapitelMENSCHENARTEN
Worin nachgewiesen wird, dass es nur eine einzige lebende menschliche Spezies gibt, wir aber Bekanntschaft mit verschiedenen ausgestorbenen Menschenarten machen
3. KapitelVON DER SCHÖPFUNG ZUM HUMANGENOMPROJEKT
Worin wir im Schweinsgalopp durch die Geschichte der Evolutionsbiologie und Genetik eilen
4. KapitelWOVON WIR REDEN, WENN WIR VON RASSEN REDEN
Worin wir überlegen, was eine Rasse sein soll
5. KapitelMENSCHENKATALOGE
Worin wir feststellen, dass es nicht nur einen Katalog der Menschenrassen gibt, sondern viele, sogar sehr viele
6. KapitelWAS UNS DIE GENE SAGEN
Worin festgestellt wird, dass es in den Genen keine Rassen gibt
7. KapitelMODELLE
Worin von drei Theorien zur Evolution der Menschheit die Rede ist
8. KapitelWAS DIE GENE UNS NOCH SAGEN
Worin endlich die DNA die Bühne betritt
9. KapitelWARUM WIR UNS NUR ALS AFRIKANER BEZEICHNEN KÖNNEN
Worin wir uns davon überzeugen, dass Afrika kein Kontinent ist wie alle anderen, und alte Knochen dabei helfen, alte Vorurteile zu widerlegen
10. KapitelEINER STAND SCHMIERE
Worin wir Zeugen mehrerer Versuche werden, die Rassenidee wiederzubeleben
11. Kapitel»ABER WENN DIE NEGER SO WÄREN WIE ICH, WÜRDE MAN SIE DOCH WEISSE NENNEN«
Worin wir uns mit dem gesunden Menschenverstand auseinandersetzen müssen
12. KapitelWIR SIND ALLE VERWANDT UND ALLE VERSCHIEDEN
Worin wir uns für die nächsten Folgen verabreden
DANKSAGUNG
KLEINES GLOSSAR
VORWORTZUR DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE
Als 2006 die erste Ausgabe dieses Buches herauskam, war das Humangenomprojekt gerade abgeschlossen – was mit großem Pomp gefeiert wurde: Pressekonferenz im Weißen Haus, eröffnet von Präsident Bill Clinton, der britische Premierminister Tony Blair über Satellit zugeschaltet, und die Botschafter des Vereinigten Königreichs, Japans, Deutschlands und Frankreichs in Fleisch und Blut zugegen. Nach dreizehn Jahren Arbeit und 2,7 Milliarden ausgegebenen US-Dollars hatte ein Konsortium von 2800 Wissenschaftlern es geschafft, zum ersten Mal ein Genom, das heißt, die gesamte DNA eines Menschen, auszulesen. Genau genommen kein komplettes Genom, sondern nur 92 %. Doch auch so war das ein so gewaltiger Schritt nach vorne, dass jemand in der ersten Begeisterung mit der Erfindung des Rads verglich. »Früher dachten wir, unser Schicksal stehe in den Sternen. Jetzt wissen wir, dass unser Schicksal zum großen Teil in den Genen liegt«, erklärte etwas übertrieben – wie er das manchmal macht – der Medizinnobelpreisträger James Watson. Doch gut. Jetzt lag der Text, in dem laut Watson das Schicksal geschrieben steht, offen vor aller Augen und war gelesen worden.
Kurz, als Die Erfindung der Rassen erschien, kannten wir nur ein einziges menschliches Genom, inkomplett und mit einer ganzen Reihe von Fehlern, die mit den Jahren korrigiert werden sollten. Vor allem war es aber nur ein einziges, doch erst, wenn wir viele Menschen miteinander vergleichen, können wir versuchen zu verstehen, welche DNA-Fehler Diabetes, Krebs, Bluthochdruck, Parkinson, Alzheimer und so weiter verursachen. In den zwölf Jahren seitdem hat es einen verblüffenden technischen Fortschritt gegeben. Heute gibt es mehrere Tausend ausgelesene (der Terminus technicus ist »sequenzierte«) Genome, und viele davon sind veröffentlicht, zugänglich für jeden, der sie für wissenschaftliche Zwecke nutzen möchte. Die Zahl der Fehler beim Auslesen ist sehr zurückgegangen, die Kosten noch stärker: Es geht nicht mehr um Milliarden, sondern um weniger als eintausend Euro, und es sind nicht Heerscharen von Wissenschaftlern dabei am Werk, sondern inzwischen genügt ein einziger Techniker; und wenn man ein paar Wochen auf die Resultate warten muss, liegt dies nicht an der enormen Zahl nötiger chemischer Reaktionen und bioinformatischer Analysen, sondern daran, dass die gewaltigen Maschinerien, die die DNA auslesen, rund um die Uhr ausgelastet sind, sodass man schon ein wenig Schlange stehen muss. Kaum jemand hat vorausgesehen, wie schnell es gelingen würde, diese astromischen Zahlen von Daten zu produzieren.
Diese Wissensexplosion hat die Wissenschaft, mit der ich mich beschäftige, die Genetik, verändert. Für mehr als ein Jahrhundert mussten sich die Genetiker mit ganz wenigen Daten begnügen und haben, angefangen mit Gregor Mendel, ausgeklügelte Methoden und Kalküle entwickelt, um überhaupt etwas zu verstehen. Und plötzlich finden wir uns inmitten einer Orgie von DNA-Sequenzen wieder und haben gar nicht die Zeit, sie gründlich zu untersuchen, weil jede Woche neue publik werden. Ich habe ausgerechnet, dass in einer einzigen Ausgabe der Zeitschrift Nature Genetics, der von März 2015, das isländische Team von Kári Stefánsson mehr genetische Daten publiziert hat als die Wissenschaftlergemeinde der ganzen Welt von Mendel bis zum Juni 2000. Das ist etwas über den Daumen gepeilt, doch wenn ich mich geirrt habe, dann nur um ein Weniges.
Heute versuchen wir Genetiker, uns in diesem Überfluss von Informationen zu orientieren, doch dieser ist auch ein Labyrinth, in dem wir hin- und hergerissen sind zwischen dem erregenden Gefühl, uns in einer Ausnahmesituation zu befinden (wegen der neuen Fragen, auf die wir versuchen können, Antworten zu geben), und einem Gefühl der Übersättigung (weil wir nicht die Zeit haben, alles Neue zu verdauen). Es ist noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Ich würde aber sagen, dass einerseits Watsons Voraussagen sich nicht bewahrheitet haben: Heute kennen wir zwar seine gesamte DNA (ja, Watsons Genom, das 2008 sequenziert worden ist), doch wir sind nicht in der Lage, daraus auf sein Gewicht und seine Größe zu schließen, ganz zu schweigen von viel komplizierteren Dingen wie seinem Blutdruck, seinem Infarktrisiko oder – was das Komplizierteste ist – seine Intelligenz (für die es im Übrigen keine befriedigende Definition gibt).
Aber ich möchte andererseits auch nicht zu pessimistisch erscheinen. Genome lesen zu können, erst eines und dann viele weitere, ist und bleibt eine unverzichtbare Methode, um viele grundlegende Fragen der Biologie beantworten zu können. Zweifellos haben wir die Schwierigkeiten unterschätzt, und der eine oder die andere hat sich vorgemacht, die Interpretation der Daten könne leicht sein; doch jetzt wissen wir wenigstens, dass Genome allein nicht genügen und dass wir ordentlich nachdenken müssen, um etwas zu verstehen. Wir sind auf dem rechten Weg, aber wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Strecke hinter uns.
Im Augenblick also verfügen wir über eine gigantische Fotografie – vielleicht wäre Mosaik die richtige Metapher – der genetischen Differenzen, die jeden von uns gegenüber seinen Mitmenschen zu einem anderen machen. Auch wenn es noch nicht die spektakulären Fortschritte in der Diagnose und der Verhütung von Krankheiten gibt, die sich manch einer erhofft hat, können wir viele andere Dinge mit einer Genauigkeit untersuchen, die vor zwölf Jahren noch unvorstellbar war: wie die Körperzellen funktionieren, wie sehr wir uns genetisch voneinander unterscheiden und durch welche Ereignisse diese Differenzen sich akkumuliert haben.
Vor Kurzem kam die Nachricht, dass man im Leipziger Max-Planck-Institut die DNA von Neandertalern in Nervenstammzellen einpflanzt, um herauszufinden, inwiefern die Entwicklung und das Funktionieren des Neandertaler-Gehirns von dem unseren abwich (The Guardian, 11.5.2018). Für jemanden, der sich mit der Evolution beschäftigt, war das Manna vom Himmel und für einen, der Bücher über die menschliche Diversität schreibt, eine eindeutige Aufforderung, up to date zu bleiben.
Das heißt, mit zwölf Jahren Abstand haben sich mehrere Teile dieses Buchs als veraltet erwiesen oder mussten entstaubt werden. Anfangs war ich etwas besorgt; nicht nur wegen der enormen Menge von Material, aus dem es auszuwählen galt und das sich oft nur schwer darstellen lässt, weil es technisch kompliziert ist. Vor allem aber war mir nicht klar, wie weit sich die Grundstruktur des Buchs erhalten ließe, die mir aus irgendeinem Grunde noch immer gut gefiel. Doch je weiter ich vorankam, desto deutlicher wurde mir, dass all diese Fortschritte nichts Wesentliches verändert hatten.
Im Großen und Ganzen können wir nur mit größerer Präzision vieles bestätigen, das wir bereits verstanden hatten. Es sind noch wichtige neue und zuweilen verblüffende Einzelheiten aufgetaucht (wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Europäer bis vor 7000 Jahren dunkelhäutig waren? Davon ist auf Seite 161 die Rede), und diese Einzelheiten haben sich in das Bild eingefügt, das in seinen Grundlinien jedoch dasselbe geblieben ist. Um es kurzzumachen: Es ist immer offensichtlicher geworden, dass der Begriff »Rasse« unnütz und schädlich ist, wenn wir die biologischen Grundlagen unserer Unterschiede verstehen wollen, denn die Menschheit besteht nicht aus biologisch unterschiedlichen Gruppen, wie wir sie bei anderen Arten als Rassen bezeichnen.
Erst als wir mit den unsinnigen Versuchen von Klassifikation nach Rassen aufgehört haben, konnten wir unsere Forschung auf das konzentrieren, was wirklich zählt – die Unterschiede zwischen Individuen und Populationen. Dabei setzen Letztere sich aus vielen Menschen mit unterschiedlicher DNA zusammen, die von immer wieder anderen Vorfahren auf uns gekommen ist.
Heute können wir in der DNA die Spuren der Wanderungen und des Austauschs nachverfolgen, die unser Genom im Laufe der Jahrtausende immer wieder neu gemischt haben und ihm das bunte Harlekinkostüm verliehen haben, das wir heute vor Augen haben. Ich musste keine der Kernaussagen des Buches ändern, wenngleich ich gemerkt habe, dass ich bei bestimmten Themen allzu sehr vereinfacht hatte (ich habe jetzt versucht, Abhilfe zu schaffen). Im Übrigen konnten wir vor zwölf Jahren vielfach nur Vermutungen anstellen, während wir heute präzise Nachweise führen können (was zu tun ich mich bemüht habe).
Doch als die erste Fassung dieses Buchs erschien, hoffte ich noch in frommer Einfalt, dass die Idee der Rasse in den kommenden Jahren in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung immer unwichtiger würde. Ich behaupte nicht, dass ich rationale Gründe dafür hatte, doch ich hielt es für selbstverständlich. Ich habe mich geirrt, und heute muss ich mich fragen, warum, was der Grund für das ist, woran mich immer wieder mal jemand mit skeptischem Grinsen erinnert: Wieso gibt es eigentlich einen so großen Unterschied zwischen dem, was du über Rasse sagst, und dem, was die Leute glauben?
Mir fällt dazu eine ganze Reihe an Antworten ein, was vielleicht bedeutet, dass ich noch keine wirklich gute gefunden habe. Zum Teil ist das ein altes Problem: Wenn die Dinge komplizierter sind, als wir sie uns vorstellen, und das sind sie häufig, ist es nicht einfach, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung anzuerkennen. Das ist eine Erfahrungstatsache für einen Genetiker ebenso sehr wie für jemanden, der vor Wunderdiäten oder Schreckensmythen über Impfungen zu warnen versucht. Es braucht Zeit: Althergebrachte Gemeinplätze zu ändern geht weder einfach noch schnell. Im 17. Jahrhundert war es nicht leicht, die Vorstellung durchzusetzen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. »Ich war den ganzen Tag am selben Ort; heute Morgen war die Sonne dort und jetzt ist sie hier, also hat sie sich bewegt«, schien dem gesunden Menschenverstand zu entsprechen. »Sie hat schwarze Haut, ich weiße, also gibt es Rassen«, zeugt ebenso von gesundem Menschenverstand und ist ebenso falsch. Und deshalb brauchen wir eine Weile, bis wir die Tatsache verdaut haben, dass unsere biologischen Unterschiede nur Übergänge auf einer Palette sind, deren Farben unwahrnehmbar miteinander verschwimmen.
Aber da ist noch etwas anderes. Viele Experten haben den Eindruck, dass die politische und gesellschaftliche Diskussion dahin tendiert, ihre ganz eigenen Wege zu gehen, wobei die Realität nur bis zu einem bestimmten Punkt zählt. Fake News, absichtlich in die Welt gesetzte Lügen, mit denen Gegner in Schwierigkeiten gebracht werden sollen oder die als Vorwand für brutale Aktionen benutzt werden, sind nur die Spitze des Eisbergs. So ist es schon oft gewesen. Der europäische Rassismus hat eine jahrhundertealte windungsreiche Geschichte, doch er erreicht seinen Höhepunkt in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Schon 1924 prangert Adolf Hitler die »Rassenschande« an, die die Stationierung von »Negerhorden« im Rheinland durch die Franzosen nach sich gezogen habe (gemeint waren die berühmten »Rheinlandbastarde«) und fordert »Lebensraum« in Osteuropa auf Kosten der für ihn biologisch minderwertigen Slawen. Im Juli 1933 trat das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« in Kraft, und im September 1935 die Nürnberger Rassegesetze, die die »Reinheit des deutschen Bluts« schützen sollten. 1938 wurden auch in Italien unter dem Slogan »Es ist Zeit, dass die Italiener sich offen als Rassisten bekennen« Gesetze erlassen, die die sogenannten italienischen Bürger jüdischer Rasse ihrer bürgerlichen Rechte beraubten, und mit ihnen zehn Millionen Libyer, Somalier, Eritreer und Abessinier, die unter italienischer Kolonialherrschaft standen. In beiden Fällen war es nicht leicht zu definieren, wer nun genau Jude war und wer nicht, und so wurden, um die politischen Entscheidungen mit allen verfügbaren Argumenten zu unterstützen, die berühmtesten Wissenschaftler der Zeit aktiviert: Anthropologen und Anatomen, Genetiker und Psychologen. Anscheinend fürchteten die Regierungen, dass ohne eine überzeugende wissenschaftliche Rechtfertigung die Menschen in Italien oder Deutschland sogar in den 30er Jahren, der Zeit des Aufstiegs und Triumphs des Faschismus, über die neuen Rassendiskriminierungen die Nase rümpfen könnten. Heute dagegen ist der rassistische Diskurs völlig losgelöst von allem, was sich Wissenschaft nennt. Die Politik der Diskriminierung wird mit Parolen (»Ausländer raus«, »Italiener zuerst/Americans first«, »Bevölkerungsaustausch«, »Umvolkung«, »Herren im eigenen Haus«) beschworen, die keinerlei Rechtfertigung brauchen, erst recht keine wissenschaftliche. Der letzte Schleier ist gefallen, man erklärt sich freimütig zum Rassisten und basta.
Vielleicht hat das, jedenfalls zum Teil, damit zu tun, dass der Zusammenhang zwischen Rasse und Rassismus weniger eng ist als der gemeinsame Wortstamm vermuten lässt. »Rasse« ist der Zerrspiegel, in dem Generationen von Naturwissenschaftlern, Anthropologen und Genetikern die Unterschiede zwischen den Menschen betrachtet haben, bis sich herausgestellt hat, dass diese in diesem Zerrspiegel nicht richtig wiedergegeben werden können. Rassismus dagegen hat mit unseren Rechten zu tun und mit der Behauptung, dass aus der Herkunft, der Hautfarbe oder dem Pass unterschiedliche Rechte erwachsen. Es ist zwar richtig, dass rassistische Politik sich oft auf Rassentheorien gestützt hat, aber das muss nicht so sein, und in der Tat ist das heute immer weniger der Fall. Man muss nicht an die Existenz menschlicher Rassen glauben, um für eine diskriminierende und fremdenfeindliche Politik zu sein. Du hast kein Recht, dies und das zu tun, weil du Schwarzer, weil du Immigrant oder weil du Muslim bist, sind drei gleichwertige Behauptungen, aber nur die erste ist genau genommen rassistisch. Also lassen wir die Wissenschaftler nur über ihre Genome oder ihre prähistorischen Wanderungen debattieren. Um zu entscheiden, wer das Recht hat, sich als Bürger eines europäischen Staates zu fühlen, und dieselben Rechte wie die anderen Bürger hat, die dort geboren sind, spielt das keine Rolle.
Man kann dagegen sein und wieder eine Verbindung zwischen den Ideen der Wissenschaft und der politischen und sozialen Praxis herstellen wollen. In der Tat ist es das, was dieses und andere Bücher versuchen. Doch ein Buch ist keine große Sache, und die Welt verändert sich schnell. Neue Technologien und die Globalisierung haben dem Norden unserer Erde größeren Reichtum beschert, allerdings bei hohen sozialen Kosten und einer monströsen Ungleichverteilung.
Populistische Politiker haben es verstanden, den Protest der verarmten oder verängstigten Gesellschaftsschichten für sich zu nutzen, indem sie ihn entweder nach unten lenkten, gegen die Immigranten, die angeblich den Einheimischen Arbeitsstellen, Wohnungen und Unterstützung wegnehmen, oder nach oben, gegen die Eliten, die in dieser simplen Weltsicht schuld daran sind, dass der Wandel nicht gut gemanagt wurde. Wie kann ich den sogenannten Experten in Washington, Brüssel, Berlin oder Rom vertrauen, wenn sie doch nicht verhindern konnten, dass meine Bank pleite gegangen ist, dass meine Tochter, die doch das Abitur hat, in einem Callcenter arbeiten muss oder mein Mann durch einen Roboter ersetzt worden ist?
Und wenn ich dieser Politikerkaste misstraue, wie soll ich da den Wissenschaftlern vertrauen, die niemand gewählt hat und die also eine noch üblere Kaste sind?
Wieder einen Raum für eine konstruktive Diskussion zu schaffen, bei der auch Wissen und Kompetenz eine Rolle spielen dürfen, mit dem Ziel, allseits akzeptierte Lösungen zu finden und nicht bloß einen Konsens durchzuboxen – das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Ein Buch ist keine große Sache und kann nicht viel bewirken. Und doch schien es mir nach zwölf Jahren der Mühe wert, dieses Buch auf den neuesten Stand des Wissens zu bringen, aus demselben Grund, aus dem wir uns jeden Abend die Zähne putzen: Es reicht nicht, um Karies zu vermeiden, aber es ist besser als nichts.
Die Ideen der sogenannten populistischen Bewegungen verfangen zweifellos bei vielen Bürgern in der halben Welt, aber sie haben auch eine entscheidende Schwäche: Es kann so aussehen, als funktionierten die Ideen; das tun sie aber nur in winzigen Bereichen, denn sie konzentrieren sich ganz auf unmittelbar gegenwärtige Probleme, für die sie angeblich einfache und äußerst kurzatmige Lösungen anbieten. Und da in ihnen nur von Einzelheiten die Rede ist, von Mauern, die errichtet werden sollen, von Aufenthaltsgenehmigungen, die nicht gewährt werden sollen, so als ginge es darum, eine kleine alte heile Welt zu schützen, die sich aufzulösen droht und die es vielleicht nie gegeben hat, weigern sie sich, die Dinge in einer etwas größeren Perspektive zu betrachten. Es ist so, als würden sie wieder zu Kindern: Sie leben in der Gegenwart, um die größeren Sachen kümmern sich die Erwachsenen. Aber vergessen wir nicht: Auch Kinder haben viel zu leiden. Jede Erkältung, jede Trennung von einer geliebten Person ist ein Trauma, weil das Leben in der Gegenwart nicht das Bewusstsein ermöglicht, dass alles sich ändern kann, dass das Fieber vergeht, dass die geliebte Person wiederkommt.
Ich bin davon überzeugt, dass die kurzsichtige Debatte darüber, wie sich der Strom der Immigration aufhalten lässt – der nach jeder seriösen Analyse noch über viele Jahre zunehmen wird –, uns zu Gefangenen der Gegenwart macht, zu Kindern. Und uns damit dazu verdammt, wie die Kinder zu leiden, weil wir die Komplexität der Erscheinungen aus dem Blick verlieren. Stattdessen sollten wir versuchen, erwachsen zu sein. Und hier heißt erwachsen sein, die Dinge in ihrem Zusammenhang zu betrachten und zu verstehen, dass wir Menschen wandern, nicht heute oder gestern, sondern schon immer; zu verstehen, woher wir kommen und wie groß die Unterschiede zwischen uns sind, natürlich auch, weil viele Menschen diese Unterschiede in übertriebener oder verzerrter Form wahrnehmen. Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch denen, die es lesen, dabei hilft, die eine oder andere hier oder da aufgeschnappte oberflächliche oder falsche Vorstellung loszuwerden und sich mit ein paar Vorurteilen weniger in der Welt umzusehen.
Guido Barbujani, im November 2020
1. KAPITEL
GRENZZIEHUNGEN
Worin wir uns fragen, ob es Menschenrassen gibt und was sie sein sollen
Immer neue Grenzen werden gezogen, stellen wir fest. Laut Wikipedia gab es im Februar 2018 siebenunddreißig Grenzkonflikte, die jeweils im Vorjahr mehr als hundert Todesopfer forderten. Das Verzeichnis geht von A wie Afghanistan über J wie Jemen bis Z wie Zimbabwe und umfasst auch die unzähligen Fälle, in denen es zwar nicht zu Begegnungen zwischen Streitkräften kommt, in denen aber Konflikte zwischen Menschen verschiedener ethnischer Gruppen das tägliche Leben bestimmen: die Rechte der Bürger und ihren Zugang zu natürlichen Ressourcen, zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung. Fremdenhass und Rassismus, Phänomene, die wir noch vor wenigen Jahren als Überreste von Unterentwicklung wahrgenommen hatten, die bald verschwinden würden, sind zu globalen Problemen geworden, und keine Gegend der Welt ist dagegen immun.
Der Südtiroler Friedensaktivist Alexander Langer hat einmal gesagt, wir müssten die Grenzen, wenn wir sie nicht ganz abschaffen können, wenigstens durchlässig machen. Doch stattdessen wurden in den letzten 20 Jahren vor allem immer neue Grenzen erfunden, oft willkürliche und stets bestreitbare, die um neue Identitäten gezogen werden, die sich dadurch wiederum verhärten – was dann dazu führt, dass dasselbe auf der anderen Seite der Grenze geschieht. All dies sei, so sagt man uns, durch die untrennbare Verbindung von Blut und Boden gerechtfertigt, zwischen einem Territorium und denjenigen, die es seit je besiedelt haben und deshalb seine einzigen legitimen Bewohner seien. Wir sind, so sagen dieselben Leute, grundsätzlich, und zwar biologisch, verschieden, und wir können unsere Identität, die in unserem Blut (wie es früher hieß) oder in unserer DNA* (wie man heute sagt) wurzelt, nur verteidigen, wenn wir auch unser Territorium gegen die Invasionen von Trägern einer anderen Identität verteidigen.
Der Konflikt zwischen Identitäten ist kein gewöhnlicher politischer Konflikt. Er betrifft nicht, was jemand macht oder machen will, sondern wer jemand ist oder zu sein meint. Und deshalb ist er unlösbar. Zwischen politischen Gegnern gibt es immer die Möglichkeit zu vermitteln und zu verhandeln, in der Anthropologie oder der Biologie gibt es sie nicht. Wenn Gruppen unterschiedlicher Identität es nicht schaffen, miteinander zu leben, gibt es nur die Möglichkeit, sie zu trennen und zu hoffen, dass der Waffenstillstand hält. Der Preis, der dafür gezahlt werden muss, ist eine Vervielfachung von Grenzen und damit einhergehenden Spannungen – nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch entlang weniger genauer Trennlinien durch Staaten, Regionen und sogar Stadtviertel, in denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur oder unterschiedlichen Einkommens misstrauisch beäugen oder ostentativ ignorieren.
Und was passiert mit denjenigen, die gezwungen sind, außerhalb der eigenen Grenzen zu leben oder dies sogar freiwillig gewählt haben? Das haben wir alle vor Augen. Von Europa bis Afrika, von Asien bis Süd- und Nordamerika verfestigt sich immer mehr die Vorstellung, dass nicht jeder Mensch überall dieselben Rechte hat. Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Religion oder ihres Passes zu diskriminieren, verbreitet sich immer mehr und wird immer weniger als Skandal empfunden.
Es ist ein alter Gemeinplatz, dass Wissenschaftler sich nicht gern mit dem unmittelbar Lebenswichtigen befassen, sondern sich lieber in ihren schönen Laboratorien mit langwierigen Forschungen beschäftigen. Vielleicht stimmt das auch, doch dann haben wir es in unserem Fall mit einer Ausnahme zu tun. Mit den biologischen Grundlagen der Diversität* der Menschen oder, wie man einmal zu sagen pflegte und heute wieder zu sagen beginnt, mit der Natur und der Existenz menschlicher Rassen, haben sich, oftmals sogar leidenschaftlich, die größten Geister der Biologie befasst, von Linné und Darwin bis hin zu vielen Zeitgenossen (die leider selten das Niveau ihrer Vorgänger erreichen). Das Konzept der Rasse* wurde das gesamte 18. und 19. Jahrhundert hindurch diskutiert, bis es im 20. Jahrhundert dann zu dramatischen und schwerwiegenden Konsequenzen führte. Aus naheliegenden Gründen pausierte die Diskussion in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, allerdings nicht überall: Man denke nur an die Bürgerrechtskämpfe in den Vereinigten Staaten während der fünfziger und sechziger Jahre. Dann, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, kommt der Begriff »Rasse« wieder in Mode. Genetische und anthropologische Studien werden dazu veröffentlicht, und die Wissenschaft beginnt sich über die Bedeutung des Rassenkonzepts zu streiten. Einerseits gelingt es keiner dieser Untersuchungen zu beweisen, dass es in unserer Spezies* deutlich unterscheidbare Rassen gibt wie etwa bei Hunden und Pferden (was, wie wir sehen werden, keine guten Beispiele sind) oder bei Schimpansen (das passt schon besser). Dass unsere Identität, wie immer wir sie definieren mögen, etwas mit unseren Genen* zu tun hat, hat noch niemand nachweisen können. Andererseits gehört das Wort »Rasse« zur Sprache (und zum Denken) vieler Menschen, und wenn dies auch nicht heißt, dass der Begriff sinnvoll ist, so ist er doch einfach verständlich, und das macht es schwierig, ihn durch andere zu ersetzen, die die Vielfalt der Menschheit besser und richtiger beschreiben.
In Wirklichkeit reicht die wissenschaftliche Diskussion über die Rasse weit über die Biologie hinaus und beschäftigt die Sozialpolitik sowie die Politik überhaupt. 2017 forderte Patrizia Prestipino, Mitglied der Führung des Partito Democratico, der sozialdemokratischen Regierungspartei in Italien, Maßnahmen für die Verteidigung der »italienischen« Rasse; im Januar 2018 fand diese Forderung ihr verstärktes Echo in den Worten des Mitte-links-Kandidaten für die Präsidentschaft der Region Lombardei, Attilio Fontana, der die von den vielen Immigranten und ihrer exzessiven Fertilität* bedrohte Bevölkerung von der italienischen auf die weiße Rasse erweiterte.
In Interviews mit der Presse erklären namhafte US-Genetiker, gleich ob Spezialisten oder nicht, dass es nötig sei, die Rasse im Auge zu behalten, damit kein Geld für nutzlose Medikamente vergeudet wird oder für Schulprojekte, die unsinnige Hilfen für diejenigen anbieten, die durch ihre Gene dazu verdammt sind, es eh nicht zu schaffen. Sie führen den Alkoholismus und die Kreislauferkrankungen der Ureinwohner in den großen Städten Australiens und Nordamerikas auf Erbfaktoren zurück und machen damit ein soziales Problem zu einem medizinischen.
Das Buch The Bell Curve, in dem eins zu eins die Ideen von Cesare Lombroso, dem berühmten Kriminologen aus dem 19. Jahrhundert, nachgebetet werden und das zu dem Ergebnis kommt, dass die technologischen Innovationen auf der Welt stets das Verdienst der Weißen mit ihrer überlegenen Intelligenz sind und gewesen sind, war ein Bestseller in der halben Welt und hat enthusiastische Kommentare auf der Website von Amazon bekommen. Im März 2005 ist an prominenter Stelle in der New York Times ein Artikel von Armand Marie Leroi (ein Experte für Nematoden, also Fadenwürmer, von dem keine Forschungen zum Menschen bekannt sind) zum Thema »Rasse« erschienen. Ohne irgendwelche Daten beizubringen behauptet er, dass ja für jeden evident sei, dass es Menschenrassen gibt, dass aber einige Wissenschaftler sich aus politischen Gründen weigerten, dies zuzugeben, und dass wir nur Vorteile davon hätten, wenn wir unsere Rassenunterschiede zugäben: medizinische, soziale und ästhetische (jawohl, ästhetische).
Und weiter: Nicholas Wade, lange Zeit verantwortlich für die Wissenschaftsseiten der New York Times, ist der Ansicht (was von interessierter Seite in Abrede gestellt wird), die Genetiker hätten bewiesen, dass die Unterschiede in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung unter den Völkern der Erde auf ihre unterschiedlichen Gene zurückgehen. Es müsste doch etwas in den Genen geben – etwas, das genauer zu benennen Wade sich sehr wohl hütet, weil er es so genau auch nicht weiß –, das Afrikaner dazu bringt, Stammesverhalten an den Tag zu legen, Juden dazu, glänzend mit dem Kapitalismus zurechtzukommen, und die Europäer dazu, das Recht zu achten, oder es die Himalayabewohner schaffen lässt, in großen Höhen bei geringem Sauerstoffgehalt der Luft ihre Lager aufzuschlagen.
Bei all diesen Beispielen handelt es sich im besten Falle um unbewiesene Hypothesen, doch zumeist um ausgemachten Blödsinn, der gleichwohl als unbestreitbares Faktum dargestellt und verbreitet wird. Es sind gerade mal gut 65 Jahre vergangen, seit die Schwarzen in Montgomery in Alabama am ersten Dezember 1955 beschlossen, die Autobusse zu boykottieren, weil sie sich im Bus nicht dorthin setzen durften, wo sie wollten, und etwa dreißig Jahre seit dem Fall des südafrikanischen Apartheidsystems. Es scheint, als seien seitdem Jahrhunderte vergangen. Bei uns in Italien allerdings haben, um nur ein Beispiel zu nennen, Parlamentarier der Lega Nord 2003 vorgeschlagen, getrennte Eisenbahnwagen für Schwarze und Weiße auf der Strecke von Verona zum Brenner vorzusehen.
Man könnte den Eindruck haben, dass das Durcheinander von neuen Ängsten, alten Gemeinplätzen und schwerverständlichen wissenschaftlichen Daten uns nicht daran hindert, munter über die Natur, die Ursachen und die Folgen der Verschiedenheit unter den Menschen zu diskutieren. Doch so ist es eigentlich nicht. Natürlich wäre es naiv zu glauben, dass tief verwurzelte Phänomene wie Fremdenhass und Rassismus mit einem Schlag verschwänden, wenn wir nur besser über unsere Unterschiede untereinander und unter unseresgleichen nachdächten.
Doch wenigstens zwei wichtige Fragen können und müssen in streng wissenschaftlicher Weise gestellt werden, wobei (vorübergehend) ihre politischen Implikationen beiseitegelassen werden können. Erstens glauben, wie gesagt, manche, dass unsere Spezies ein Mosaik von biologisch gut unterscheidbaren Gruppen ist, deren ethnische Identität uralt ist und in unseren Genen wurzelt. Und zweitens glauben sie, dass aus diesen biologischen und letztlich rassischen Unterschieden notwendig unterschiedliche Lebensstile und verschiedene Niveaus von Intelligenz und Moral resultieren. Anders gesagt: Es gibt klare Grenzen zwischen Menschengruppen, und die sowohl biologischen als auch kulturellen Grenzen, durch die unser im Wesentlichen unveränderliches Aussehen und Verhalten bestimmt ist, sind bereits in unserer DNA eingeschrieben. Es bleibt uns demnach nichts anderes übrig, als entsprechend zu handeln und die Verteidigung unserer Grenzen zu verstärken. Das sind alte, sogar uralte Vorstellungen, doch sie haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Lebendigkeit bewiesen.
In diesem Buch werde ich dagegen festhalten, dass, soviel wir wissen, der Begriff Rasse für keine in der DNA unserer Spezies erkennbare biologische Realität steht und dass es deshalb auch nichts Angeborenes und Unveränderbares in den ethnischen oder kulturellen Identitäten gibt, die wir heute kennen. Dahingehend sind die Auffassungen der Wissenschaft ganz klar.
Rassen haben wir erfunden und sie jahrhundertelang für gegeben erachtet, doch inzwischen wissen wir genug, um sie abzuschaffen. Heute wissen wir, dass wir »alle verwandt und doch verschieden« sind, wie eine gelungene Parole des französischen Genetikers André Langaney lautet, und es bedarf keiner weiteren Untersuchungen mehr, um uns davon zu überzeugen. Den Fakt, dass wir alle (ausgenommen zum Teil eineiige Zwillinge) genetisch verschieden sind, bezweifelt, glaube ich, niemand: Dafür müssen wir nur um uns blicken.
Über das »alle miteinander verwandt« müssen wir allerdings noch einmal nachdenken. Wir sind heute siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Erde, doch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts waren wir erst weniger als eine Milliarde, und vor 2000 Jahren mehr oder weniger 150 Millionen. Und bekanntlich hat jede und jeder von uns zwei Eltern, vier Großeltern und acht Urgroßeltern. Nur selten lernt jemand seine Urureltern kennen, doch wir wissen, dass wir sechzehn davon hatten, und so geht es weiter zurück, indem wir jede Generation mit zwei multiplizieren. Das bedeutet, dass jeder von uns vor zehn Generationen – sagen wir, bei der Geburt von Mozart – über tausend (genau: 1024) Vorfahren hatte, von denen wiederum 250 Jahre früher, zur Zeit der Entdeckungen von Kolumbus, jeder tausend Vorfahren hatte. Jede und jeder von uns stammt von einer Million Vorfahren ab, die zu der Zeit von Kolumbus gelebt haben, von einer Million Millionen Vorfahren aus dem Jahr 1000 und einigen Milliarden Milliarden zur Zeit Jesu. Aber wie soll das möglich sein? Tatsächlich ist das nicht wirklich möglich: So viele Menschen hat es auf der Erde nie gegeben. In Wirklichkeit handelt es sich um eine abstrakte Überlegung: Das alles sind unsere virtuellen Vorfahren und nicht etwa Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben. Ehen zwischen Blutsverwandten reduzieren die Zahl der Vorfahren; wenn Cousins und Cousinen heiraten, haben ihre Kinder nur sechs statt acht Urgroßeltern. Also: Damit unsere sich im Endlosen verlierende Genealogie in den Grenzen der historischen Weltbevölkerung bleibt, müssen wir annehmen, dass viele der Verbindungen, aus denen wir über die Jahrtausende hervorgegangen sind, solche zwischen Verwandten waren, die, meist ohne dies zu wissen, von gemeinsamen Vorfahren abstammten. Doch die Tatsache, dass jede und jeder von uns theoretisch eine unüberschaubare Anzahl von Vorfahren hat, allein im letzten Jahrtausend, bedeutet, dass viele meiner Vorfahren auch die Vorfahren derer sind, die dieses Buch gerade lesen. Anders kann man das nicht sehen. Douglas Rohde vom Massachusetts Institute of Technology hat ausgerechnet, dass im Durchschnitt zwei von uns allen einen gemeinsamen Vorfahren haben müssen, der vor wenig mehr als 3000 Jahren gelebt hat. »Im Durchschnitt« bedeutet, dass manche von uns diese gemeinsamen Vorfahren vor längerer Zeit gehabt haben mögen, andere wiederum vor kürzerer Zeit. Doch wir können uns darauf verlassen, dass jede uns unbekannte Person unsere mehr oder weniger nahe Verwandte oder unser Verwandter ist. Dafür müssen wir nur ein wenig in der Zeit zurückgehen.
Wenn wir so in der Zeit zurückgehen, finden wir den fossilen und genetischen Nachweis dafür, dass die große Menschheitsfamilie von einer kleinen, vielleicht ein paar Tausende Individuen umfassenden Gruppe abstammt, die vor 100 000 Jahren in Afrika lebte. Viele Einzelheiten ihrer Geschichte sind uns unbekannt, doch die 100 000 Jahre bedeuten, dass wir eine ziemlich junge Art sind: Leben auf der Erde gibt es seit fast vier Milliarden Jahren. Und wir sind sehr mobil: In diesen 100 000 Jahren haben wir von Afrika aus den gesamten Planeten besiedelt, und dann haben wir uns fortwährend von hier nach dort bewegt. Wir sind auch eine fruchtbare Art, denn wir sind im selben Zeitraum auf die heutigen über sieben Milliarden Angehörige gewachsen.
Und darüber hinaus sind wir eine sehr hybride* Spezies, deren Populationen*, auch wenn sie über lange Zeiträume isoliert waren, sich doch begegnet sind und sich immer wieder vermischt haben, in einem Prozess, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: In Sizilien gab es, bevor die Griechen kamen, Sikuler und Sikaner. Ihnen folgten die Römer, die Byzantiner, die Araber, die Normannen, die Anjou, die Aragonesen, die Piemontesen und so weiter. Alle haben ihr Erbe hinterlassen, und als die Sizilianer nach Amerika auswanderten, haben sie das vielfältige Erbe ihrer Vorfahren mitgenommen, das sich nun langsam aber sicher mit dem von Vorfahren aus Irland, Guinea oder Mexiko vermischt …
Die menschliche Biodiversität*, die Summe der von uns allen – den Angehörigen der menschlichen Spezies – ererbten Unterschiede, ist vor allem die Folge dieser Phänomene: unserer Mobilität, unserer Fruchtbarkeit und einer ausgeprägten Tendenz, uns miteinander zu vermischen. Bei einer so vermischten und vereinheitlichten Spezies müssen wir uns nicht wundern, wenn wir heute überall, wenn auch mit unterschiedlicher Häufigkeit, dieselben Genvarianten* vorfinden: von der Wiege der Menschheit in Afrika bis nach Sibirien, von Ozeanien bis Europa. Wir wissen, dass wir, wenn wir weit genug in unserer Genealogie zurückgehen, herausfinden werden, dass unsere Ahnen alle aus Afrika stammen; wir wissen auch, dass unsere Gene im Wesentlichen bestimmen, wie wir aussehen und wie intelligent wir sind. Wir wissen aber keineswegs, ob und in welchem Maß die kulturellen Unterschiede zwischen Populationen aus genetischen Unterschieden resultieren könnten, die in Wahrheit meist äußerst gering sind, wie zum Beispiel die zwischen Serben und Kroaten, Tutsi und Hutu, Flamen und Wallonen, Katalanen und Kastiliern.
Wie wir dies erklären und was es bedeutet, möchten wir in den folgenden Kapiteln erläutern. Wir werden eine Geschichte erzählen, die ihre epischen und zuweilen fabelhaften Aspekte hat, denn sie ist im Grunde die Geschichte davon, wie die Menschheit es geschafft hat, indem sie in der Zeit zurückgegangen ist, ihre entferntesten Vorfahren ausfindig zu machen und ihr Schicksal über tausende Generationen hinweg zu rekonstruieren. In dieser Geschichte entgeht die Heldin, die Menschheit, wie in einem spannenden Abenteuerfilm nur um Haaresbreite der Katastrophe, aber entgeht ihr am Ende dennoch dank ihrer Zähigkeit, bislang jedenfalls, so wahr es uns gibt.
Wir können diese Geschichte rekonstruieren, weil sie eine Spur in unseren Zellen* hinterlassen hat. Bereits lange vor der Erfindung der Schrift, vor den ältesten archäologischen Zeugnissen, hat unsere DNA die Ereignisse aufgezeichnet, mit denen wir uns entwickelt haben. Genauso wie bei allen anderen Tieren und den Pflanzen, die auf der Erde leben. Die allmähliche Unterscheidung von den Menschenaffen, die ersten Wanderungen* der Menschheit, die demographischen Krisen, die Ausbreitung über fünf Kontinente und deren Besiedlung haben Zeichen hinterlassen, die Genetiker und Anthropologen zu entziffern gelernt haben. Darüber werden wir ausführlich berichten.
Im Unterschied zu den meisten Abenteuerfilmen ist allerdings nicht ausgemacht, ob diese Geschichte ein gutes Ende hat. Dazu kann man unterschiedlicher Meinung sein; jedenfalls gibt es keinen Grund, sich darüber keine Sorgen zu machen, angesichts der Entwicklung des Klimas und der Demographie auf unserem Planeten. Schließlich haben Millionen Arten die Erde einst besiedelt, die längst ausgestorben sind. Und was ist an uns so besonders, dass wir behaupten könnten, bei uns sei das anders? Andererseits jedoch steht nirgends geschrieben, was mit den Genen und der Kultur geschieht, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben; dies hängt also auch von uns selbst ab. Kurz, die Partie ist noch nicht zu Ende gespielt. Und so ist es der Mühe wert, uns mit der Geschichte unserer Anfänge, unserer Verschiedenheit und unserer Entwicklung zu befassen: Denn es ist besser, unsere Zukunft mit einigen Kenntnissen über unsere Vergangenheit anzugehen, Kenntnissen davon, wie wir geworden sind, was wir sind.
Die Website https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_andauernden_Kriege_und_Konflikte zählt die aktuellen bewaffneten Konflikte in der Welt auf und klassifiziert sie (auf makabre Weise) nach der Zahl der Opfer.
Die UNO bietet einen guten Online-Kurs zu vielen aktuellen Themen an, United Nations Cyberschoolbus (http://cyberschoolbus.un.org/); Zwei Lektionen darin handeln von ethnischer und rassistischer Diskriminierung.
Über den Alkoholmissbrauch bei Ureinwohnern in den australischen Städten finden sich viele Informationen unter http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/frames.htm.
Offenbar ist: C. Murray, R.J. Herrnsteins Bestseller, The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life (1994) nie ins Deutsche übersetzt worden, hat allerdings in Deutschland Nachahmer gefunden, wie wir im 6. Kapitel sehen werden.
Nicholas Wade hat parallel zur Veröffentlichung seines Buchs A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History, New York 2014, einen Artikel für das Time Magazine verfasst: What Science Says About Race and Genetics (9. Mai 2014), der sich auf dieser Website findet: http://time.com/author/nicholas-wade/.
Eine Antwort von 139 Genetikern, den Autor dieses Buchs inbegriffen, ist in der New York Times am 10. August 2014 erschienen (http://cehg.stanford.edu/letter-from-population-geneticists/). Dort heißt es: »Wade vermischt eine unvollständige und ungenaue Beschreibung unserer Forschungen mit der Behauptung, die natürliche Auslese habe möglicherweise zwischen den Bevölkerungen der Welt zu Unterschieden des Intelligenzquotienten, der politischen Institutionen und der wirtschaftlichen Entwicklung geführt. Wir weisen die Behauptung von Wade zurück, dass unsere Forschungsergebnisse seine Ideen in irgendeiner Weise stützen. Das ist nicht wahr.«
Der Artikel von Armand Marie Leroi ist in der New York Times am 14. März 2005 erschienen: http://raceandgenomics.ssrc.org/Leroi/.
Über die Ausstellung Tous parents, tous différents kann man nähere Angaben finden unter http://anthro.unige.ch/tptd/fr/. Leider ist das Buch von A. Langanay mit demselben Titel, Paris 1992, nicht mehr erhältlich.
Auf der Website: http://desip.igc.org/populationmaps.html finden sich schöne Karten, die das Wachstum der Menschheit im Lauf der Jahrhunderte darstellen.
Die Grundformel, nach der der Moment berechnet werden kann, von dem an die Menschheit einen einzigen Vorfahren hat, findet sich in: D.L.T. Rohde, S. Olson, J.Y. Chank, »Modelling the Recent Common Ancestry of All Living Humans«, in: Nature 431, 2004, S. 562-566.
Wie wenig menschliche Gesellschaften in der Lage sind, ihre Zukunft zu planen und Katastrophen zu vermeiden, ist interessant (und sehr beunruhigend) nachzulesen bei Jared Diamond, Kollaps – Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt 2005.
Mit einem * versehene Begriffe werden im Glossar am Ende des Buches erläutert.
2. KAPITEL
MENSCHENARTEN
Worin nachgewiesen wird, dass es nur eine einzige lebende menschliche Spezies gibt, wir aber Bekanntschaft mit verschiedenen ausgestorbenen Menschenarten machen
Stimmt es eigentlich, dass wir alle zu ein und derselben Menschenart gehören? Heute sind wir da sicher, aber so war es nicht immer. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch die These, dass wir uns auf verschiedene Spezies aufteilen, nach den sogenannten polygenetischen Theorien. In diesem Kontext entstand die Bezeichnung »Buschmänner«: Die europäischen Kolonisten in Südafrika unterschieden »Männer« – richtige Menschen – von »Buschmännern«, die ihnen zufolge einer eigenen Spezies angehörten. Dahinter steckte eine Überlegung – wenn wir das denn eine Überlegung nennen wollen –, die auf einer Reihe von Analogien fußte. So, wie die Beobachtung der Natur zu dem Schluss führte, dass der Mensch allen anderen Kreaturen überlegen ist, so führte die Beobachtung der Menschheit für die Weißen, die die Überlegung anstellten, zu dem Schluss, dass es eine unbestreitbare Überlegenheit der Weißen über alle anderen gibt. Von hier zu der Vorstellung, dass unterschiedlichen Rassen unterschiedliche Grade der Unterlegenheit gegenüber den Weißen entsprechen, ist es nur ein kleiner Schritt.
Der nächste Schritt ist dann die Idee, dass Rassen, die besonders wertlos sind, keine Rassen, sondern ganz andere Arten sind, die von Anfang an fix und fertig so geschaffen waren, wie wir sie kennen. Demnach hat der Mensch nicht nur keinerlei Verwandtschaft mit dem Affen, sondern der weiße Mensch ist auch nicht mit dem schwarzen Menschen verwandt.
Die Menschheit von oben betrachtet
Es ist eine Frage der Perspektive. Festzustellen, ob zwei Individuen derselben Spezies angehören, ist leicht, und hätten sie es unter Beweis stellen wollen, wäre dies auch den Verteidigern des Polygenismus* leichtgefallen. Zwei Fliegen gehören zur selben Art, wenn sie bei Kreuzung Fliegen hervorbringen, die sich ihrerseits reproduzieren können. Pferd und Esel gehören dagegen unterschiedlichen Arten an, weil aus ihrer Kreuzung nur reproduktionsunfähige Nachkommen entstehen, Maultiere und Maulesel. Was Menschen betrifft, war es eigentlich nicht nötig, das entscheidende Experiment anzustellen, nämlich zu beobachten, dass aus ihrer Verbindung fruchtbare Kinder hervorgingen. Das erste Schiff mit afrikanischen Sklaven erreichte Nordamerika im Jahr 1619, und die Zeugung von Nachkommen gemischten Bluts aus der Verbindung von Sklavinnen und Herren (und seltener von Sklaven und Herrinnen) muss bereits wenig später begonnen haben, denn wie sonst hätte es schon 1776, in der Epoche der Amerikanischen Revolution, eine Diskussion darüber gegeben, welche Rechte den zahlreichen Menschen zugebilligt werden sollten, die nicht mit Sicherheit als Schwarze oder Weiße eingeordnet werden konnten.
Am Ende wurde beschlossen, das Problem mit Gesetzen zu lösen, die die Kinder aus gemischten Verbindungen der unterlegenen Rasse zuordneten und jeden als »schwarz« definierten, der nur einen Tropfen schwarzen Bluts hatte (»one-drop rule«): »Die Kreuzung eines Weißen mit einem Indianer ist ein Indianer; die Kreuzung eines Weißen mit einem Neger ist ein Neger; die Kreuzung eines Weißen mit einem Inder ist ein Inder; und die Kreuzung einer der drei europäischen Rassen mit einem Juden ist ein Jude.« Doch das ist eine andere Geschichte.
Hier geht es erst einmal darum, dass es während zweier Jahrhunderte, des achtzehnten und des neunzehnten, für viele Wissenschaftler, die sich mit der Vielfalt der Menschheit beschäftigten, noch bevor sie sich der Tragweite ihres Themas bewusst waren, ein kategorischer Imperativ war, keinen Vorwand dafür zu liefern, dass sich jemand erhob, der unten zu bleiben hatte. Von der Vermischung der Rassen wurden Folgen befürchtet, die von bloßer Verrohung bis zur gründlichen Degeneration der menschlichen Spezies reichten. Auch ein Verteidiger des Monogenismus, also des gemeinsamen Ursprungs der Menschheit, wie Arthur de Gobineau, notierte bei seinem Projekt, die Naturgesetze zu bestimmen, die in der Gesellschaft herrschen, die Bevölkerung Asiens und Afrikas sei eine »recht traurige Ansammlung, mit deren Hässlichkeit wir uns abfinden müssen«, während die Europäer die Vorbilder der Venus, des Apoll und des Herkules Farnese waren. Unsere klassische Schönheit dürfe nicht von wissenschaftlichen Theorien und dergleichen Geschwätz infrage gestellt werden.
Doch das Experiment der Rassenkreuzung wurde fortgesetzt: nicht im Labor, sondern in den Metropolen der Welt, wo Menschen verschiedenster Herkunft aufeinandertrafen, gemischte Familien bildeten und sich problemlos fortpflanzten. Mehr noch: In einer sehr sorgfältigen Studie zu den Ehen in Hawaii, wo Polynesier mit Europäern und Menschen aus China, Japan und manchen anderen Herkunftsländern zusammenleben, hat sich herausgestellt, dass es bei den Kindern »gemischtrassiger« Herkunft keineswegs einen Rückgang, sondern sogar eine leichte Zunahme der Fruchtbarkeit gab. Wir sind also eine einzige Spezies, da gibt es keinen Zweifel. Dennoch verschwanden die polygenetischen Vorstellungen nicht so schnell. Als sich die Wissenschaft von den biologischen Eigenschaften des Menschen, der biologischen Anthropologie, schon längst ausgetüftelter statistischer Methoden bediente, war das polygenetische Denken in den Vereinigten Staaten noch immer stark. Hier hatte sich die evolutionstheoretische Idee einer Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen immer noch leichter durchgesetzt als der Gedanke, dass die Menschen, gleich ob weiß oder schwarz, einfach nur Menschen sind. Manche Leute sahen das so: In Afrika gibt es Schimpansen und Gorillas, also sind die Afrikaner mit Schimpansen und Gorillas verwandt; in Asien gibt es Orang-Utans, also sind die Asiaten Verwandte der Orang-Utans; in Europa … nein, in Europa gibt es keine Menschenaffen. Was daraus folgt: Offenbar gibt es für Europäer keine solche Verwandtschaft. Die anderen stammen vom Affen ab, wir nicht.
Abbildung 1 ist eine berühmte Illustration aus einem amerikanischen polygenetischen Text von 1868, Indigenous Races of the Earth von Nott und Gliddon. Links sehen wir die Köpfe des Apoll vom Belvedere, eines Schwarzen und eines Schimpansen, rechts daneben die entsprechenden Schädel, von denen der erste als »griechisch« etikettiert wird. Dass das Haupt des Apoll vom Belvedere ein Schädelskelett enthält, ist erstaunlich; leider haben die Urheber der Zeichnung nicht erklärt, wie sie – ohne es zu röntgen – zu ihrer Entdeckung gelangt sind. Ihnen geht es aber um etwas anderes, nämlich zu zeigen, dass der Schwarze und der Schimpanse einander mehr ähneln als beide dem Apoll, und nicht etwa aus dem einleuchtenden Grund, das erstere beide Lebewesen sind und der andere eine Statue, sondern wegen der Ähnlichkeit ihrer Schädelknochen. Um diesen Schluss noch weiter nahezulegen, haben Nott und Gliddon die Schädelform der beiden etwas verändert und den des Schwarzen nach hinten gedreht, damit der Kiefer optisch weiter vortrat. Kein menschlicher Schädel hat jemals eine solche Form gehabt.
Die Abbildung, von der wir sprechen, ist ein bekanntes Beispiel für Pseudowissenschaft, doch es ist gut, diese obskuren Darstellungen nicht zu vergessen. Wir alle, der Schreiber dieser Zeilen inbegriffen, tragen mit uns unser Päckchen von alten Vorstellungen und Vorurteilen, die unser Urteil verzerren können, vor allem, wenn wir sie uns nicht bewusst machen.