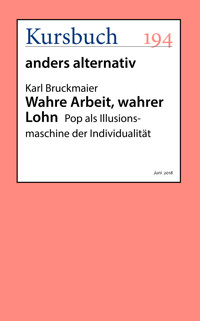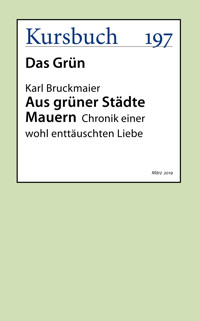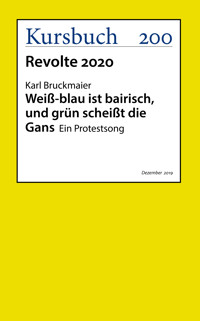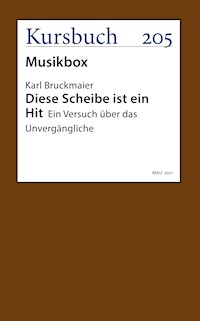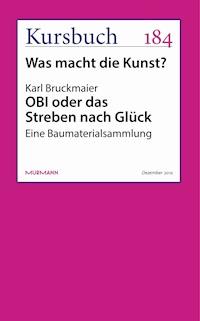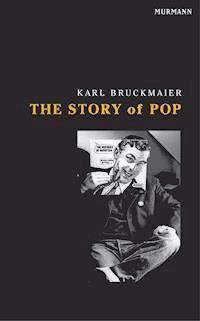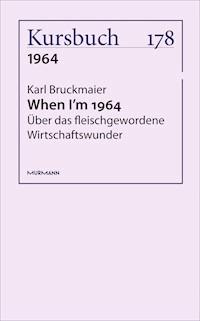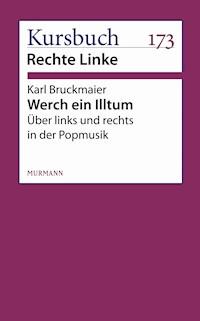
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für das Kursbuch 173 betrachtet Karl Bruckmaier die politische Geschichte der Popmusik. Aufschlussreich demonstriert der Politologe und Kommunikationswissenschaftler, wie sich die Mainstream-Musik im Schmelztiegel Amerika gebildet hat und für eine gemeinsame Kultur der bunt gemischten Einwanderer der neuen Welt stand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 25
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Karl Bruckmaier
Werch ein Illtum
Über links und rechts in der Popmusik
Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern.1 Es sei also, meint der Dichter, nicht ganz so einfach, die Welt anhand der Sitzordnung in der Versammlung der Generalstände von 1789 erklären zu wollen: rechts vom Parlamentspräsidenten der Adel, links von ihm – ja, wer? Links waren jene, die das sich richtig Anfühlende mit den Mitteln der Vernunft zu Ende bringen wollten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Guillotine. »Baby, why don’t we feel guilty? Why does it seem we’re doing right?«2 Alexander Kluge dazu: »Die Gefühle sind die wahren Einwohner der menschlichen Lebensläufe.«3 Entgegen dem rational abgesicherten Wissen über die Beschaffenheit der Welt sowie der Dinge und Vorgänge in ihr fühlen wir, dass wir als Individuum diese Dinge zum Besseren wenden können. Wir hoffen – und handeln – gegen jede Vernunft, und sobald unsere Körper satt sind, hungert unser Ich »nach einem Stückchen Gerechtigkeit auf Erden«4. Das Streben nach Glück, auch das Streben nach dem Glück aller, ist evolutionäres Programm, der »Egoismus der Gene« (Richard Dawkins)5 tendiert zur Verbesserung dieser von Demiurgen hingeschluderten Welt. Und da laut Lenin die Ethik die Ästhetik der Zukunft sein wird6 – ein Satz, aus dem Laurie Anderson 1977 ein Tape-Experiment konstruiert hat: danach könnte Ethik einst auch die Ästhetik der wenigen sein (few/future) –, sind wir schon mittendrin in den im Jahre 2019 anstehenden Feierlichkeiten zu 200 Jahren Popmusik. Doch halt, die Frage an den Autor war eigentlich, ob es überhaupt linke oder rechte Popmusik (noch) gibt. Nun, wir kennen randalierende Oi!-Bands und Skinhead-Nazi-Mucke, sind traurig über eine Maureen Tucker bei der Tea Party und einen Ted Nugent, Johnny Ramone oder Alice Cooper auf dem Republikaner-Ticket; wir können den »Fish Cheer« von Country Joe McDonald dagegensetzen, das Kick Out the Jams! von MC5 vielleicht und die waidwunden Gesänge eines Robert Wyatt, die dialektischen Diskursbrocken der Goldenen Zitronen oder die unterkühlten Endzeit-Lieder der österreichischen Diseuse Gustav. Doch dies zeigt nur, dass es in einer hochgradig individualistischen und mittlerweile in Abertausend Genres zersplitterten Musiklandschaft Belege gibt für jede Behauptung. Es gilt in diesem Text viel eher zu klären, warum aufgrund des intrinsischen Soseins von Pop dieser zwar immer politisch und langfristig aufklärerisch und demokratisch ist, aber deswegen noch lange nicht links im Sinne einer dogmatischen oder parteipolitischen Definition des Begriffs.7
»Take me to the river, drop me in the water.«8
Perry Rhodan